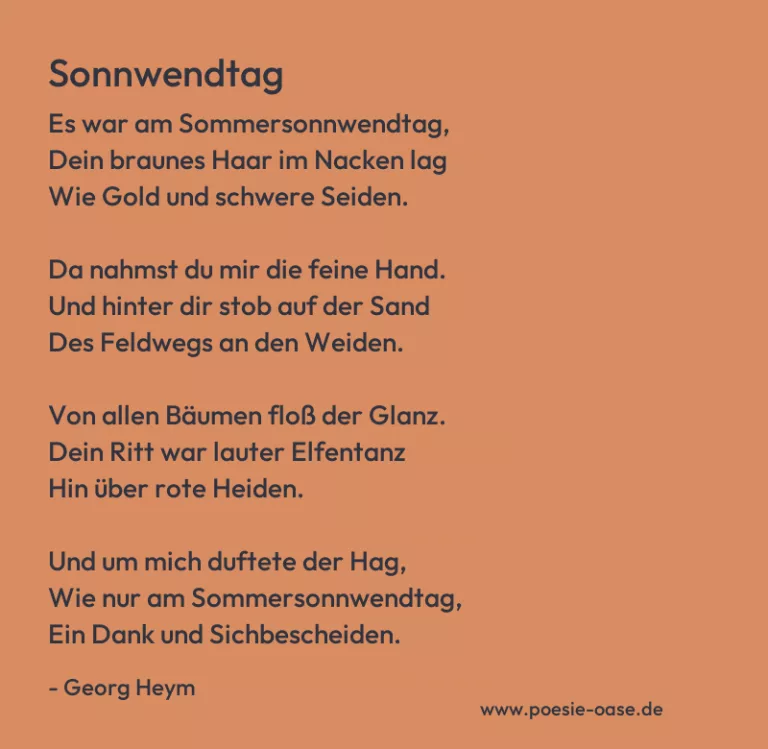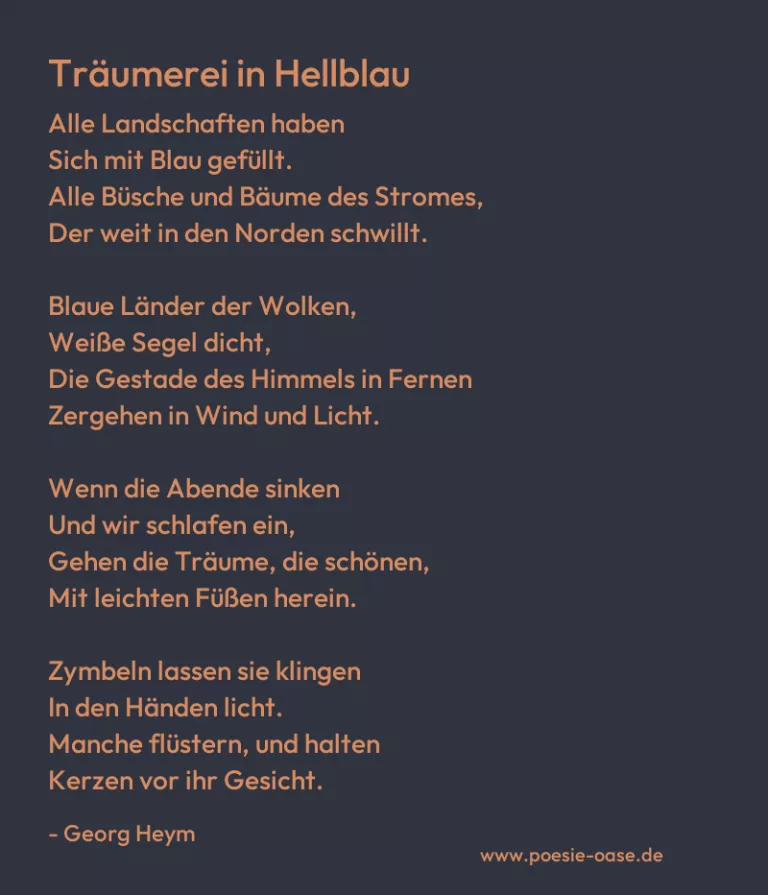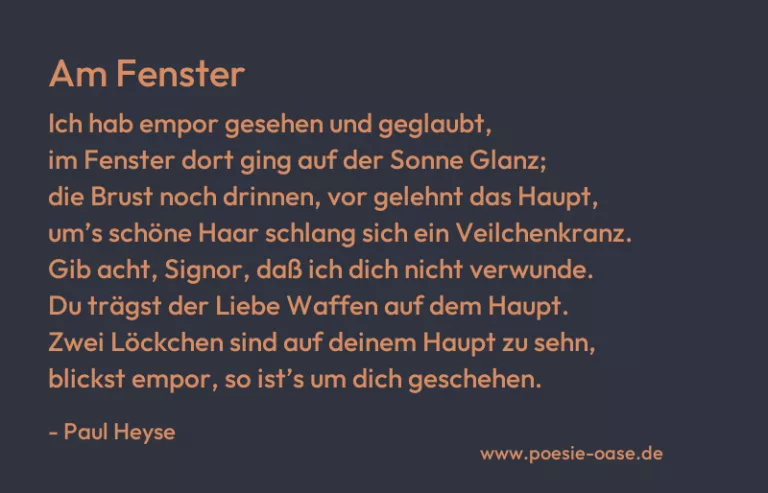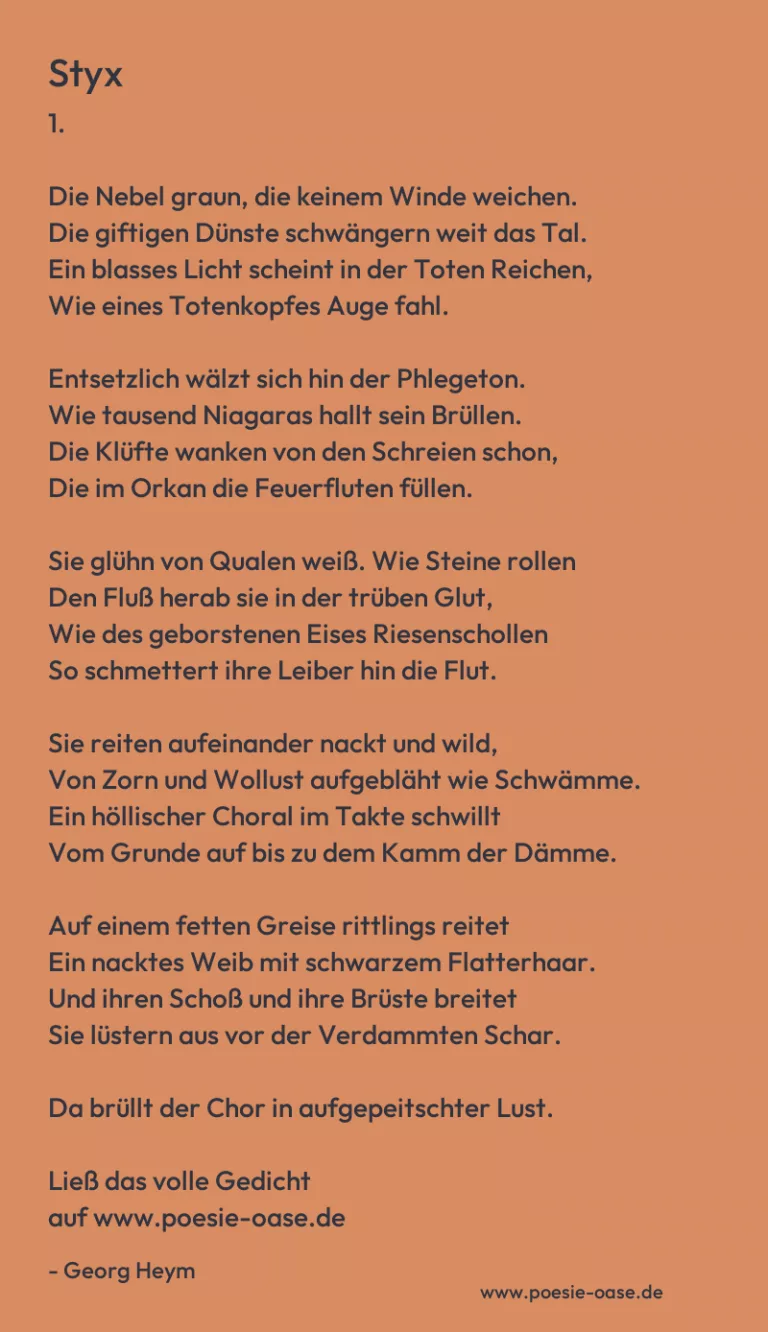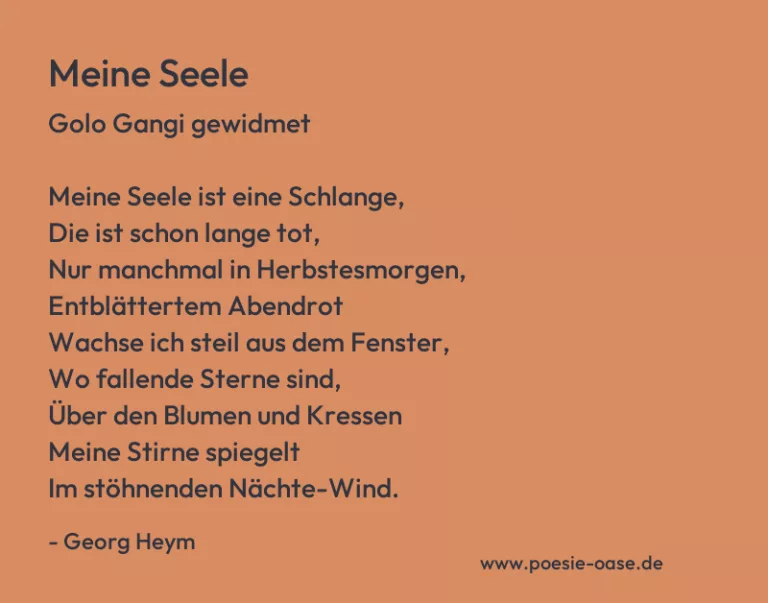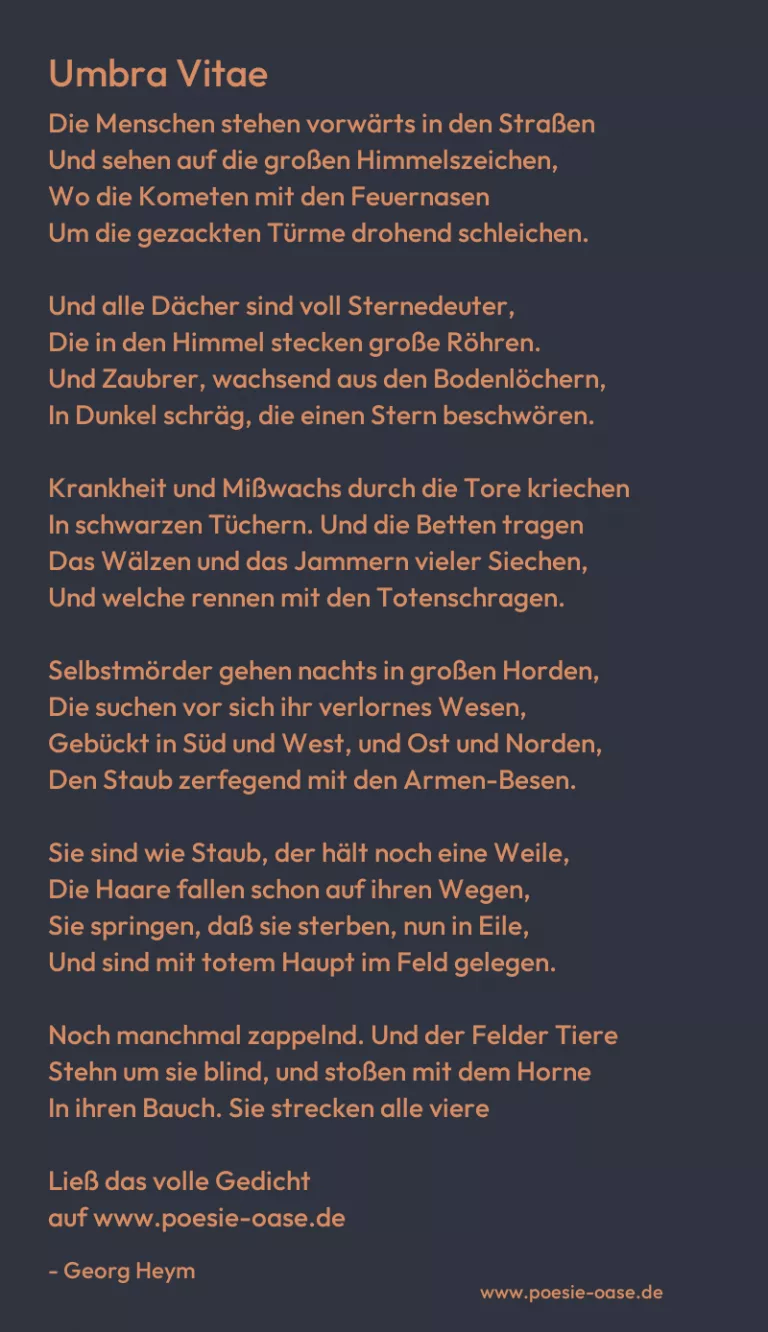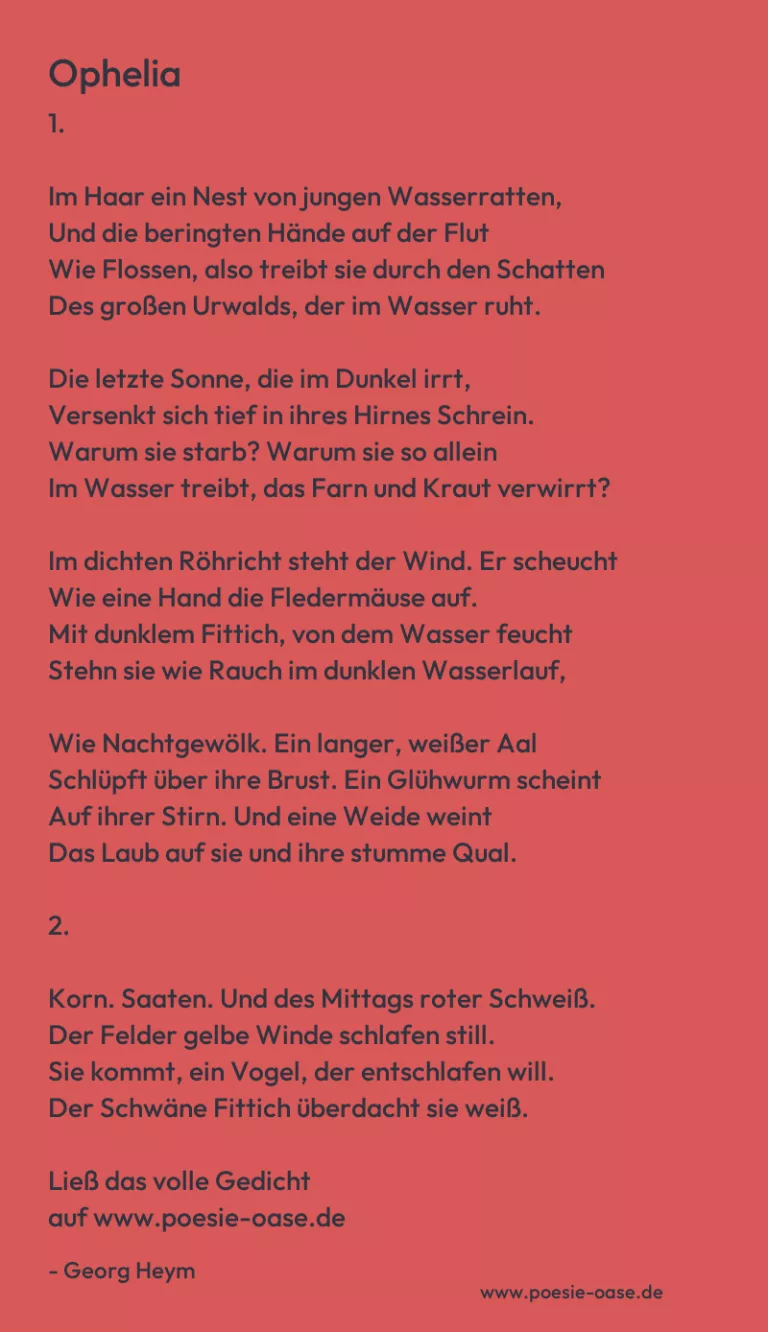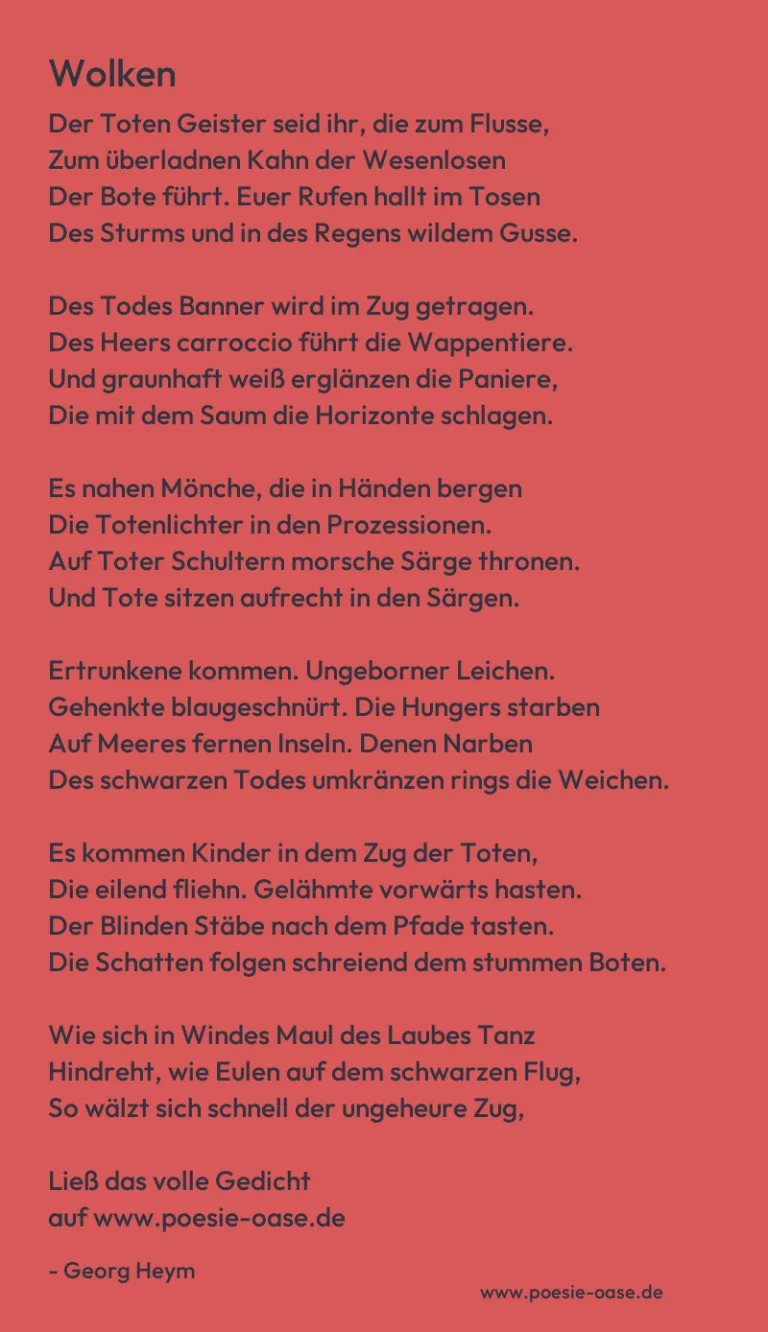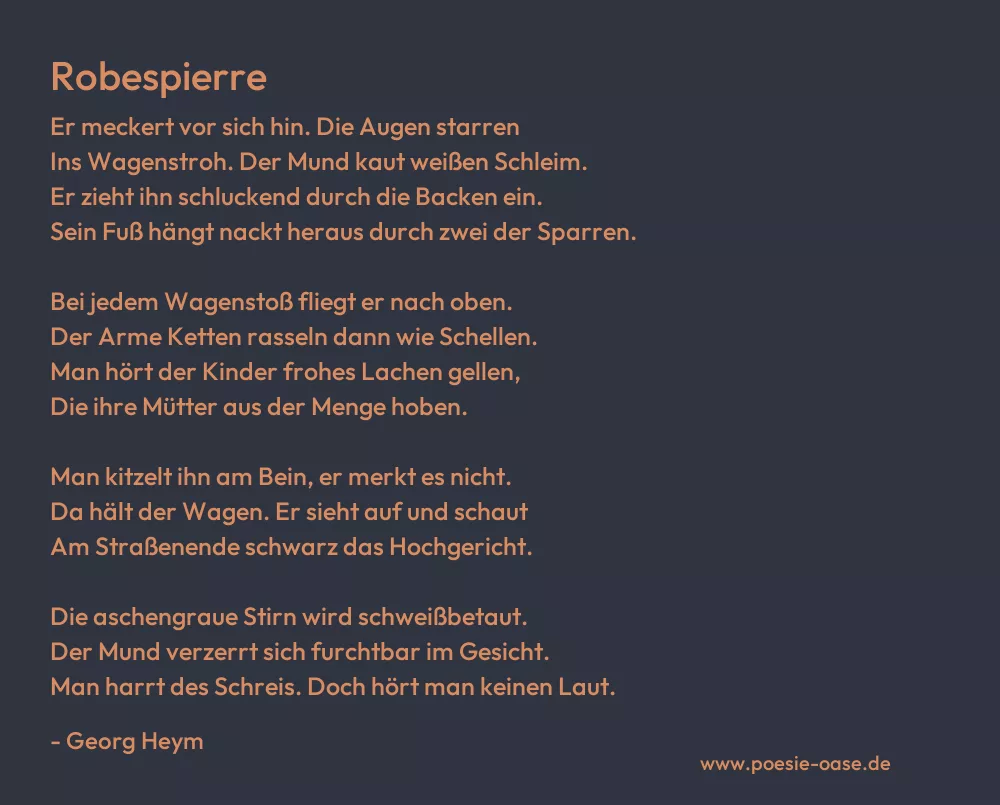Robespierre
Er meckert vor sich hin. Die Augen starren
Ins Wagenstroh. Der Mund kaut weißen Schleim.
Er zieht ihn schluckend durch die Backen ein.
Sein Fuß hängt nackt heraus durch zwei der Sparren.
Bei jedem Wagenstoß fliegt er nach oben.
Der Arme Ketten rasseln dann wie Schellen.
Man hört der Kinder frohes Lachen gellen,
Die ihre Mütter aus der Menge hoben.
Man kitzelt ihn am Bein, er merkt es nicht.
Da hält der Wagen. Er sieht auf und schaut
Am Straßenende schwarz das Hochgericht.
Die aschengraue Stirn wird schweißbetaut.
Der Mund verzerrt sich furchtbar im Gesicht.
Man harrt des Schreis. Doch hört man keinen Laut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
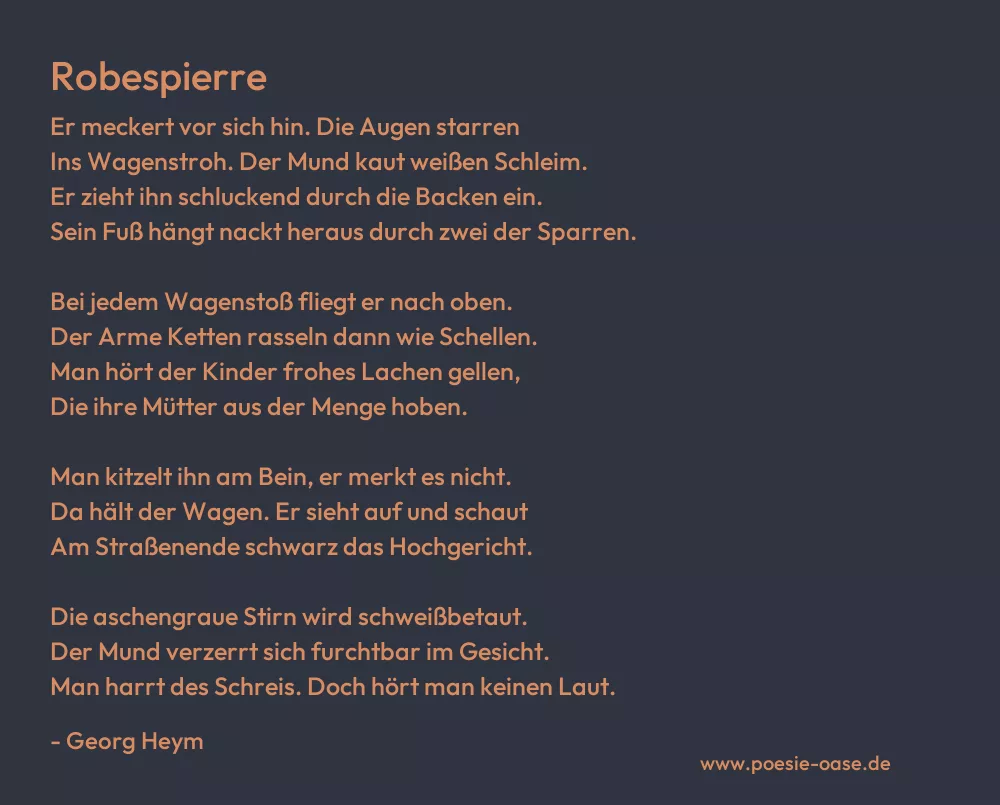
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Robespierre“ von Georg Heym zeichnet ein düsteres und beklemmendes Porträt des Revolutionärs in seinen letzten Momenten vor der Hinrichtung. Die Figur Robespierres wird als gebrochene, entmenschlichte Gestalt beschrieben. Er sitzt im Stroh eines Gefangenentransports, starrt leer vor sich hin und „meckert“, eine Tiermetapher, die seine Entwürdigung und Isolation unterstreicht. Auch das Kauen und Schlucken von „weißem Schleim“ betont den körperlichen Verfall und die seelische Auflösung.
Heym kontrastiert Robespierres innere Leere mit der Außenwelt: Kinder lachen, das Volk ist in aufgeregter Stimmung, während der Gefangene im Wagen von der Welt schon völlig abgekapselt scheint. Die brutale Gleichgültigkeit der Menge gegenüber seinem Zustand – etwa das „Kitzeln“ am Bein – zeigt, wie sehr der einst mächtige Anführer der Französischen Revolution zur öffentlichen Attraktion und Spottfigur degradiert wurde.
Die letzte Szene, in der Robespierre das Hochgericht erkennt, verdichtet die Atmosphäre der Ohnmacht und Ausweglosigkeit. Sein „aschengraues“ Gesicht und der „furchtbar“ verzerrte Mund deuten auf das nahende Entsetzen, doch der erwartete Schrei bleibt aus. Das Schweigen am Ende verstärkt die Wirkung des Gedichts und lässt Robespierre als gebrochene, in sich gefangene Gestalt erscheinen, die keinen Widerstand mehr leisten kann.
Heym gelingt es, in wenigen Versen ein drastisches Bild von Erniedrigung und Todesangst zu zeichnen. Robespierre wird hier nicht als historischer Held oder Schurke gezeigt, sondern als entmenschlichter Verlorener, der von der Gewalt der Geschichte zermalmt wird. Das Gedicht ist damit auch eine düstere Reflexion über Macht, Vergänglichkeit und das Schicksal revolutionärer Figuren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.