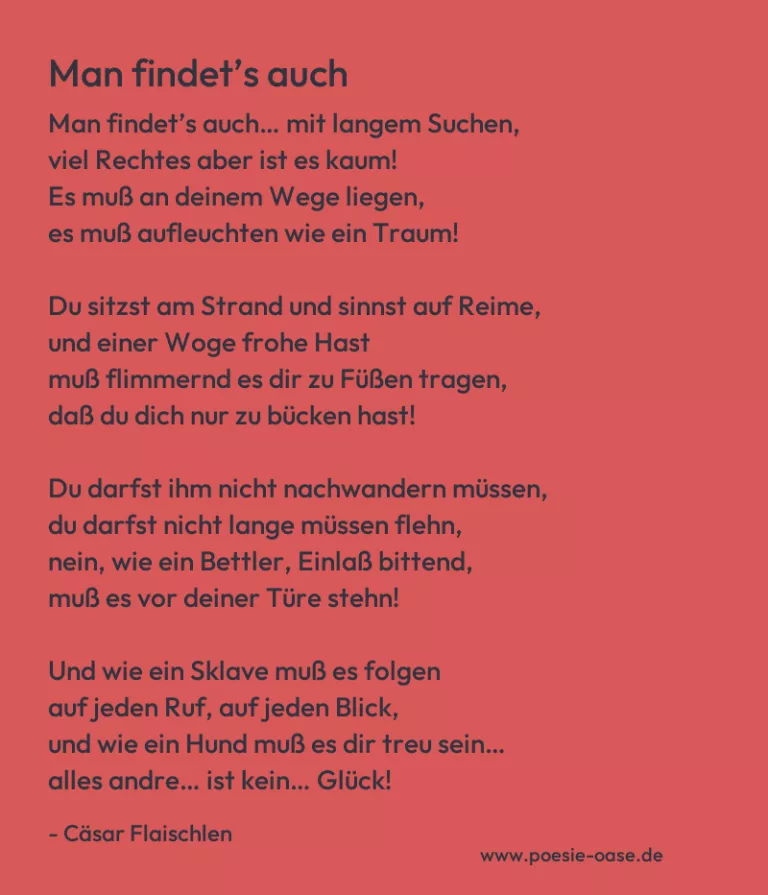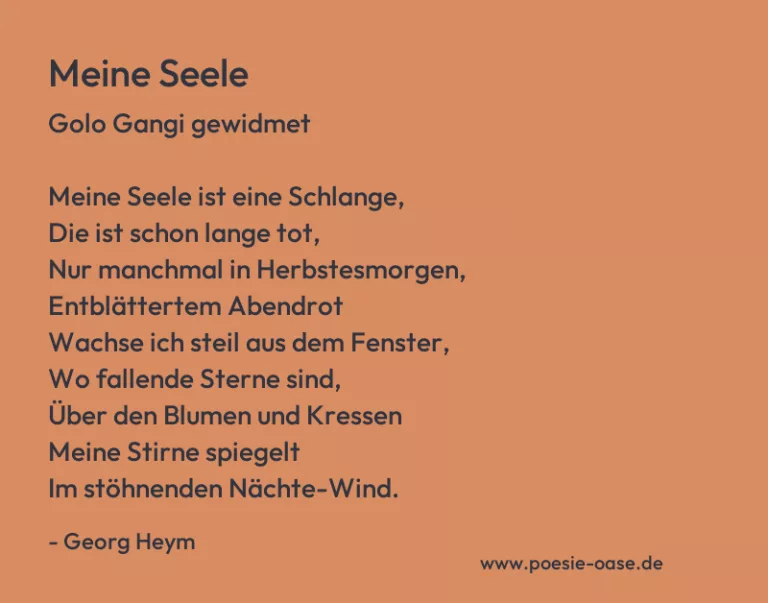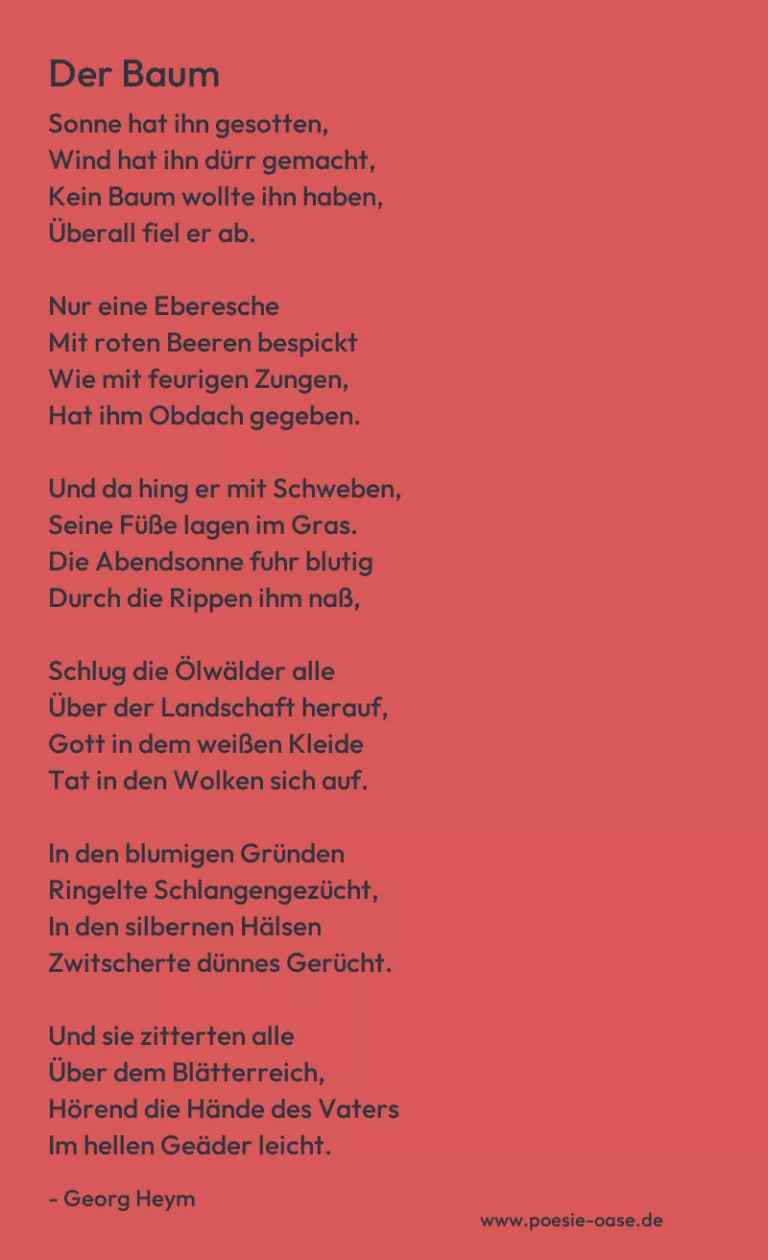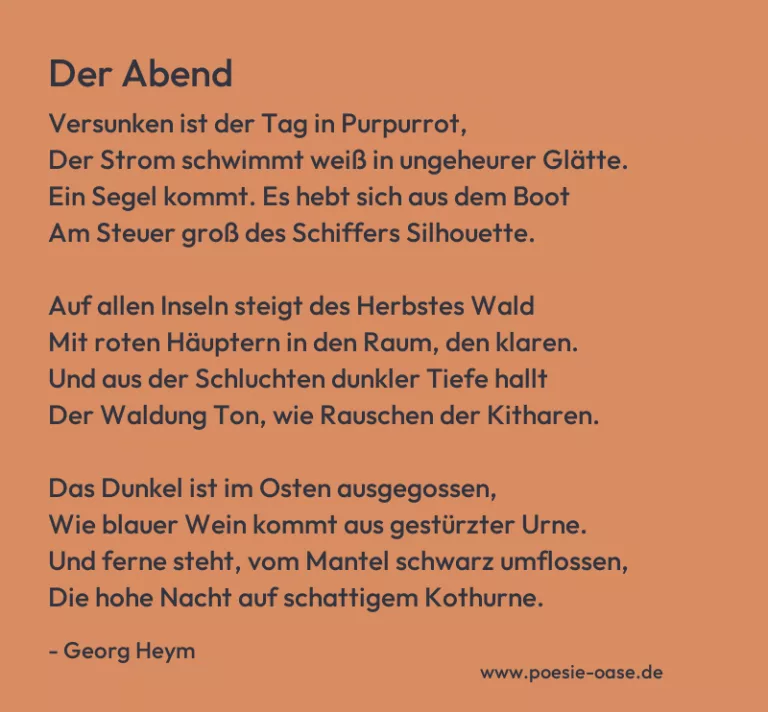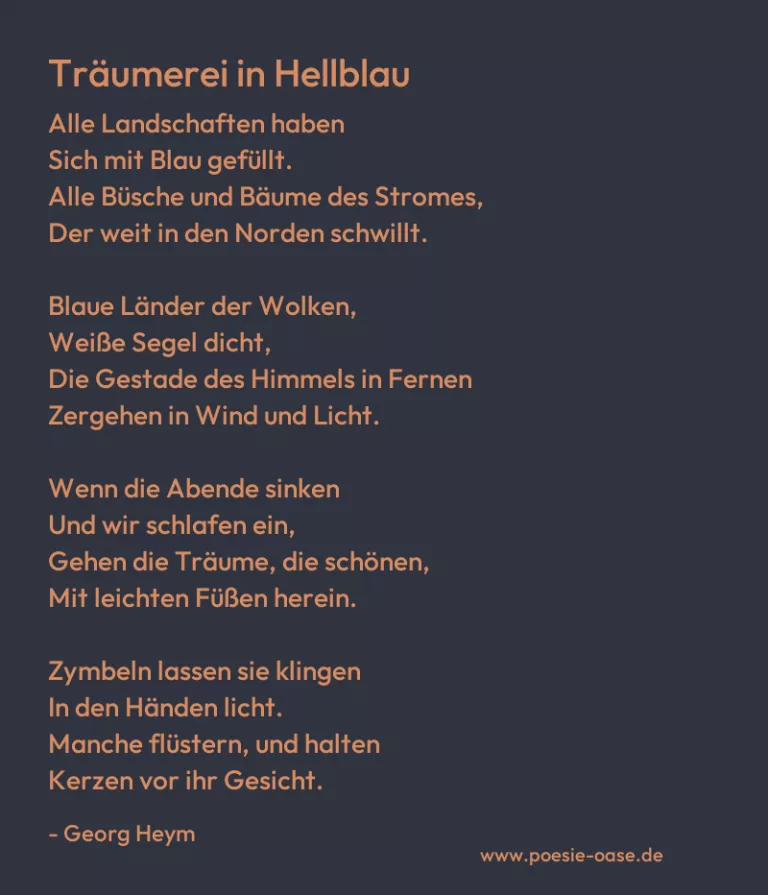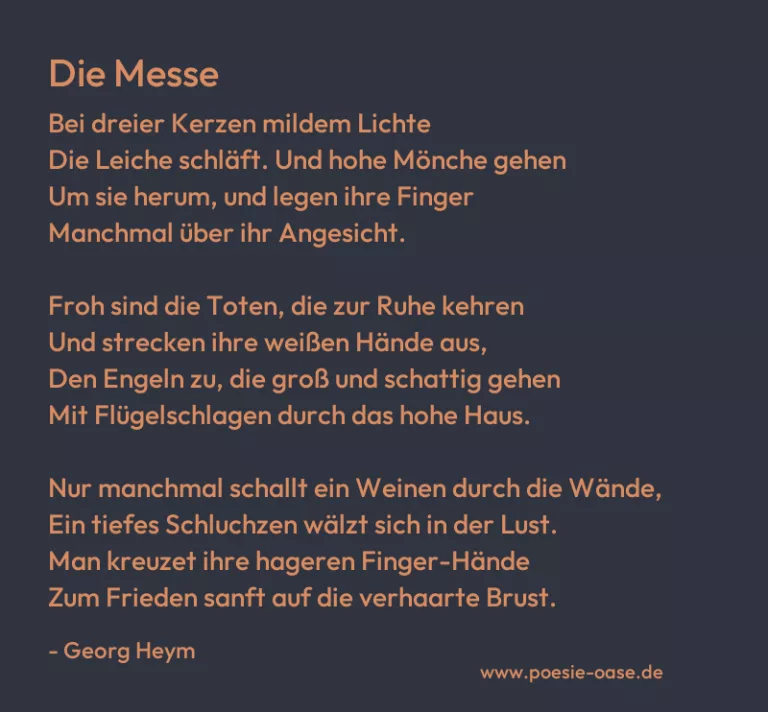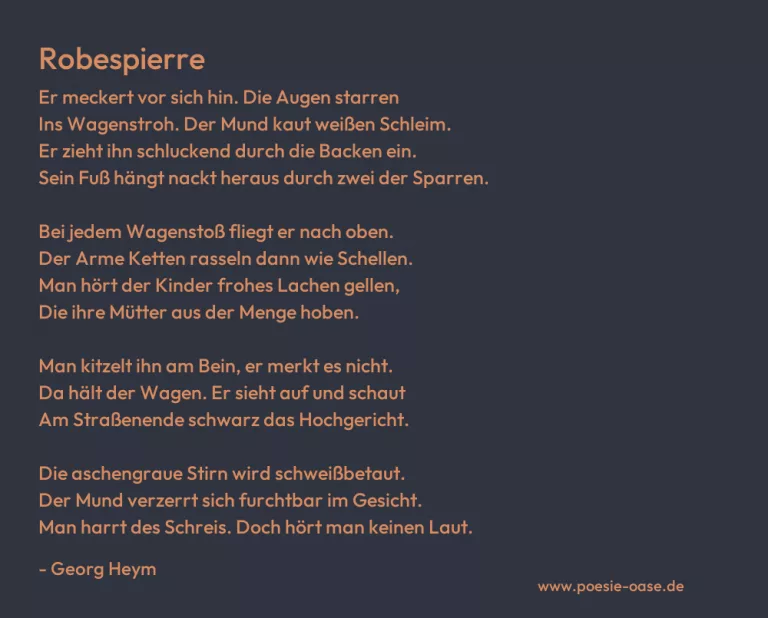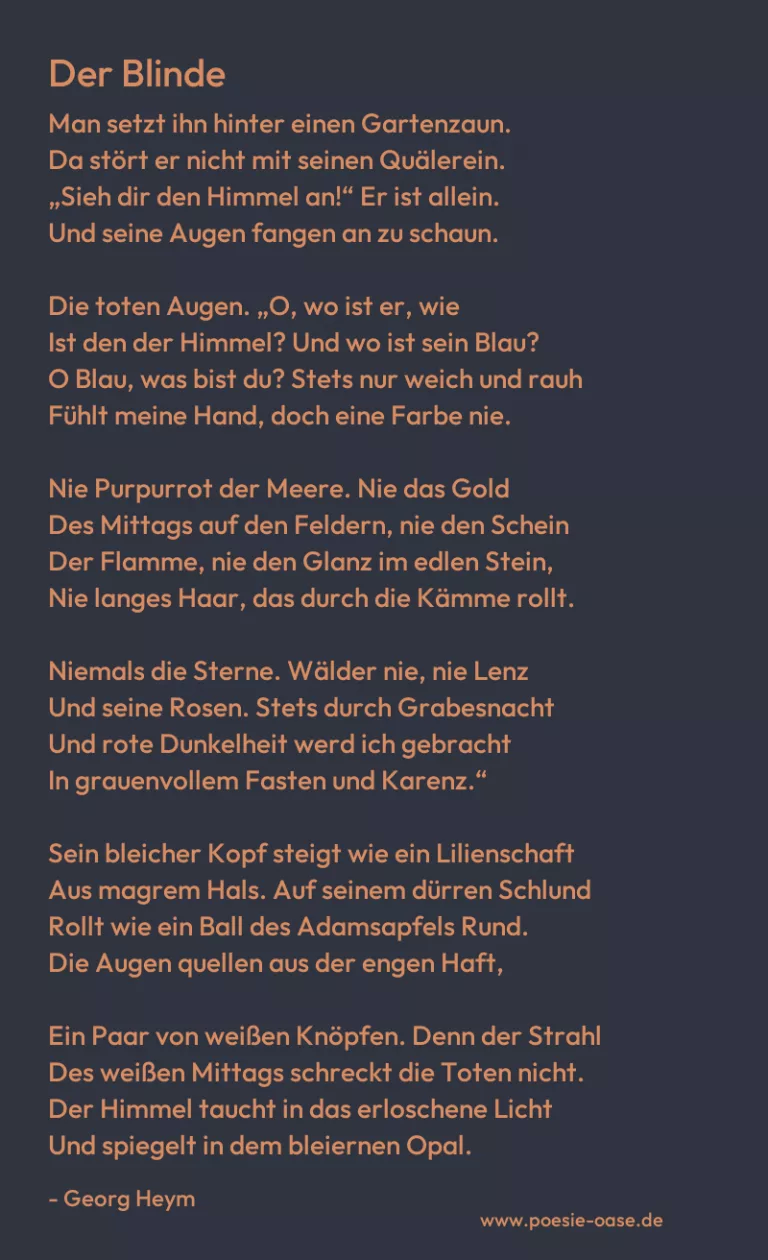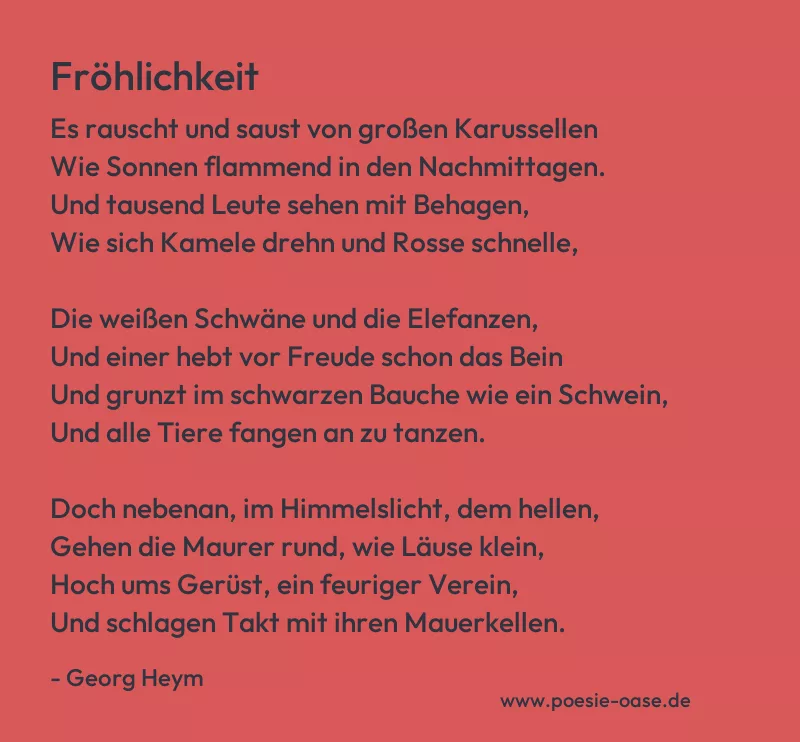Fröhlichkeit
Es rauscht und saust von großen Karussellen
Wie Sonnen flammend in den Nachmittagen.
Und tausend Leute sehen mit Behagen,
Wie sich Kamele drehn und Rosse schnelle,
Die weißen Schwäne und die Elefanzen,
Und einer hebt vor Freude schon das Bein
Und grunzt im schwarzen Bauche wie ein Schwein,
Und alle Tiere fangen an zu tanzen.
Doch nebenan, im Himmelslicht, dem hellen,
Gehen die Maurer rund, wie Läuse klein,
Hoch ums Gerüst, ein feuriger Verein,
Und schlagen Takt mit ihren Mauerkellen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
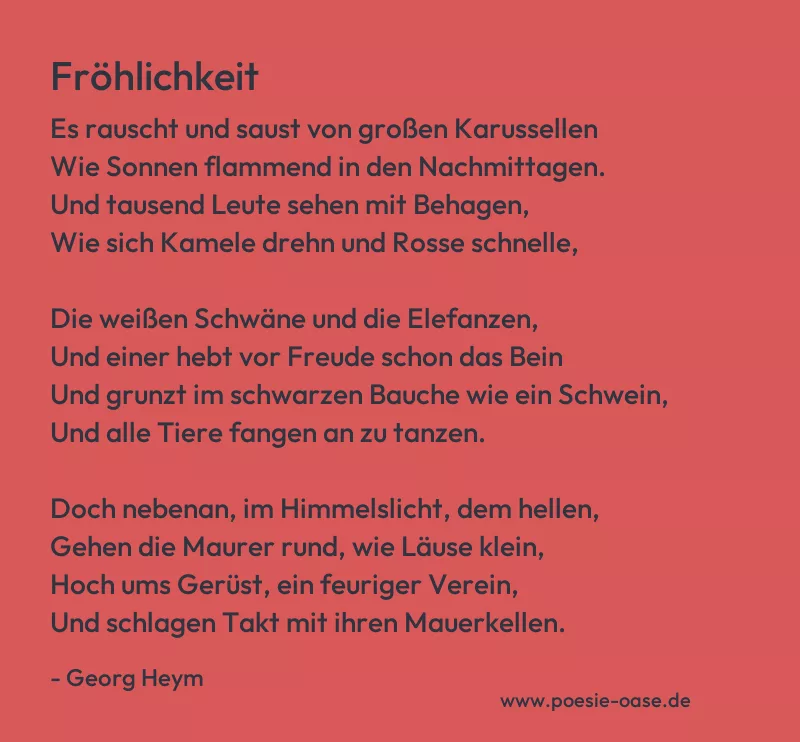
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Fröhlichkeit“ von Georg Heym thematisiert auf ironische und zugleich kritische Weise die Vergnügungskultur der Großstadt. Im Zentrum steht zunächst die Darstellung eines bunten, lärmenden Jahrmarkts mit „großen Karussellen“, die in den „Nachmittagen“ wie Sonnen leuchten. Die Szenerie ist von Bewegung und kindlicher Freude geprägt: Tiere wie „Kamele“, „Schwäne“ und „Elefanten“ drehen sich, während die Menschen mit „Behagen“ zusehen. Die Karikatur eines Besuchers, der „vor Freude schon das Bein hebt“ und „wie ein Schwein“ grunzt, gibt der Szene eine groteske Komik.
Heym spielt hier mit dem Motiv der Entfremdung. Die „Fröhlichkeit“ wirkt überdreht und fast mechanisch. Die Tiere des Karussells, die tanzen, wirken wie Marionetten eines künstlichen Spektakels. Gleichzeitig erhält das Bild durch den tierischen Vergleich und die Überzeichnung der Reaktionen der Menschen eine subtile Kritik an der Oberflächlichkeit und der Massendynamik solcher Vergnügungen.
Die letzte Strophe bringt eine überraschende Wendung: Neben dem ausgelassenen Treiben arbeiten die Maurer, die „wie Läuse klein“ um das Gerüst gehen. Dieser Vergleich entwertet die menschliche Arbeit, indem er die Arbeiter zu winzigen, beinahe parasitären Gestalten reduziert. Gleichzeitig erscheint ihr „feuriger Verein“ im „Himmelslicht“ fast wie ein Gegenbild zur künstlichen Fröhlichkeit des Karussells. Das Schlagen der Mauerkellen als „Takt“ setzt die Handlungen der Arbeiter jedoch in eine fast zynische Verbindung zum Rhythmus der Schaustellerwelt.
Insgesamt zeichnet Heym ein ambivalentes Bild der „Fröhlichkeit“: Zwischen mechanischer Unterhaltung und harter Alltagsrealität entlarvt er die Vergnügungskultur als oberflächliche Flucht aus der Tristesse der Arbeitswelt, wobei beide Sphären gleichermaßen von Monotonie und Fremdbestimmung geprägt sind. Die Ironie des Gedichts unterstreicht die kritische Haltung gegenüber einer modernen Gesellschaft, in der echte Fröhlichkeit kaum mehr zu finden ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.