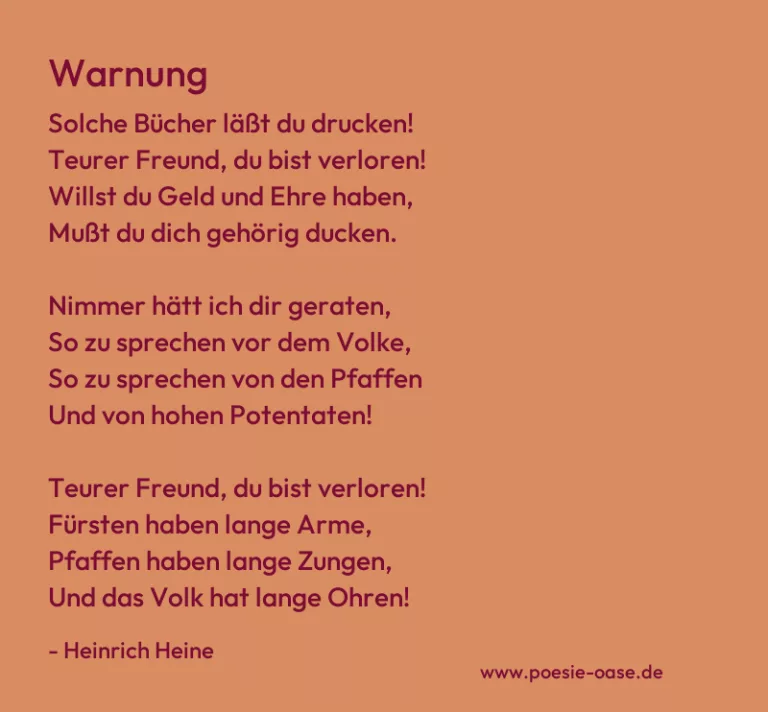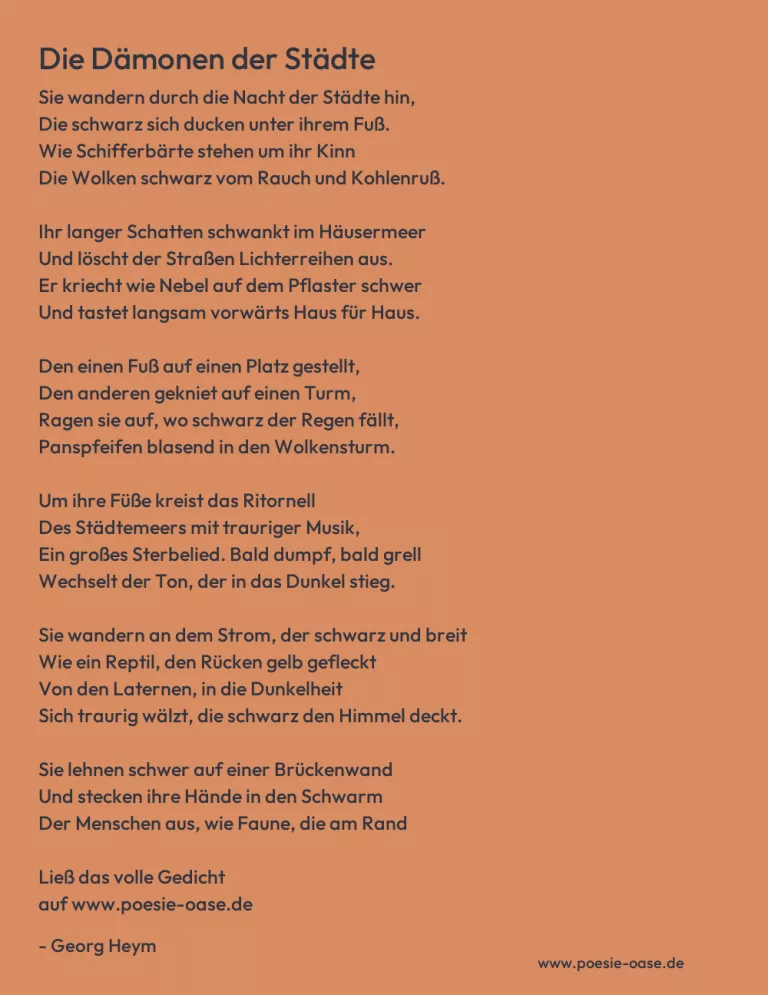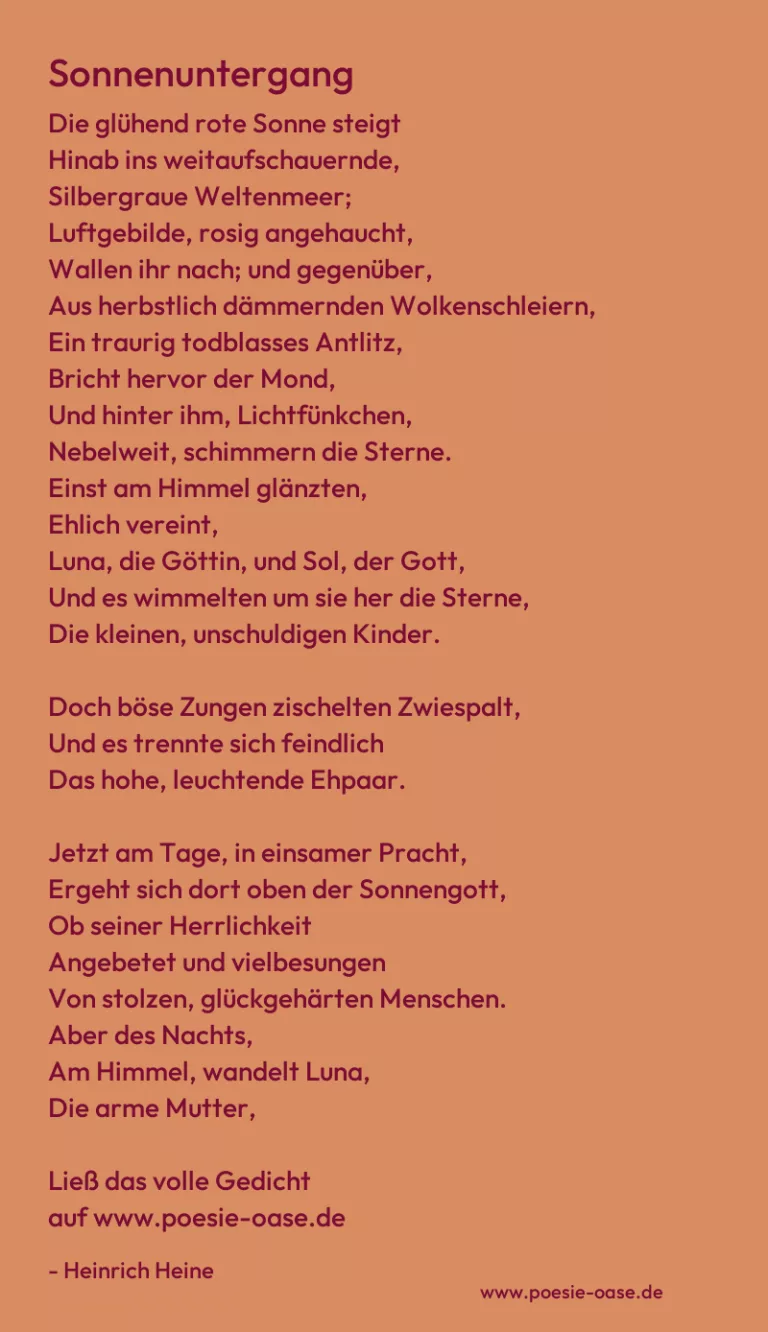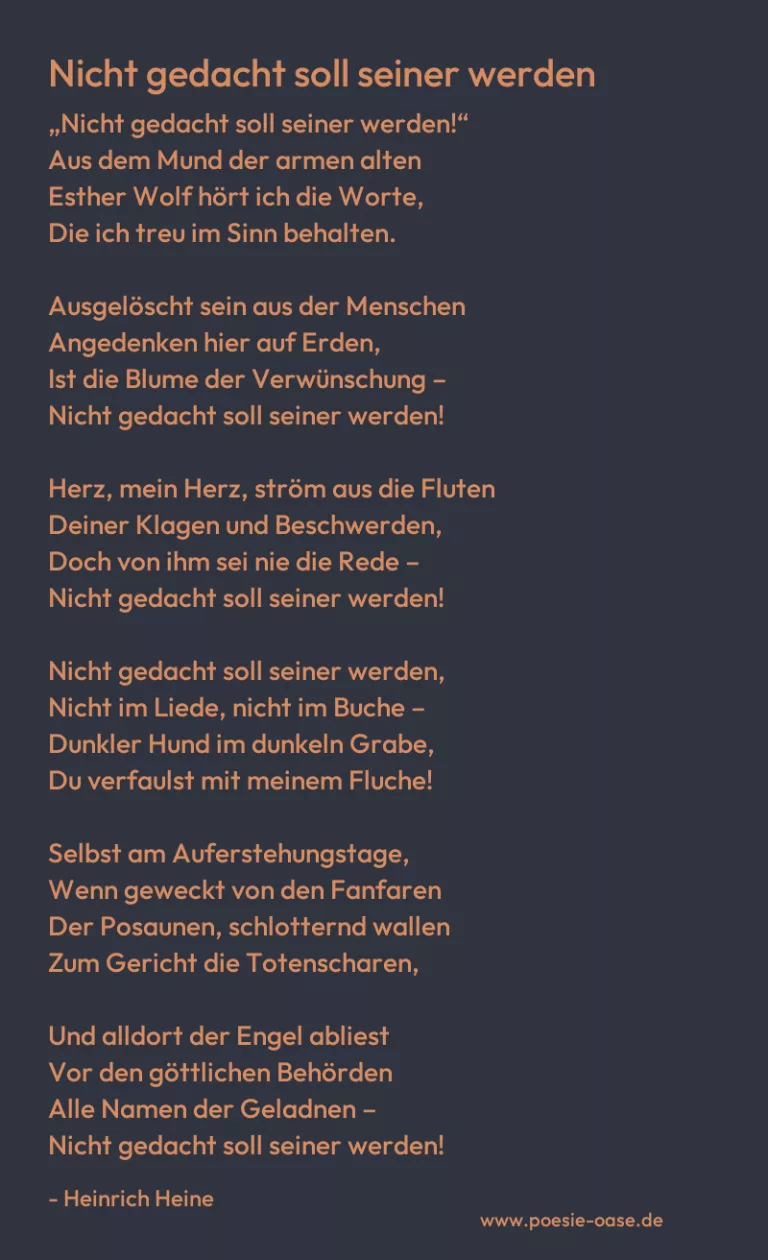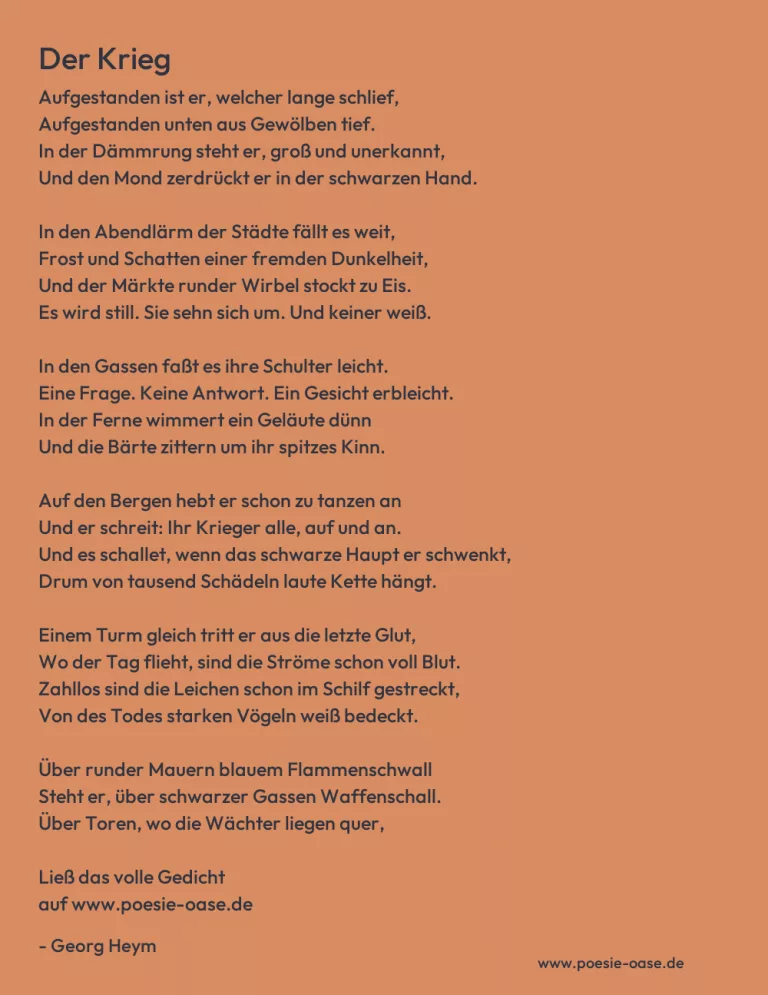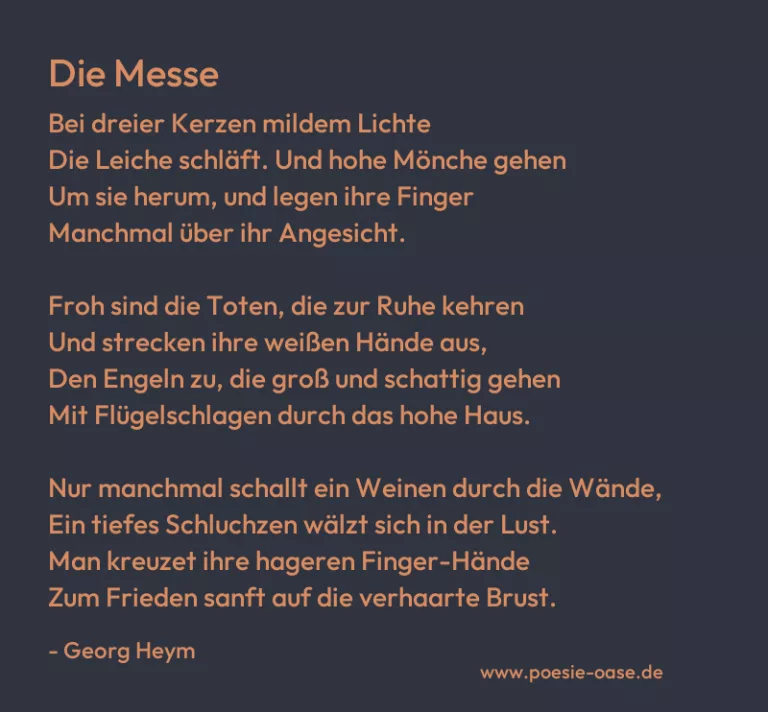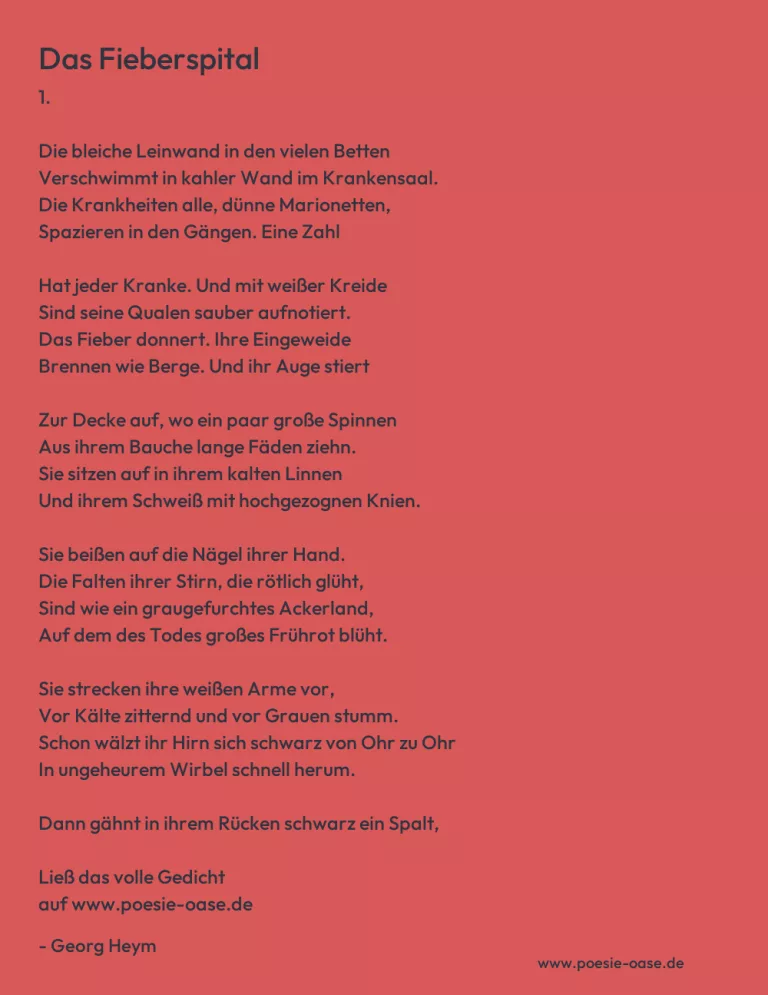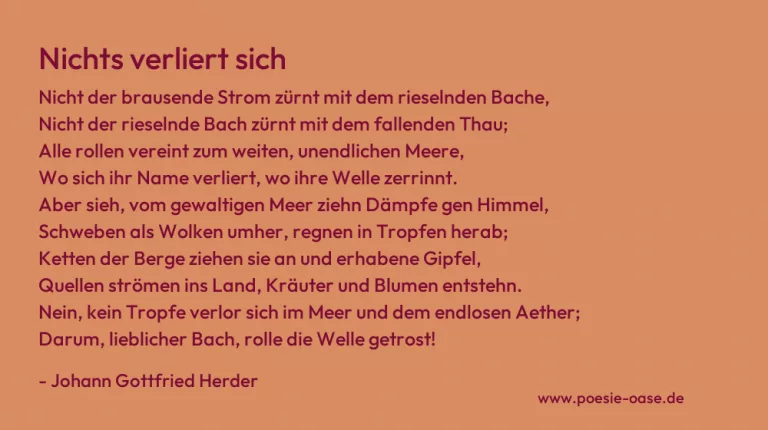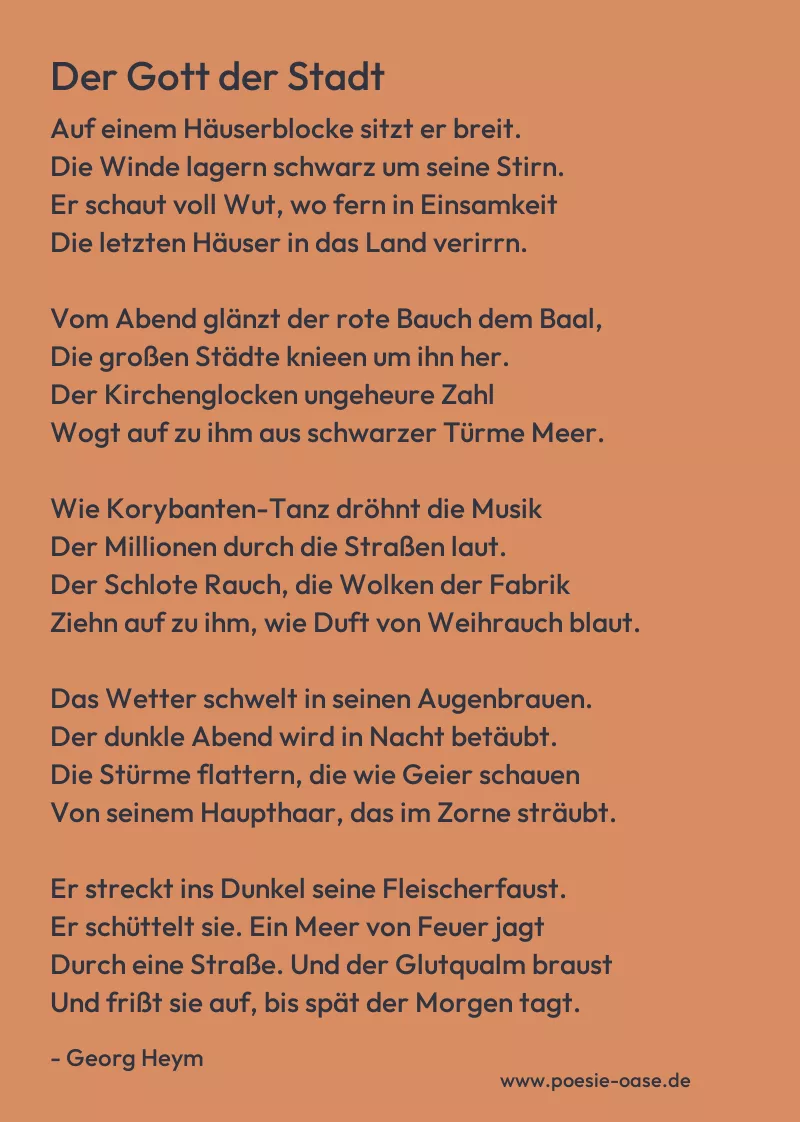Angst, Emotionen & Gefühle, Feiern, Gemeinfrei, Götter, Himmel & Wolken, Leichtigkeit, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Mythen & Legenden, Natur, Tiere
Der Gott der Stadt
Auf einem Häuserblocke sitzt er breit.
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit
Die letzten Häuser in das Land verirrn.
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,
Die großen Städte knieen um ihn her.
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.
Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik
Der Millionen durch die Straßen laut.
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut.
Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen.
Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt.
Die Stürme flattern, die wie Geier schauen
Von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt.
Er streckt ins Dunkel seine Fleischerfaust.
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt
Durch eine Straße. Und der Glutqualm braust
Und frißt sie auf, bis spät der Morgen tagt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
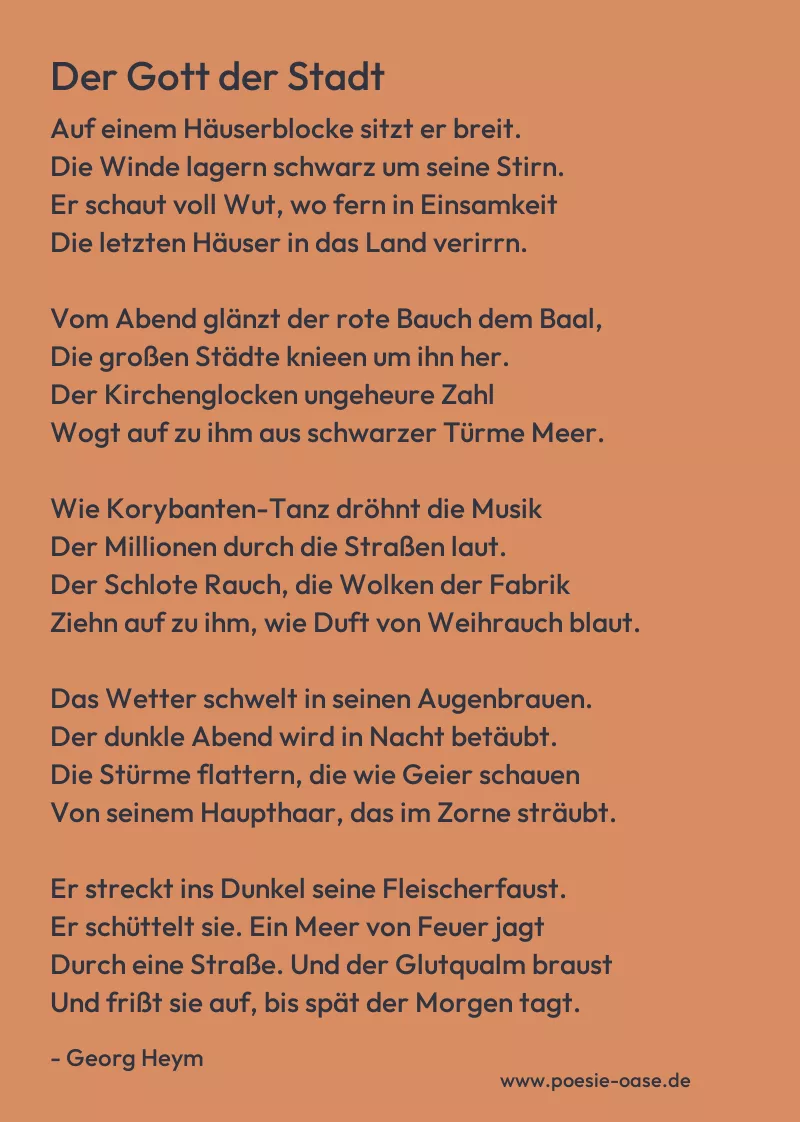
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Gott der Stadt“ von Georg Heym schildert in düsteren, apokalyptischen Bildern eine Verkörperung der zerstörerischen Macht der modernen Großstadt. Heym inszeniert die Stadt als einen mächtigen, wütenden Gott, der über den Häusern thront und eine bedrohliche Präsenz ausstrahlt. Bereits zu Beginn wird dieser Gott mit breiter Gestalt auf einem Häuserblock sitzend dargestellt, umgeben von dunklen Winden, was seine Macht und Unheil bringende Natur betont.
Zentrale Themen des Gedichts sind die Entfremdung und die Bedrohung, die von der Industrialisierung und der Massengesellschaft ausgehen. Die Stadt wird in Form eines Götzen (in Anlehnung an den „Baal“) beschrieben, der von den Städten „angebetet“ wird. Die Kirchenglocken wirken wie ein verzweifelter, ohnmächtiger Ruf, der im „schwarzen Türme Meer“ untergeht. Die Stadt erscheint als eine Art Kultstätte, deren „Weihrauch“ aus den Rauchschwaden der Industrie besteht, während die „Musik der Millionen“ – das hektische Treiben der Großstadt – wie ein unheilvoller Kulttanz wirkt.
Heym bedient sich einer stark expressionistischen Bildsprache, die von Gewalt, Zorn und Untergangsstimmung geprägt ist. Besonders in den letzten Strophen verdichtet sich das Bild eines zornigen, rächenden Gottes, der mit seiner „Fleischerfaust“ ins Dunkel schlägt und die Stadt in ein Flammenmeer stürzt. Die Naturgewalten, die „wie Geier“ von seinem Haupthaar flattern, und das heraufziehende „Meer von Feuer“ symbolisieren den Ausbruch einer zerstörerischen Katastrophe.
Insgesamt lässt sich das Gedicht als düstere Kritik an der Entmenschlichung und den unheilvollen Kräften der modernen Großstadt lesen. Die Stadt wird als dämonisches, übermächtiges Wesen dargestellt, das seine Bewohner verschlingt und vernichtet. Heym verbindet hier Elemente von antiker Mythologie, religiöser Symbolik und moderner Zivilisationskritik zu einer eindrucksstarken apokalyptischen Vision.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.