Die Stadt liegt klein
Und grau in grauem Grunde.
In einer schwülen Abenddämmerstunde,
Wenn alles schwiege, auch die Hunde –
Dann könnt es sein:
Ein lautes Wort aus eines Menschen Munde –
Und Alles stürzte ein.
Die Stadt liegt klein
Und grau in grauem Grunde.
In einer schwülen Abenddämmerstunde,
Wenn alles schwiege, auch die Hunde –
Dann könnt es sein:
Ein lautes Wort aus eines Menschen Munde –
Und Alles stürzte ein.
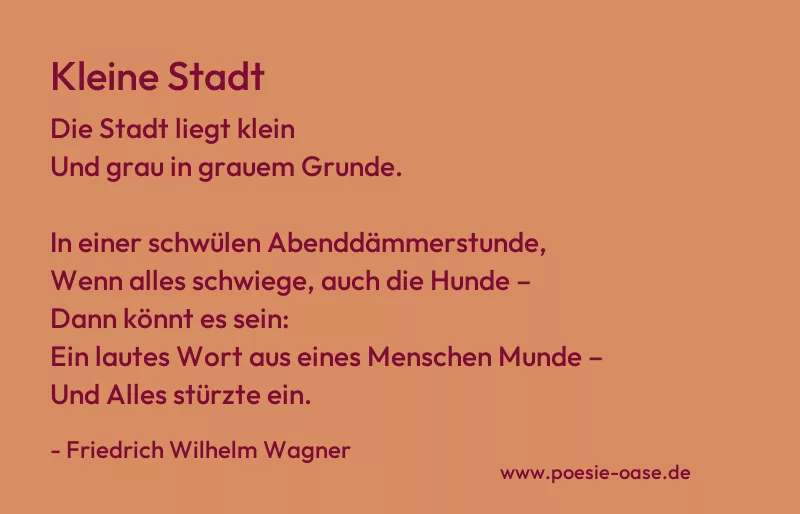
Das Gedicht „Kleine Stadt“ von Friedrich Wilhelm Wagner malt ein Bild einer bescheidenen, fast bedrückenden Stadt. Die „kleine“ und „graue“ Stadt, die „in grauem Grunde“ liegt, wird als unscheinbar und vielleicht sogar trostlos beschrieben. Das Bild der Stadt, das hier gezeichnet wird, vermittelt eine Atmosphäre der Stillheit und der Unbeweglichkeit. Die graue Farbgebung kann als Symbol für eine fehlende Lebendigkeit oder Hoffnung verstanden werden – die Stadt scheint in einem Zustand der Trägheit oder des Stillstands zu existieren.
Die „schwüle Abenddämmerstunde“ verstärkt das Gefühl von Erdrückung und Bedrückung. In dieser Zeit der Dämmerung, in der die Tagesgeräusche verstummen und „alles schweige“, auch die Hunde, tritt eine beklemmende Stille ein. Diese Stille könnte als Metapher für eine Gesellschaft oder ein Leben verstanden werden, das von Unsicherheit und innerer Leere geprägt ist. Die Tatsache, dass in dieser stillen Stunde ein einziges „lautet Wort“ aus dem Mund eines Menschen genügen würde, um „Alles stürzte ein“, verstärkt das Gefühl der Fragilität der Stadt und ihrer Ordnung. Es suggeriert, dass die ganze Struktur der Stadt, sowohl im physischen als auch im sozialen Sinne, äußerst zerbrechlich ist.
Das Gedicht könnte somit als eine Reflexion über die Zerbrechlichkeit von Gemeinschaften oder sozialen Strukturen gelesen werden. In der scheinbar ruhigen Oberfläche liegt eine latente Spannung, die jederzeit durch ein einziges, entscheidendes Ereignis oder Wort ausgelöst werden könnte. Diese tiefere Bedeutung verweist auf die Fragilität menschlicher Beziehungen und Gesellschaften, die unter der Oberfläche oft ein verborgenes, nicht gesprochenes Potential zur Zerstörung in sich tragen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.