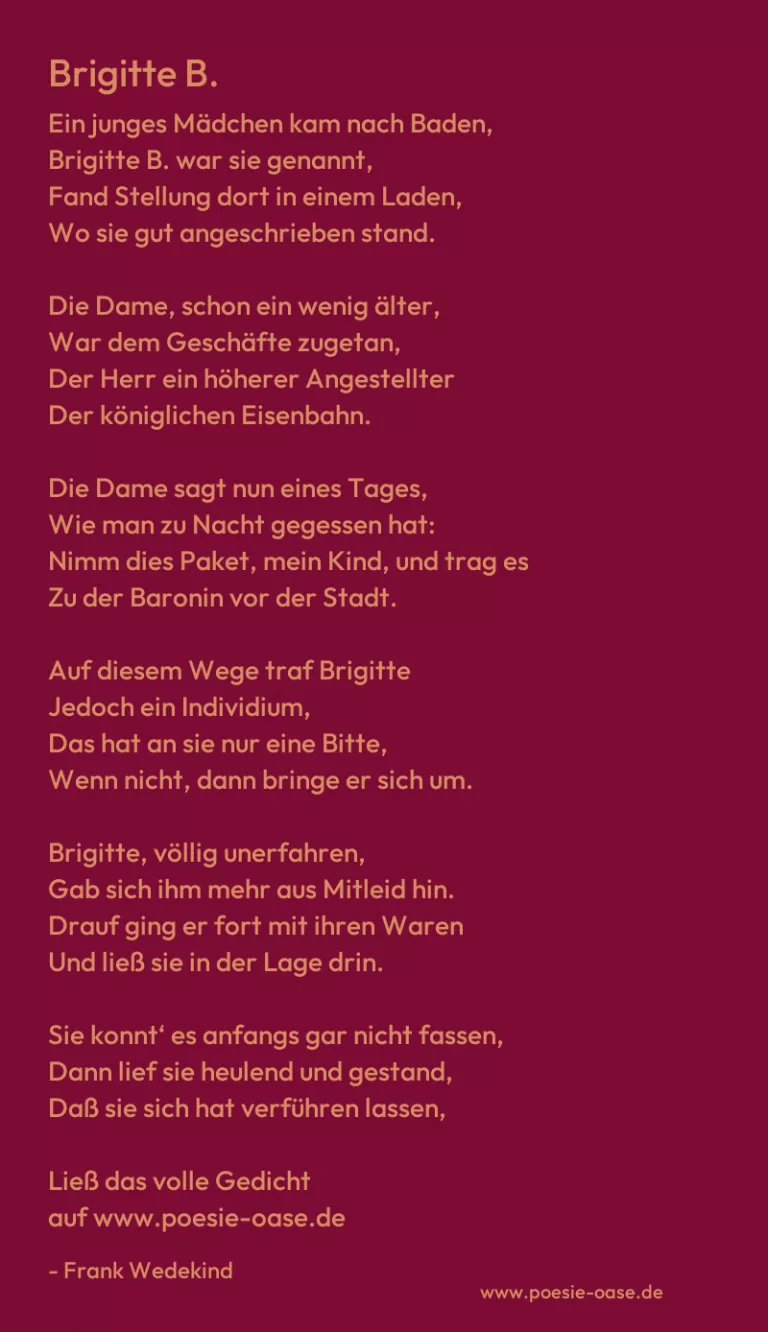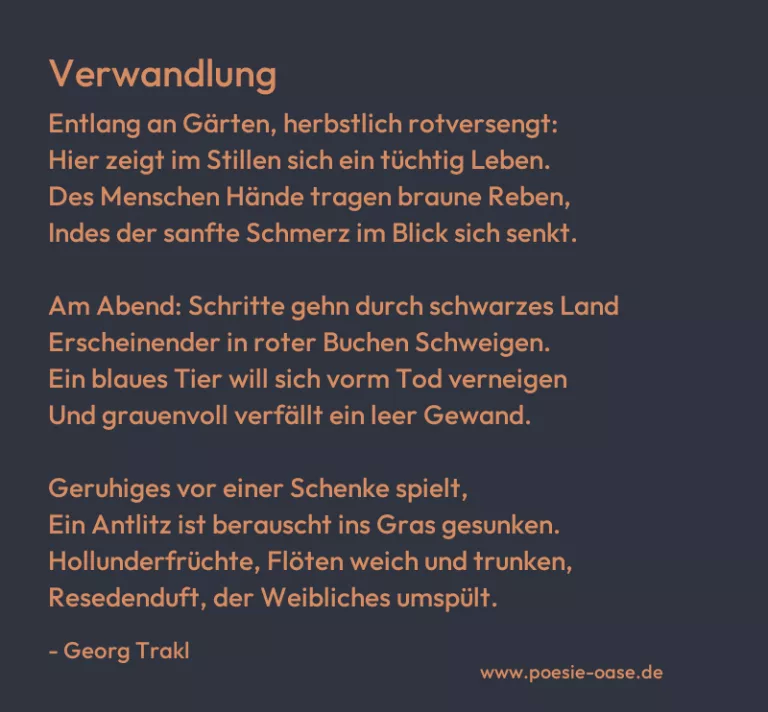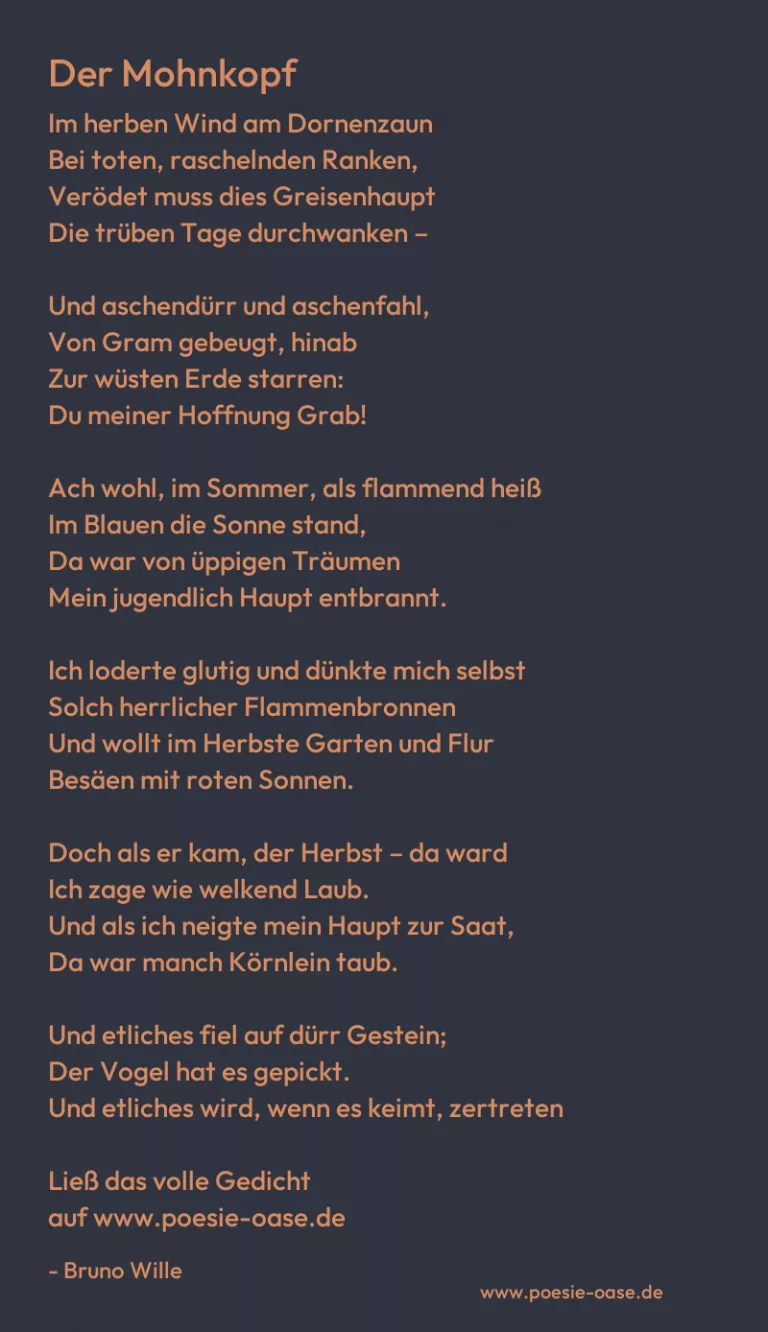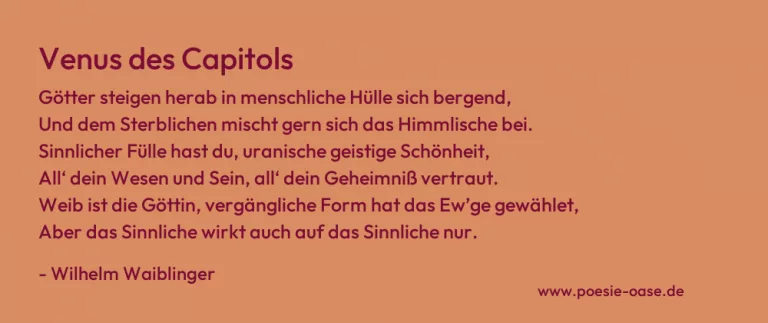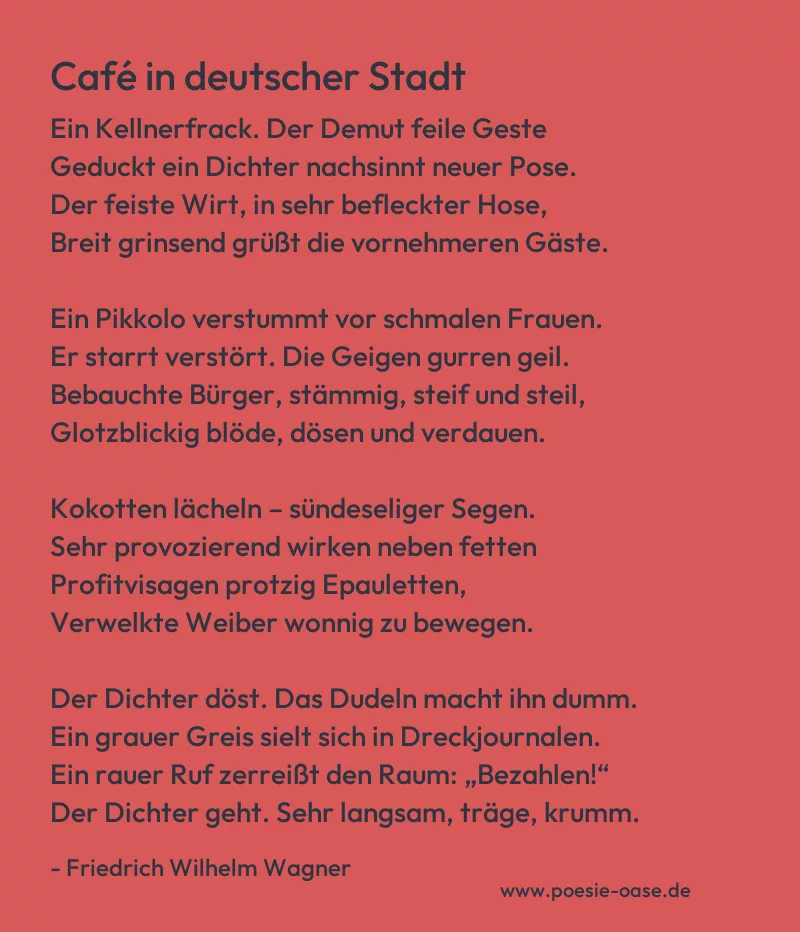Café in deutscher Stadt
Ein Kellnerfrack. Der Demut feile Geste
Geduckt ein Dichter nachsinnt neuer Pose.
Der feiste Wirt, in sehr befleckter Hose,
Breit grinsend grüßt die vornehmeren Gäste.
Ein Pikkolo verstummt vor schmalen Frauen.
Er starrt verstört. Die Geigen gurren geil.
Bebauchte Bürger, stämmig, steif und steil,
Glotzblickig blöde, dösen und verdauen.
Kokotten lächeln – sündeseliger Segen.
Sehr provozierend wirken neben fetten
Profitvisagen protzig Epauletten,
Verwelkte Weiber wonnig zu bewegen.
Der Dichter döst. Das Dudeln macht ihn dumm.
Ein grauer Greis sielt sich in Dreckjournalen.
Ein rauer Ruf zerreißt den Raum: „Bezahlen!“
Der Dichter geht. Sehr langsam, träge, krumm.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
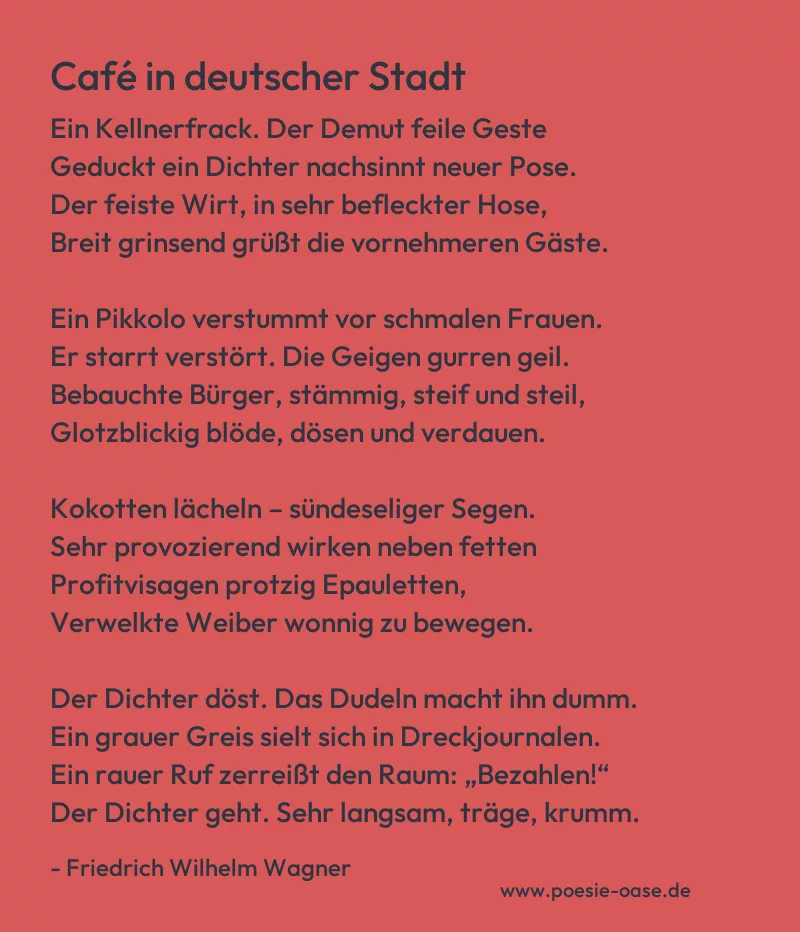
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Café in deutscher Stadt“ von Friedrich Wilhelm Wagner beschreibt eine szenische Beobachtung des Lebens in einem Café, wobei die Darstellung von Menschen und ihrer Gesellschaft von einer kritischen, beinahe satirischen Perspektive geprägt ist. Die erste Strophe eröffnet mit dem Bild des „Kellnerfracks“, der „Demut feile Geste“ und einem „Dichter“, der nach einer „neuen Pose“ nachsinnt. Der Dichter wird hier als eine Figur der Reflexion und der inneren Zerrissenheit dargestellt, die in einer Welt des äußeren Scheins und der sozialen Rollenzwänge lebt. Der Dichter scheint sich nach einer neuen Ausdrucksform oder einem neuen Weg zu sehnen, ist aber von der Alltäglichkeit der Umgebung und seiner eigenen Unfähigkeit zur Veränderung gefangen. Der „feiste Wirt“ in „befleckter Hose“ wird als Symbol für den niederträchtigen, aber dennoch einflussreichen Teil der Gesellschaft dargestellt. Das „Breit grinsend“ und die Begrüßung der „vornehmeren Gäste“ verdeutlichen die Kluft zwischen den sozialen Schichten und die Oberflächlichkeit der gesellschaftlichen Hierarchie.
In der zweiten Strophe beschreibt Wagner eine fast groteske Szene, in der der „Pikkolo“ von „schmalen Frauen“ verstört verstummt. Der Pikkolo als verunsicherte, fast passiv dargestellte Figur kontrastiert mit der unberührbaren Haltung der „schmalen Frauen“, die möglicherweise als Symbol für gesellschaftliche Erwartungen oder die unerreichbare Eleganz der höheren Gesellschaft stehen. Die Geigen, die „geil“ gurren, verstärken die Sinnlichkeit und das Unbehagen der Situation. Die „bebauchten Bürger“, die „stämmig, steif und steil“ sind, erscheinen als eine Gruppe von steifen, unflexiblen Individuen, die in ihrer Trägheit und Dummheit mit einem „Glotzblick“ herumsitzen und in ihren eigenen Routineangelegenheiten verharren. Die Strophe vermittelt das Bild einer Gesellschaft, die in einem Zustand von Langeweile und Unbeweglichkeit steckt, in der das Leben zur bloßen Existenz wird.
Die dritte Strophe fährt mit der Darstellung der „Kokotten“ fort, die „lächeln – sündeseliger Segen“. Diese Frauen, die in ihrem „lächelnden“ Auftreten als eine Mischung aus Verführung und moralischer Ambivalenz erscheinen, stellen eine Provokation dar – sie stehen als Symbol für die Verführung und den Verfall von moralischen Werten in der Gesellschaft. Die „fettesten Profitvisagen“ und „protzigen Epauletten“ stellen den Wohlstand und die Eitelkeit dar, die in dieser sozialen Schicht vorherrschen, wobei die „verwelkten Weiber“ als verkörperte Schatten dieser falschen Ideale erscheinen. Diese Kontraste zwischen der Oberflächlichkeit von Reichtum und den inneren Mängeln der Gesellschaft stehen im Zentrum der Strophe und des gesamten Gedichts.
In der letzten Strophe wird der Dichter wieder als eine Figur der Passivität und der Entfremdung dargestellt. Der „Dichter döst“, was auf seine geistige Trägheit und seine Unfähigkeit hinweist, sich in der Welt zurechtzufinden oder einen klaren Standpunkt zu vertreten. Der „graue Greis“, der sich mit „Dreckjournalen“ abgibt, steht für den Verfall des intellektuellen oder künstlerischen Lebens in einer Welt, die sich mit oberflächlichen, trivialen Dingen beschäftigt. Das abrupt „zerreißende“ Kommando „Bezahlen“ und der langsame, „träge, krumme“ Gang des Dichters ins Unbekannte verstärken das Bild eines Menschen, der in einer Gesellschaft lebt, die ihn nicht versteht oder ihm keinen Platz lässt. Der Dichter, wie die anderen Figuren, wird zu einem Teil der Trägheit und Bedeutungslosigkeit dieser Welt, gefangen in einem ständigen Prozess der Reizüberflutung und der Vergeblichkeit.
Das Gedicht insgesamt ist eine scharfe, fast satirische Kritik an der Gesellschaft, die sich in ihren Normen und Oberflächlichkeiten verstrickt und in der der Dichter als Intellektueller zunehmend entfremdet wird. Es zeigt eine Welt der Oberflächlichkeit, des Verfalls und der Entfremdung, die das lyrische Ich nur passiv beobachten kann, ohne in der Lage zu sein, sich zu befreien oder etwas zu verändern.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.