Ein Ballon bewegt sich leise.
Menschenhälse strecken sich.
Tramways stürzen aus dem Gleise.
Droschkengäule töten sich.
Auf den Dächern tanzen Greise.
Jungfraun platzen männertoll.
Ein Ballon bewegt sich leise,
Lächelnd und sehr würdevoll.
Ein Ballon bewegt sich leise.
Menschenhälse strecken sich.
Tramways stürzen aus dem Gleise.
Droschkengäule töten sich.
Auf den Dächern tanzen Greise.
Jungfraun platzen männertoll.
Ein Ballon bewegt sich leise,
Lächelnd und sehr würdevoll.
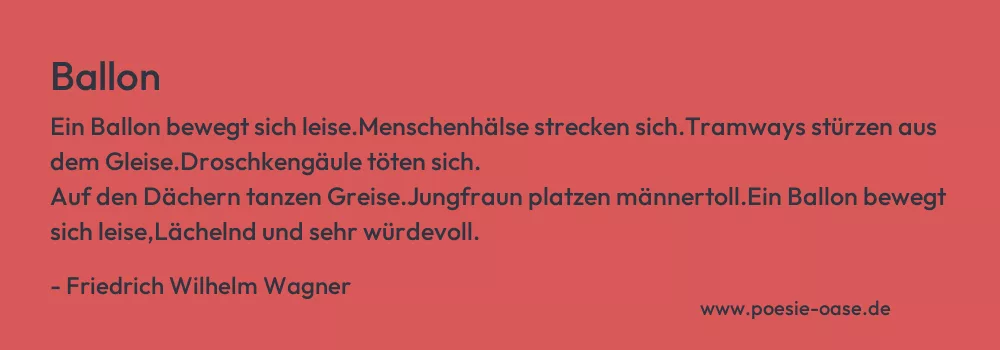
Das Gedicht „Ballon“ von Friedrich Wilhelm Wagner konfrontiert den Leser mit einem drastischen Kontrast zwischen äußerer Ruhe und innerem Chaos. Im Mittelpunkt steht der scheinbar harmlose Flug eines Ballons, der „leise“ und „lächelnd und sehr würdevoll“ durch den Himmel gleitet. Diese Bewegung wird jedoch begleitet von einer eruptiven, fast apokalyptischen Reaktion der Welt darunter.
Die Sprache des Gedichts ist knapp, rhythmisch eindringlich und von surrealer Bildhaftigkeit. In den nur acht Versen türmen sich extreme Reaktionen auf: Menschen geraten außer Kontrolle, Fahrzeuge entgleisen, Tiere sterben, alte Männer tanzen auf Dächern, und Jungfrauen „platzen männertoll“. Diese grotesken Übertreibungen steigern sich ins Absurde und rufen ein Bild kollektiver Hysterie hervor, das der Stille des Ballons entgegensteht.
Der Ballon wird zum Symbol für eine überhöhte, distanzierte Erscheinung – möglicherweise eine Allegorie auf etwas Neues, Fremdes oder Unerreichbares, das die Masse in Ekstase oder Wahnsinn treibt. Trotz der Katastrophen, die seine Anwesenheit auslöst, bleibt er unbewegt und würdevoll. Diese Gegenüberstellung weckt Assoziationen an soziale oder politische Phänomene: etwa die Vergötterung von Autoritäten, technologische Fortschritte oder Ideale, die in ihrer Abgehobenheit destruktive Wirkungen auf die Gesellschaft entfalten.
Wagners Gedicht ist ein Beispiel für expressionistische Dichtung, in der Übertreibung, Groteske und Bildsprache zentrale Stilmittel sind. Es hält der Wirklichkeit einen Zerrspiegel vor und zeigt die Spannungen zwischen individueller Wahrnehmung und kollektiver Reaktion, zwischen Schönheit und Zerstörung, zwischen Würde und Wahnsinn.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.