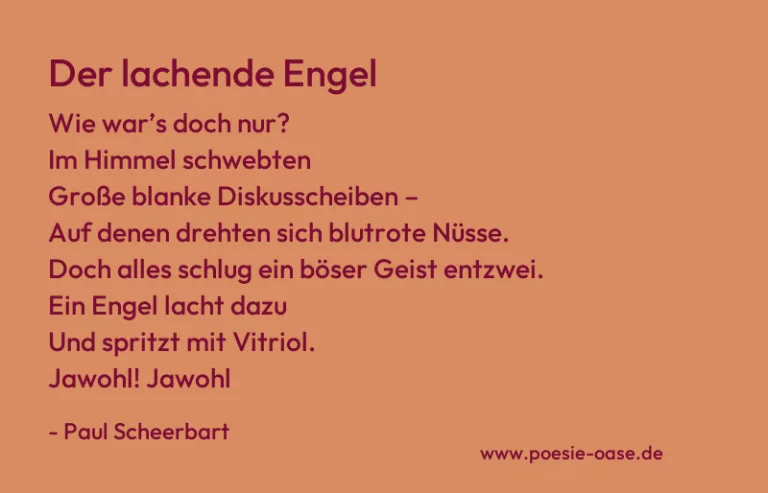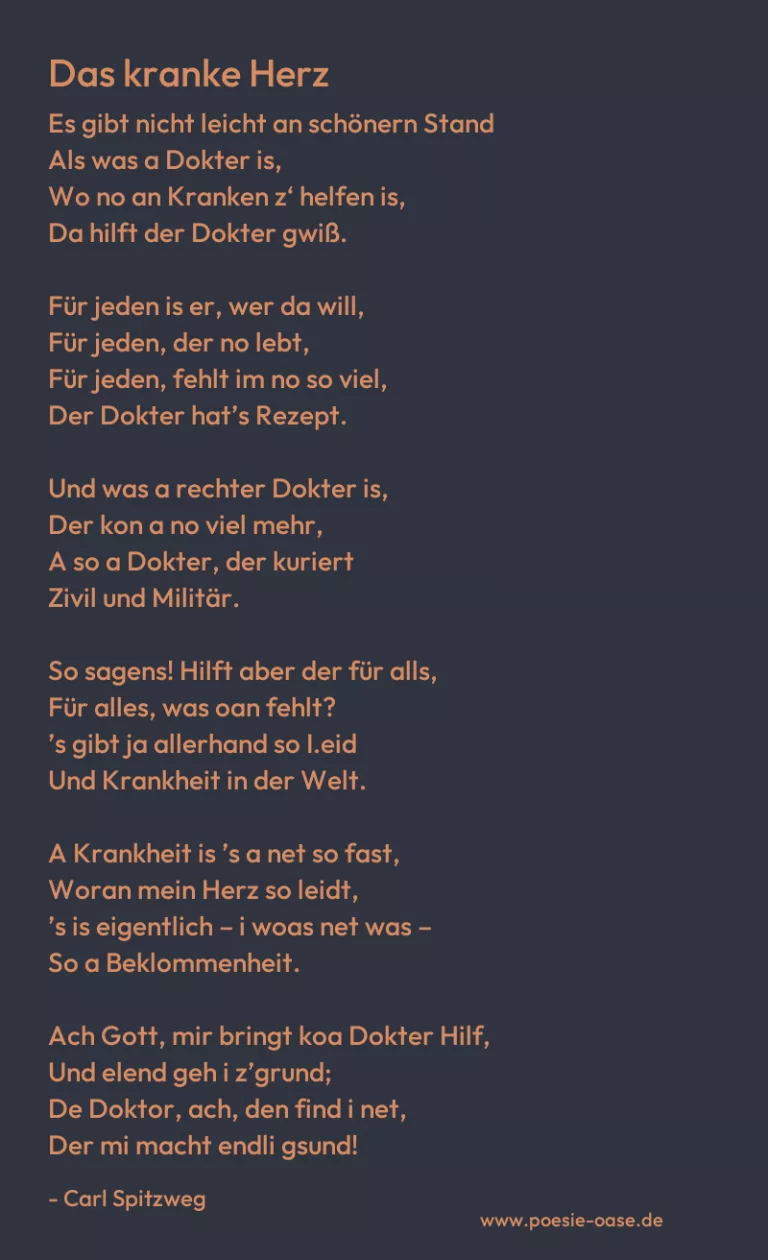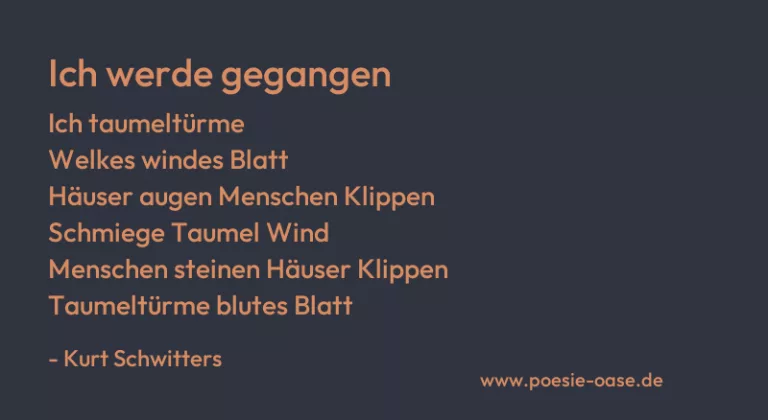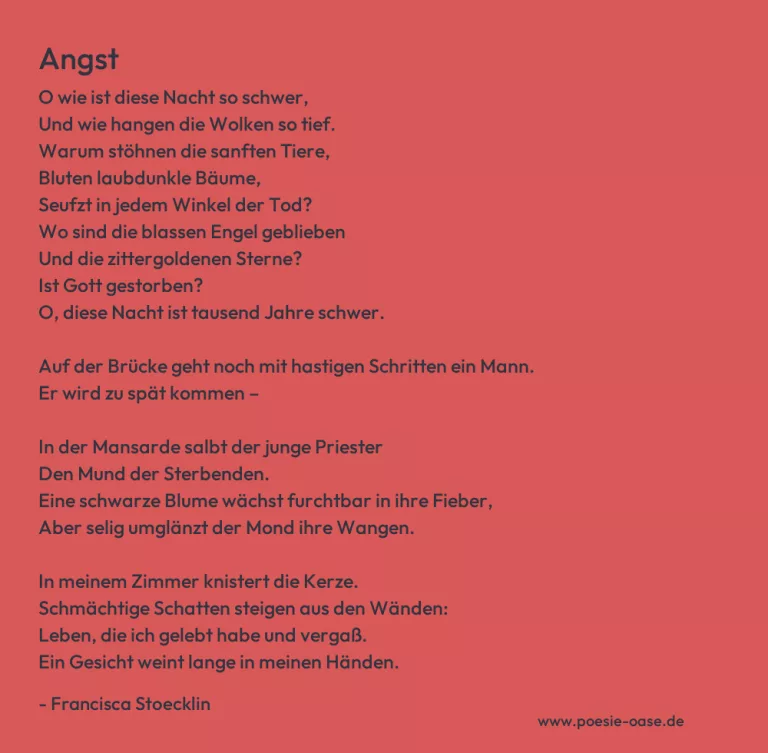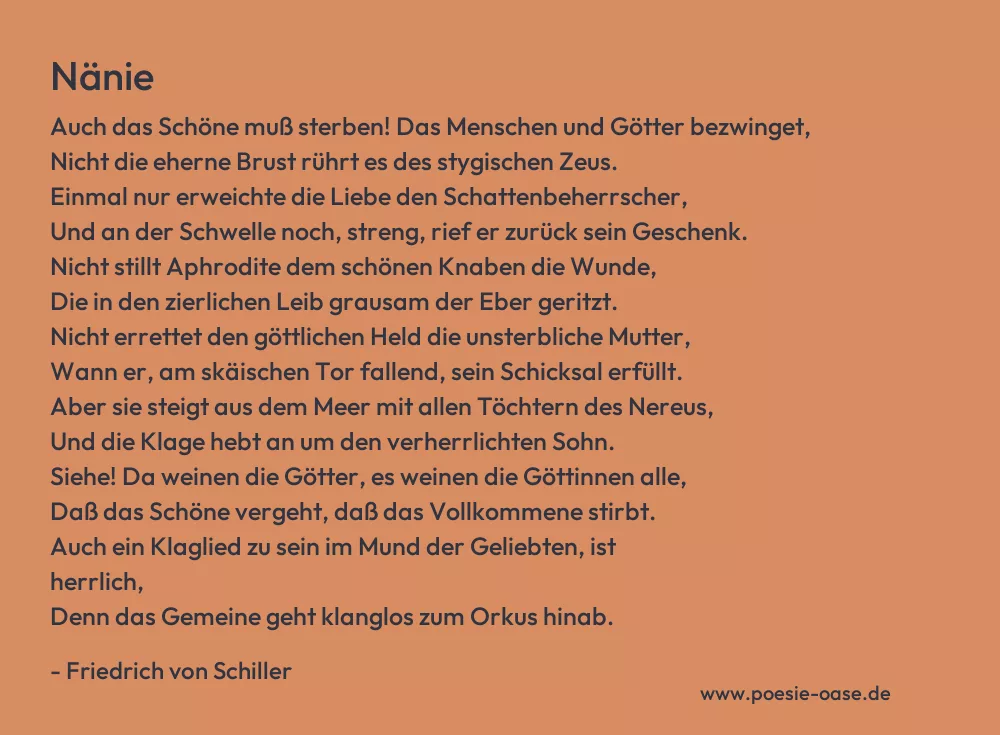Nänie
Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget,
Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt.
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt.
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.
Siehe! Da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt.
Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten, ist
herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
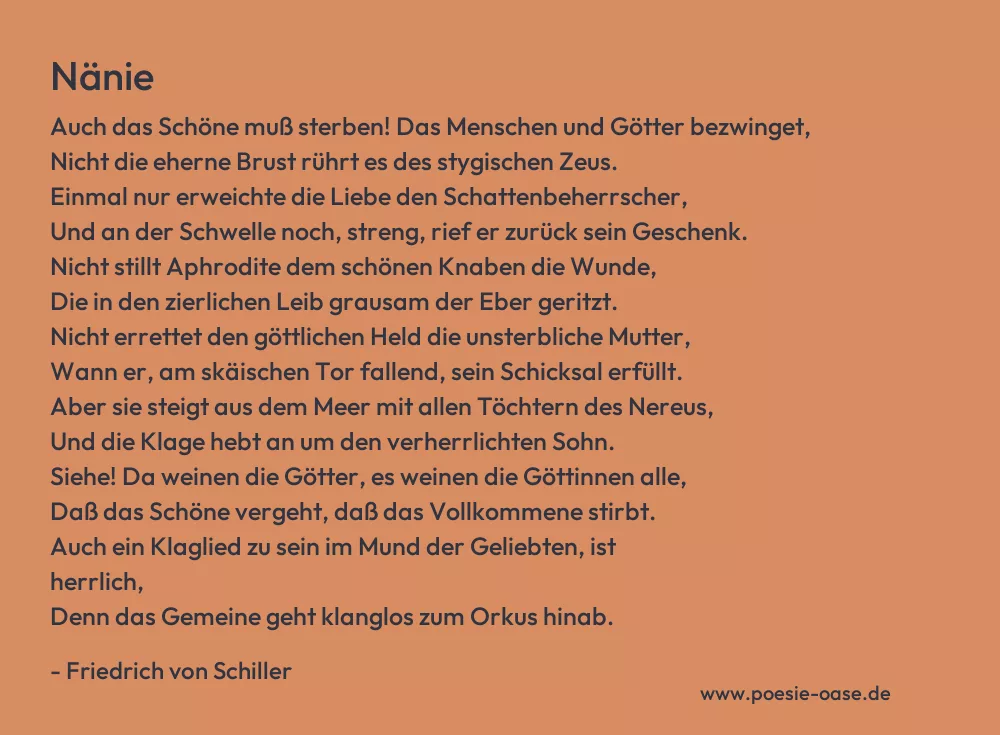
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nänie“ von Friedrich von Schiller behandelt das Thema der Vergänglichkeit des Schönen und Vollkommenen und bringt das traurige, aber zugleich ehrwürdige Motiv des Todes und der Klage in eine universelle Perspektive. Es verweist auf die Unausweichlichkeit des Verfalls, der selbst vor den Göttern und Helden nicht Halt macht.
Zu Beginn wird der Tod als eine unumgängliche Macht dargestellt, die nicht einmal die Götter oder die unsterblichen Wesen verschont. Die Referenzen zu Mythen – wie der Rückruf von Zeus’ Geschenk an seine Liebe oder die unaufhaltsame Wunde des schönen Knaben durch den Eber – verdeutlichen, dass selbst das Schöne und Perfekte der Natur des Todes unterworfen ist. In diesen Versen wird der Verlust nicht nur als physisches Ende, sondern als eine universelle Wahrheit dargestellt, die von den höchsten Wesen des Olymp nicht ignoriert werden kann.
Besonders prägend ist die Darstellung der Mutter des göttlichen Helden, die, trotz ihrer Unsterblichkeit, nicht in der Lage ist, ihren Sohn vor dem Tod zu retten. Der Tod des Helden am „skäischen Tor“ ist eine allegorische Darstellung für den unausweichlichen Fall des Schönen, auch wenn es von göttlicher Mutterliebe begleitet ist. Schiller stellt damit die Tragik des Lebens dar, dass selbst die stärksten Bande wie die zwischen Mutter und Kind den Tod nicht abwenden können.
Die Darstellung der Klage der Göttinnen und Götter, die „alle weinen“, hebt die Bedeutung des Schönen hervor, das auch in der Vergänglichkeit verherrlicht wird. Diese Trauer ist nicht nur eine persönliche, sondern eine allgemeine Trauer über den Verlust des Vollkommenen, das irgendwann zu Staub zerfällt. Doch Schiller lässt den Verlust nicht bedeutungslos erscheinen. Der letzte Vers bringt die Schönheit des Klageliedes zum Ausdruck, das von den Geliebten gesungen wird, als ein „herrliches“ Zeichen des Gedenkens. Auch wenn das Schöne vergeht, bleibt es durch das Erinnern und das Klagelied erhalten, während das „Gemeine“ ohne Erinnerung und Trauer in Vergessenheit gerät.
Insgesamt wird das Gedicht zu einer Reflexion über die Vergänglichkeit und die Bedeutung des Schönen. Schiller zeigt, dass der Tod des Schönen, sei es im Leben oder im Tod, unweigerlich eine edle und ehrwürdige Klage hervorruft. Es ist ein Lobgesang auf das, was vergangen ist, und ein Hinweis darauf, dass wahre Schönheit und Vollkommenheit nicht nur im Leben, sondern auch im Gedenken weiterleben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.