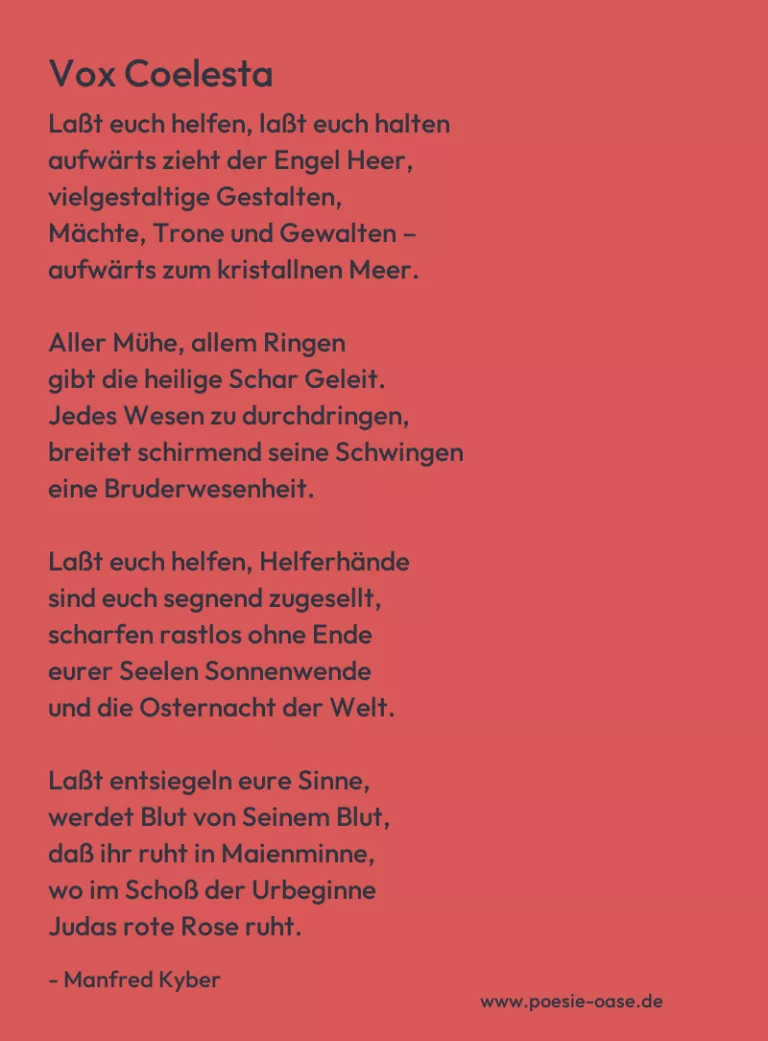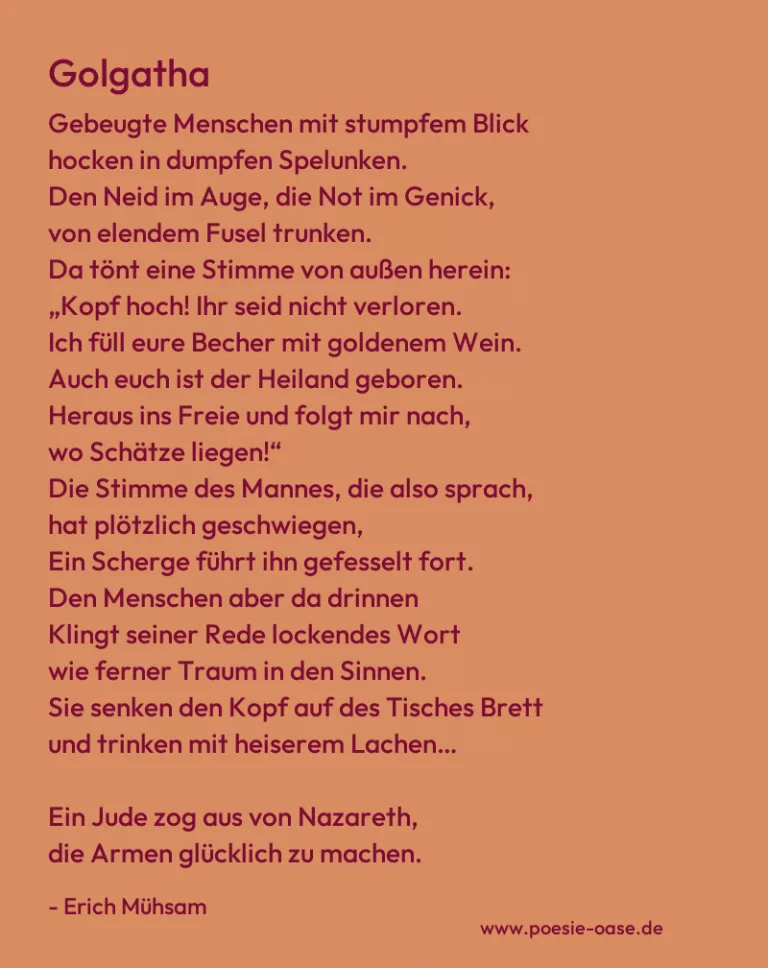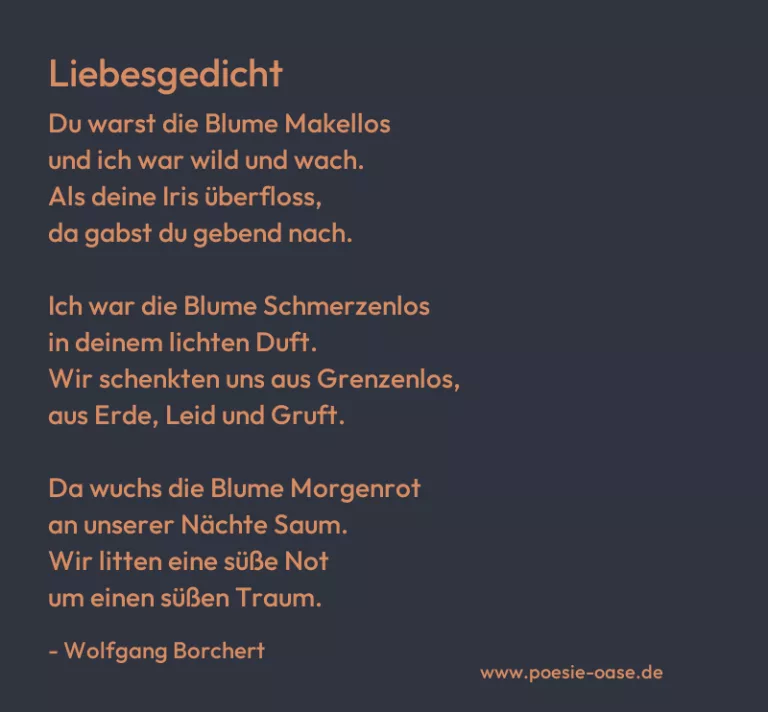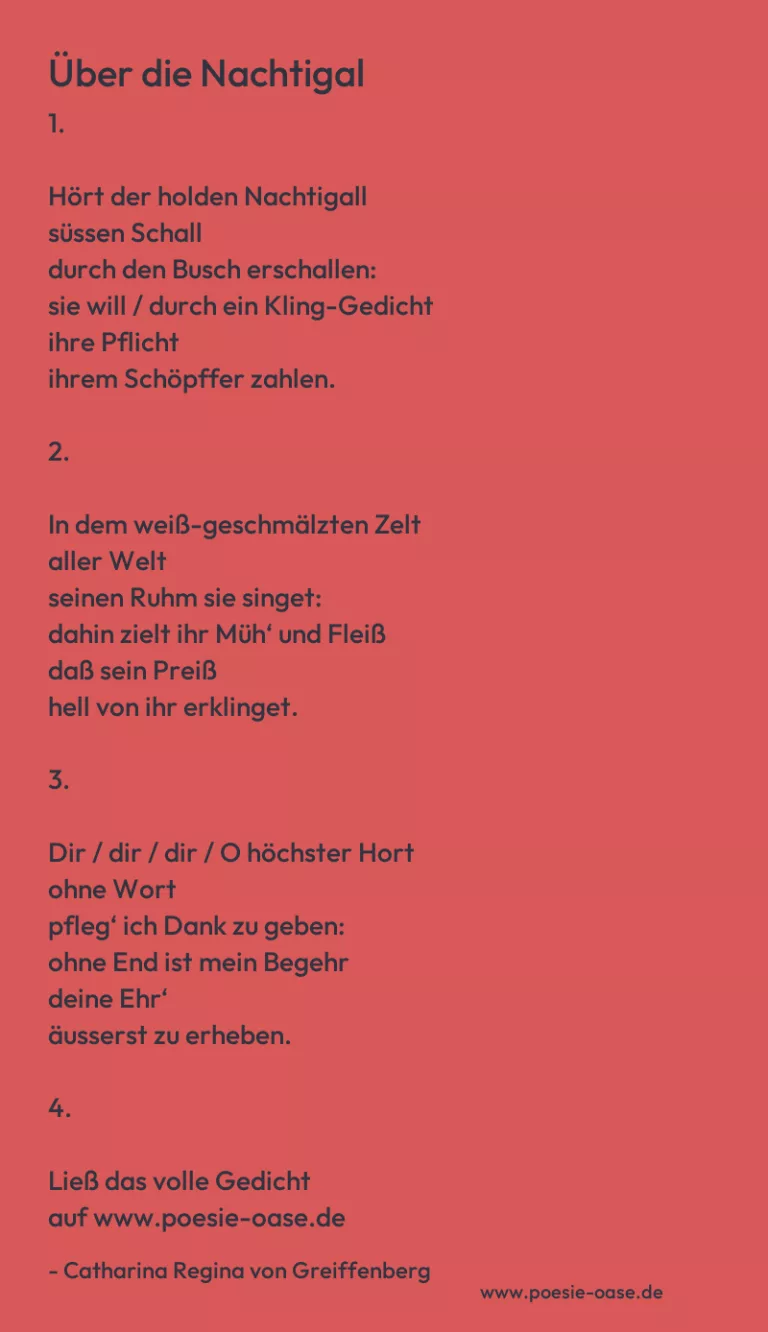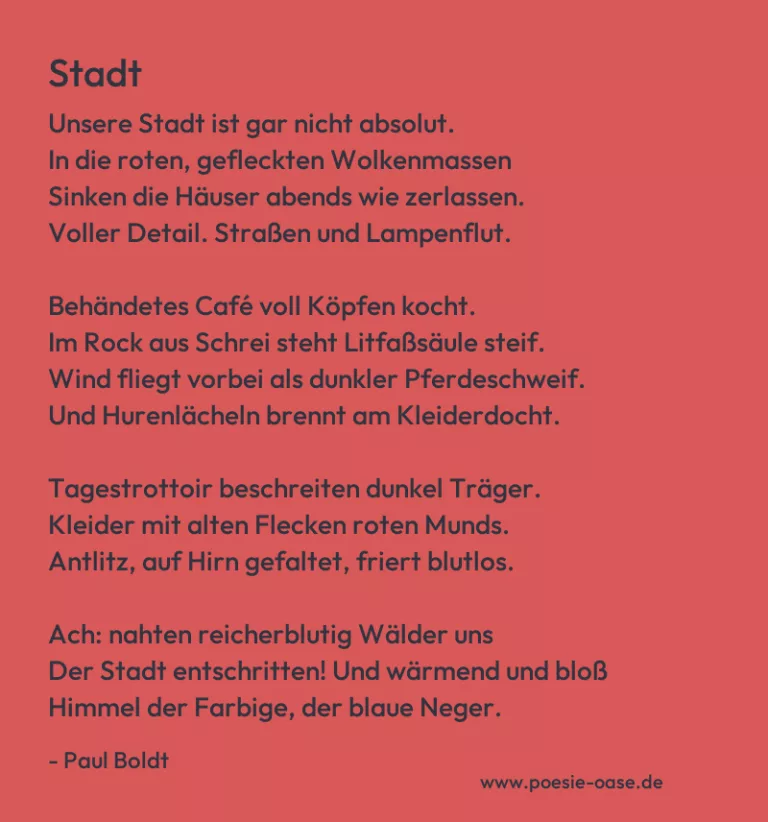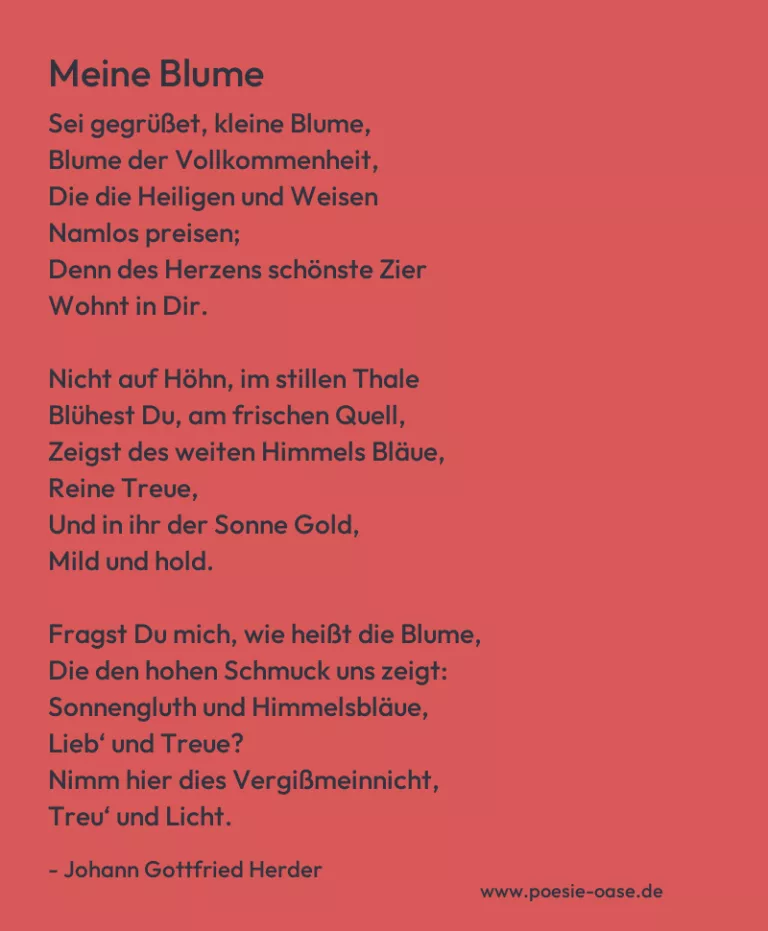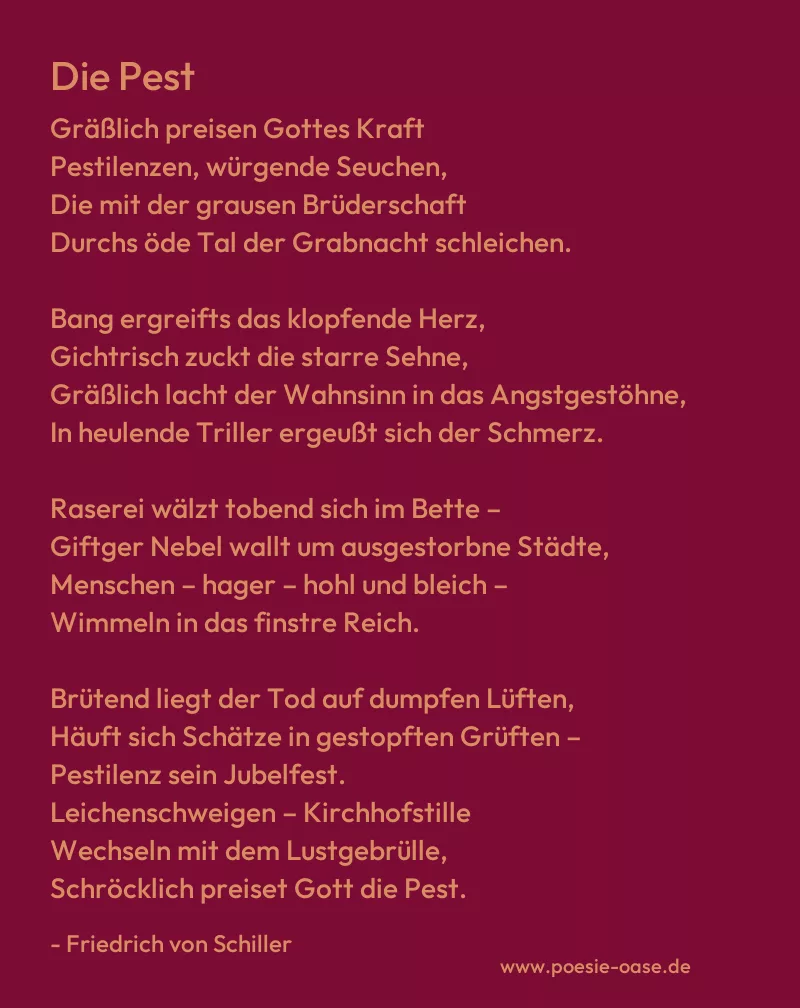Die Pest
Gräßlich preisen Gottes Kraft
Pestilenzen, würgende Seuchen,
Die mit der grausen Brüderschaft
Durchs öde Tal der Grabnacht schleichen.
Bang ergreifts das klopfende Herz,
Gichtrisch zuckt die starre Sehne,
Gräßlich lacht der Wahnsinn in das Angstgestöhne,
In heulende Triller ergeußt sich der Schmerz.
Raserei wälzt tobend sich im Bette –
Giftger Nebel wallt um ausgestorbne Städte,
Menschen – hager – hohl und bleich –
Wimmeln in das finstre Reich.
Brütend liegt der Tod auf dumpfen Lüften,
Häuft sich Schätze in gestopften Grüften –
Pestilenz sein Jubelfest.
Leichenschweigen – Kirchhofstille
Wechseln mit dem Lustgebrülle,
Schröcklich preiset Gott die Pest.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
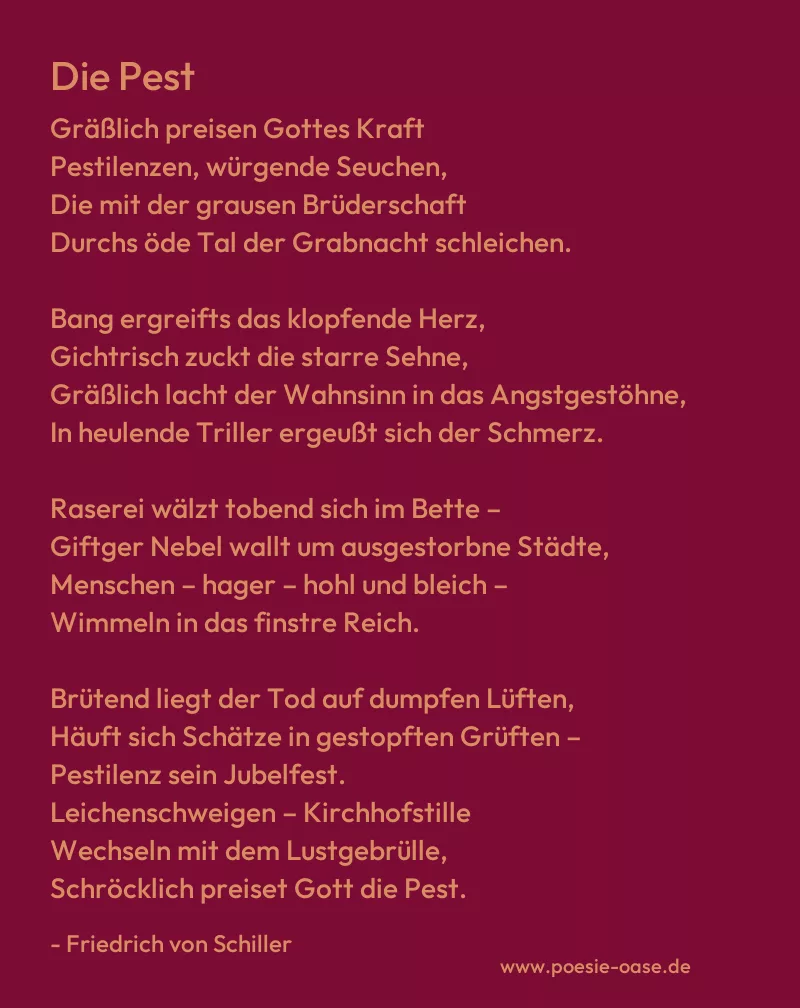
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Pest“ von Friedrich von Schiller beschreibt auf eindrucksvolle Weise die verheerende und alles durchdringende Macht der Krankheit, die das Leben der Menschen mit Angst und Tod überschattet. Die Pest wird nicht nur als eine physische Krankheit dargestellt, sondern als eine metaphysische und zerstörerische Kraft, die das menschliche Leben und die Natur in ihrer ganzen Grausamkeit heimsucht.
Zu Beginn wird die Pest als eine grausame und allmächtige Kraft eingeführt, die „durchs öde Tal der Grabnacht schleicht“. Diese Darstellung verleiht der Krankheit fast schon eine menschenähnliche, schleichende Präsenz, die sich mit der „grausen Brüderschaft“ – den anderen schlimmen Erscheinungen wie Tod und Leid – in die Welt begibt. Das Bild des „öden Tals der Grabnacht“ verstärkt den Eindruck von einem unaufhaltsamen Vorwärtsdrängen des Unheils, das das Leben in seine kalte Umarmung zieht.
Die körperlichen und emotionalen Auswirkungen der Pest werden detailliert beschrieben: Das „klopfende Herz“ und das „zuckende“ Nervensystem spiegeln das Chaos und die Verwirrung wider, die die Menschen in einem Zustand der Panik und des Schreckens versetzen. Der „Wahnsinn“ und das „Angstgestöhne“ vermischen sich zu einem bedrohlichen Geräuschbild, das die Verzweiflung und die Hilflosigkeit der Betroffenen vermittelt. In dieser Szene wird der menschliche Körper als zerbrechlich und der Angst ausgeliefert dargestellt, was die Entmenschlichung des Individuums unter der Gewalt der Pest symbolisiert.
Das Gedicht geht dann weiter, um die sozialen und physischen Veränderungen zu zeigen, die mit der Ausbreitung der Pest einhergehen. Städte werden „ausgestorben“ und Menschen erscheinen als „hager“, „hohl und bleich“. Die „tobende Raserei“ und der „giftige Nebel“ bilden ein Bild der Zerstörung, in dem die Welt von Krankheit und Tod durchdrungen ist. Es entsteht der Eindruck einer Welt, in der die Normen der Gesellschaft und des Lebens selbst zusammenbrechen und die Menschen in einem Zustand völliger Verwirrung und Ohnmacht zurückgelassen werden.
Am Ende des Gedichts wird die Pest als eine Art „Jubelfest“ gefeiert, wobei der Tod selbst als ein „Lustgebrüll“ dargestellt wird. Dieser dramatische, fast groteske Höhepunkt verdeutlicht den völligen Verlust der moralischen und spirituellen Ordnung. Die Verlagerung von der Stille des „Kirchhofs“ zur „Lust“ des „Lustgebrülls“ zeigt, wie die Pest das Leben in einen Zustand der Verdrehung und Entartung verwandelt hat. Schiller malt hier ein Bild des Chaos und der Zerstörung, das den Leser sowohl erschreckt als auch nachdenklich stimmt über die Fragilität des menschlichen Lebens und die unaufhaltsame Macht des Todes.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.