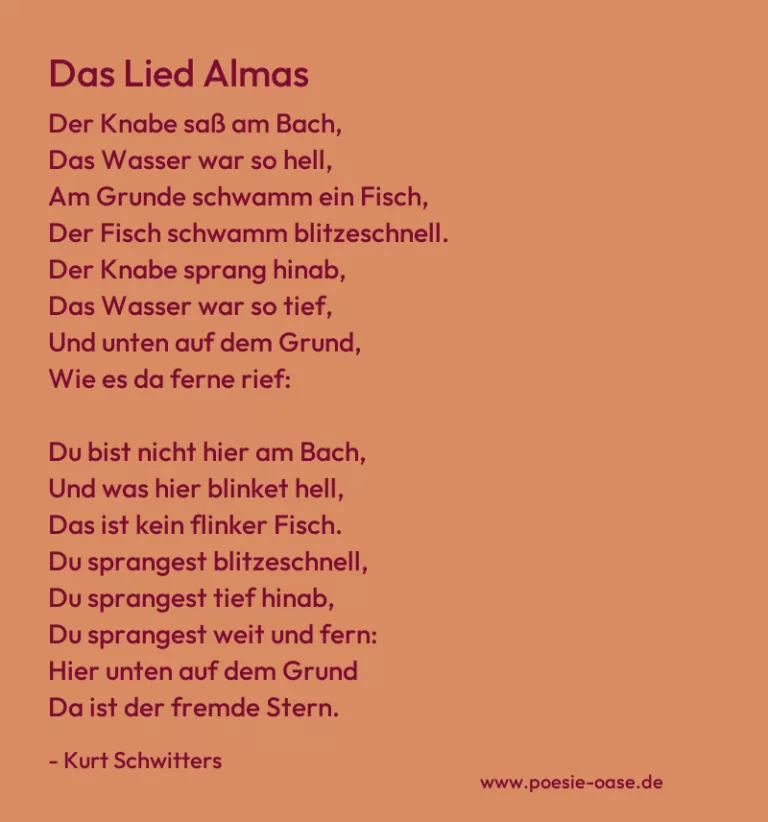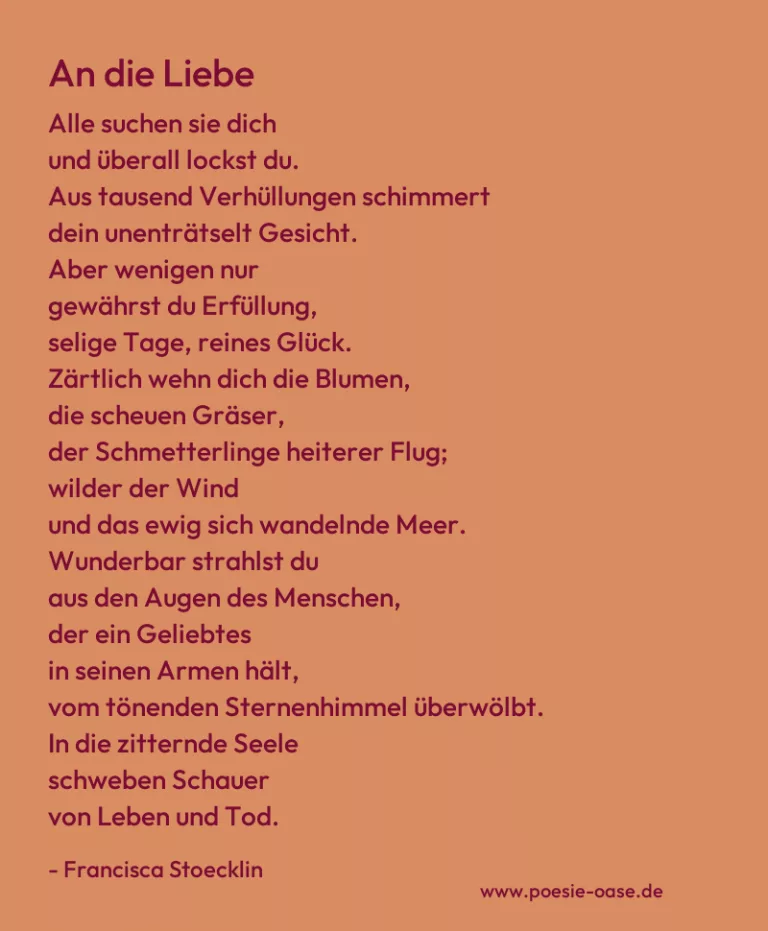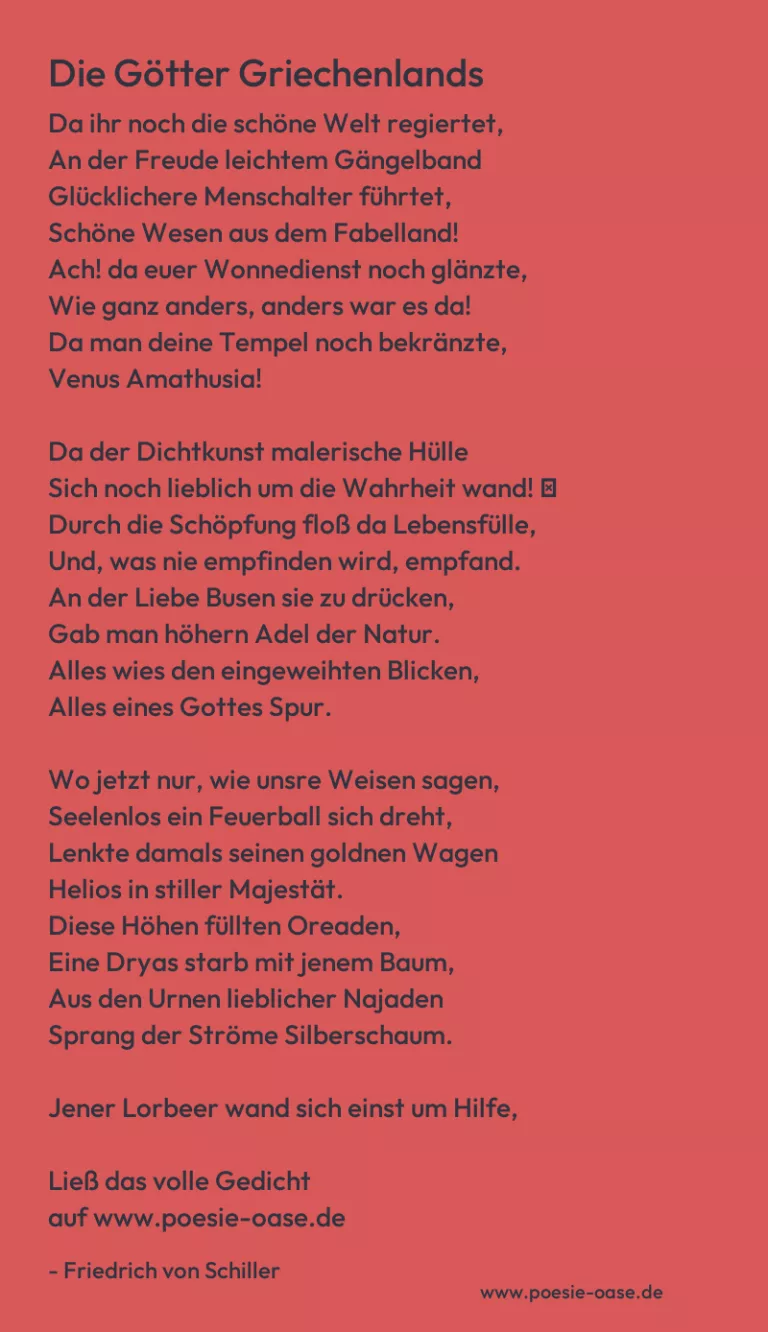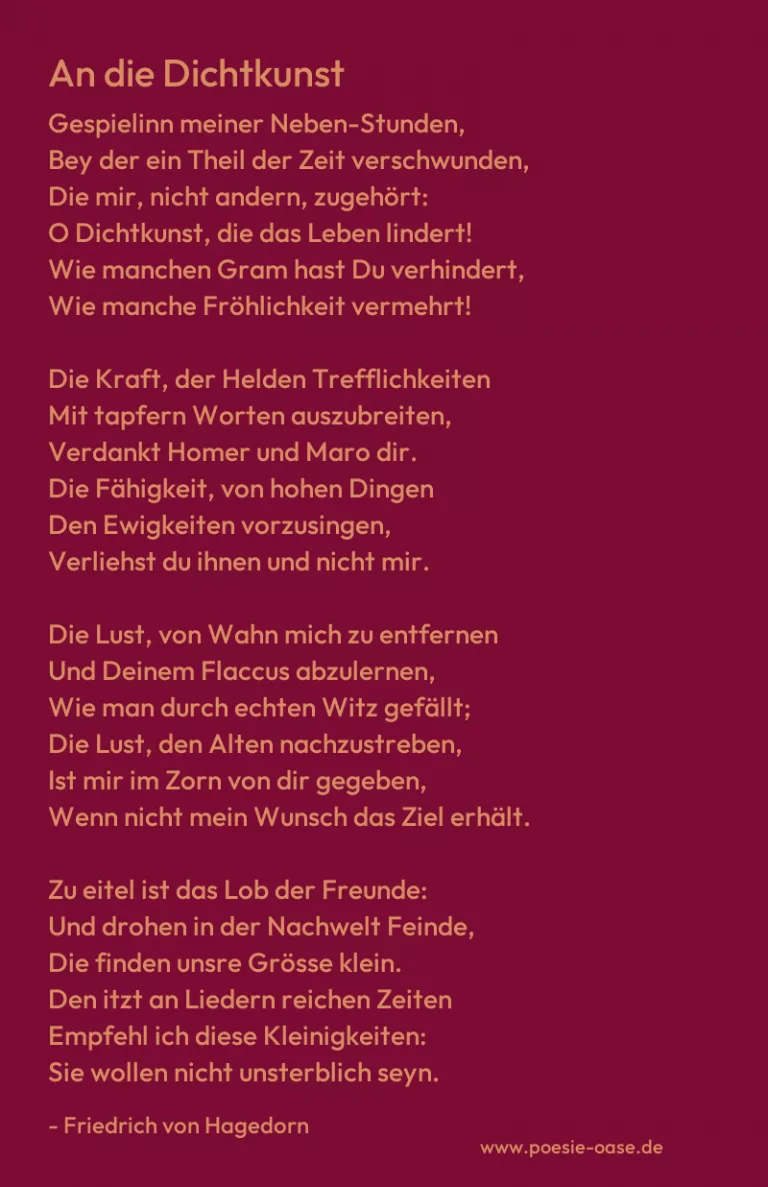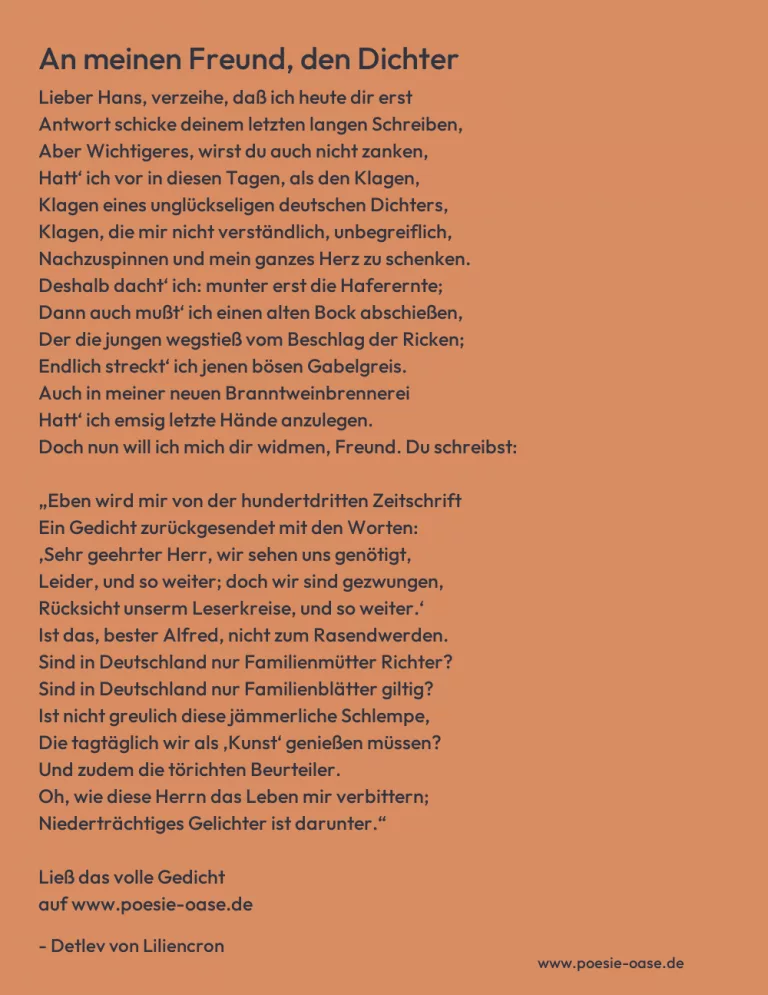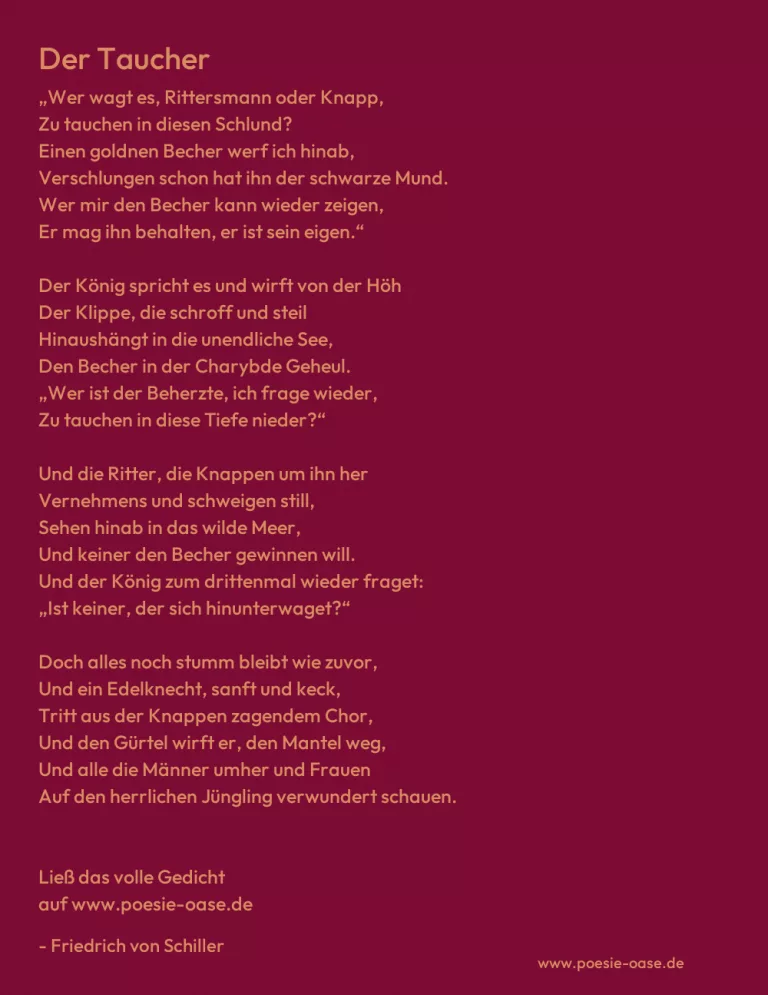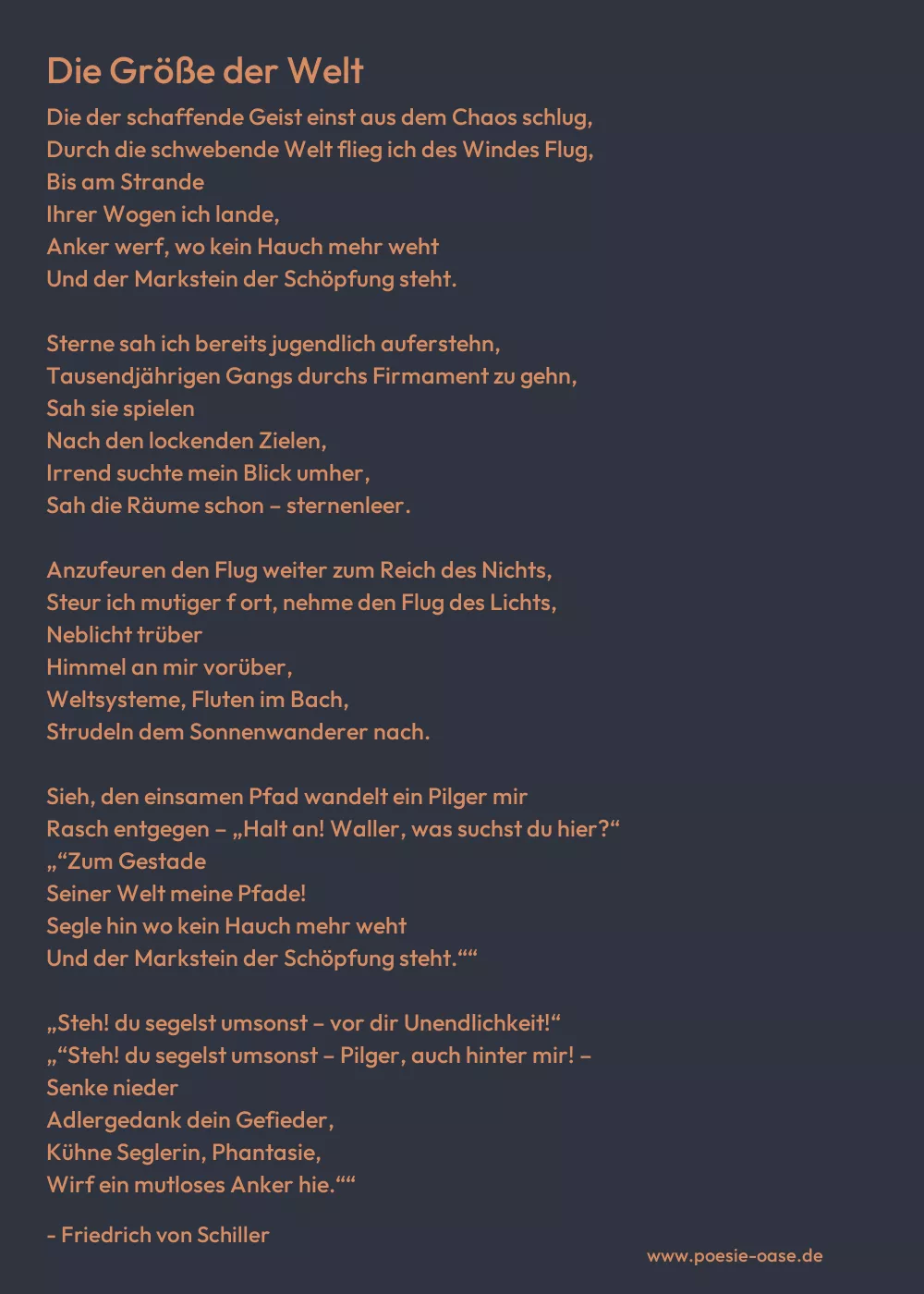Gedanken, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Himmel & Wolken, Kindheit & Jugend, Leichtigkeit, Metaphysik & Traumwelten, Natur, Universum, Weihnachten, Weisheiten, Zerstörung
Die Größe der Welt
Die der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug,
Durch die schwebende Welt flieg ich des Windes Flug,
Bis am Strande
Ihrer Wogen ich lande,
Anker werf, wo kein Hauch mehr weht
Und der Markstein der Schöpfung steht.
Sterne sah ich bereits jugendlich auferstehn,
Tausendjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn,
Sah sie spielen
Nach den lockenden Zielen,
Irrend suchte mein Blick umher,
Sah die Räume schon – sternenleer.
Anzufeuren den Flug weiter zum Reich des Nichts,
Steur ich mutiger f ort, nehme den Flug des Lichts,
Neblicht trüber
Himmel an mir vorüber,
Weltsysteme, Fluten im Bach,
Strudeln dem Sonnenwanderer nach.
Sieh, den einsamen Pfad wandelt ein Pilger mir
Rasch entgegen – „Halt an! Waller, was suchst du hier?“
„“Zum Gestade
Seiner Welt meine Pfade!
Segle hin wo kein Hauch mehr weht
Und der Markstein der Schöpfung steht.““
„Steh! du segelst umsonst – vor dir Unendlichkeit!“
„“Steh! du segelst umsonst – Pilger, auch hinter mir! –
Senke nieder
Adlergedank dein Gefieder,
Kühne Seglerin, Phantasie,
Wirf ein mutloses Anker hie.““
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
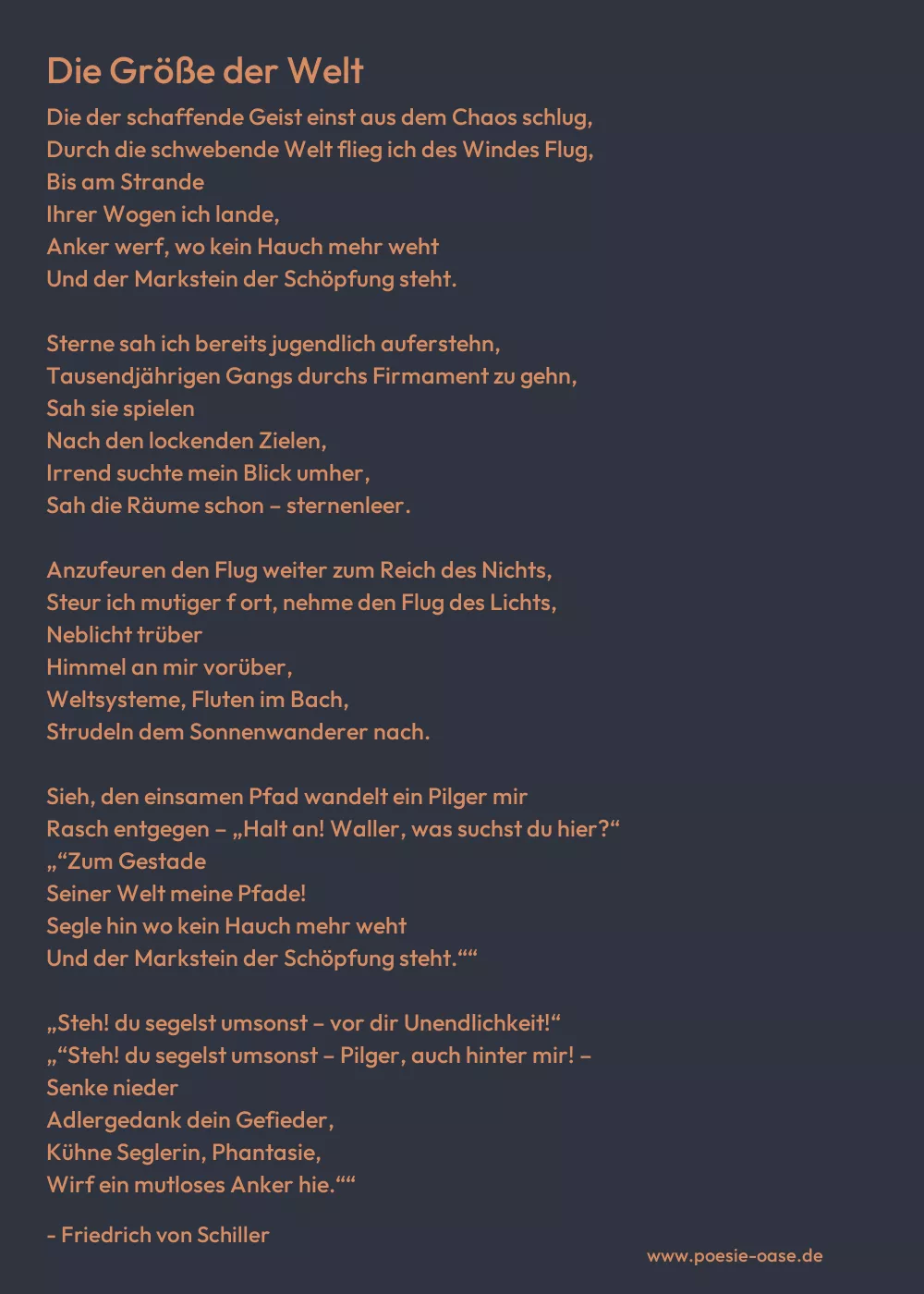
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Größe der Welt“ von Friedrich von Schiller ist eine philosophische Reise durch das Universum, die den unermüdlichen Drang des menschlichen Geistes widerspiegelt, das Unendliche zu erkunden. Es beginnt mit einer Vorstellung des schöpferischen Geistes, der das Chaos in die Weltordnung führt, und setzt die Reise des lyrischen Ichs fort, das von den unendlichen Weiten des Universums fasziniert ist.
Zu Beginn des Gedichts wird die Schöpfung als ein Prozess dargestellt, bei dem der schöpferische Geist das Chaos bezwingt und eine Weltordnung schafft. Der Sprecher begibt sich auf eine Reise durch das Universum, fliegt „des Windes Flug“ und landet an einem Ort, der symbolisch als „Markstein der Schöpfung“ bezeichnet wird. Dies könnte als der Moment der Erkenntnis verstanden werden, dass es einen Punkt gibt, an dem die schöpferische Ordnung ihren Ursprung hat, jedoch nicht greifbar ist. Der „Strand“ ohne „Hauch mehr“ vermittelt eine Ruhe, die zugleich von der Erhabenheit und den Mysterien der Schöpfung spricht.
Der zweite Teil des Gedichts nimmt den Leser mit auf eine kosmische Reise, auf der der Sprecher die Sterne beobachtet, die „jugendlich auferstehn“ und durch das Firmament ziehen. Doch trotz der Schönheit und Pracht des Himmels wird das lyrische Ich zunehmend von einer Leere umgeben, die in der „sternleeren“ Weite des Alls gipfelt. Die Sterne, die wie „spielende“ Himmelskörper wirken, sind schließlich ein Symbol für die Flüchtigkeit und die Unsicherheit der menschlichen Existenz im Angesicht des Unendlichen. Das Bild des „Reich des Nichts“ und des „Nebels“ verstärkt das Gefühl der Unbestimmtheit und der Unendlichkeit, die über den menschlichen Verstand hinausgeht.
In der Begegnung mit einem Pilger, der dem lyrischen Ich entgegenkommt, erreicht das Gedicht eine tiefere philosophische Dimension. Der Pilger warnt den Reisenden, dass er „umsonst“ segle, und stellt die Idee einer unendlichen, unerreichbaren Weite vor. Der Dialog zwischen den beiden Figuren könnte als ein metaphorischer Ausdruck für den Dialog zwischen menschlichem Streben und den unermesslichen Weiten des Wissens und des Universums verstanden werden. Das Bild des „Adlergedankens“ und des „mutlosen Ankers“ deutet auf den Konflikt hin, den der menschliche Geist zwischen seinem Streben nach Erkenntnis und der Erkenntnis seiner eigenen Begrenztheit empfindet.
Am Ende des Gedichts bleibt die Reise des lyrischen Ichs unvollständig und wird in einem Moment der Demut und des Staunens unterbrochen. Schiller thematisiert hier die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und das Streben nach Unendlichkeit, das stets von der Erkenntnis begleitet wird, dass der wahre „Markstein der Schöpfung“ außerhalb der Reichweite des menschlichen Wissens liegt. Die unaufhörliche Suche nach Sinn und Wissen führt letztlich zu der Einsicht, dass nicht alles im Universum von menschlicher Hand erfasst oder verstanden werden kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.