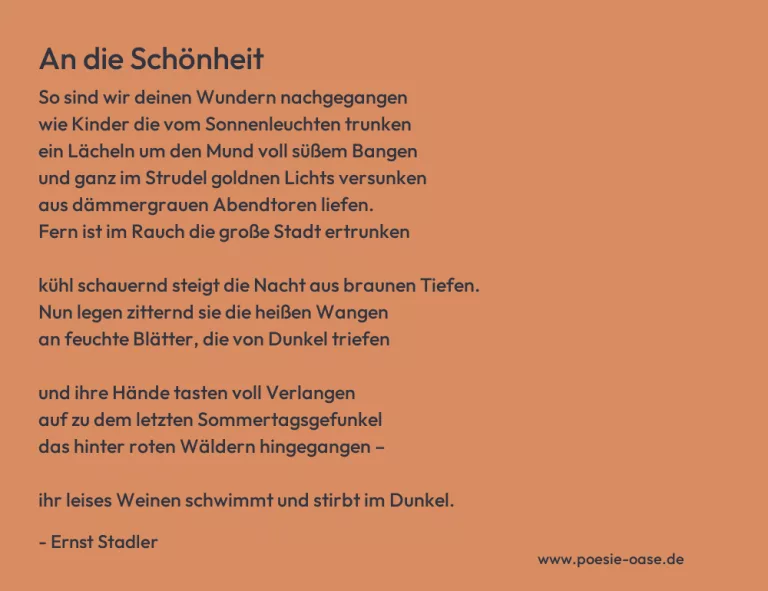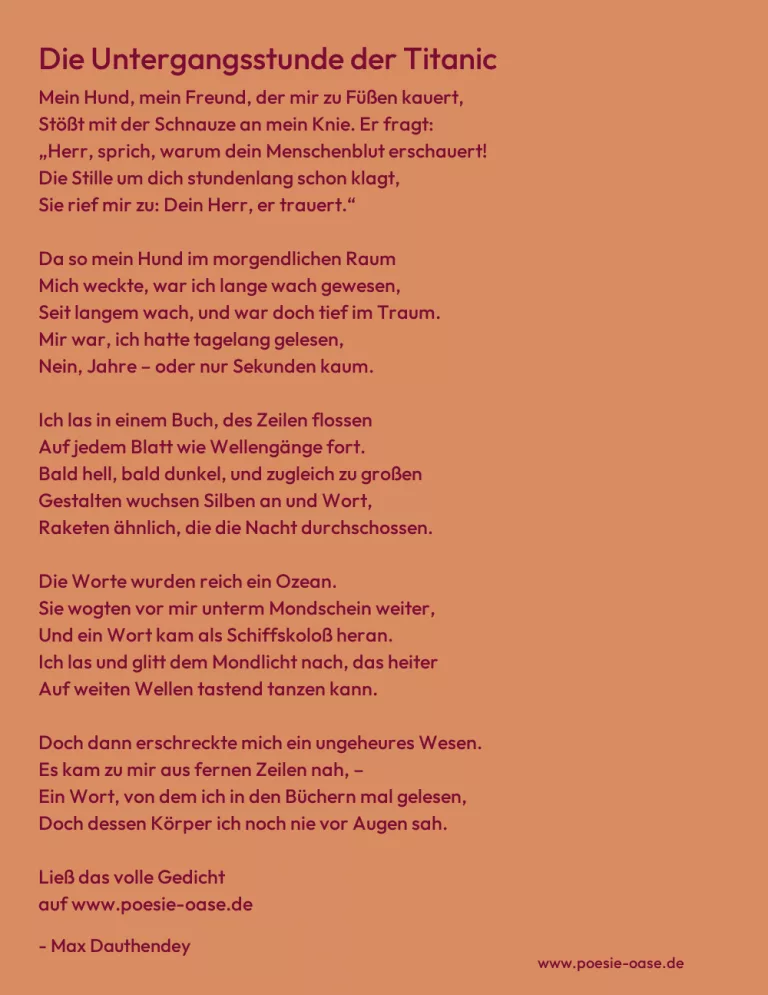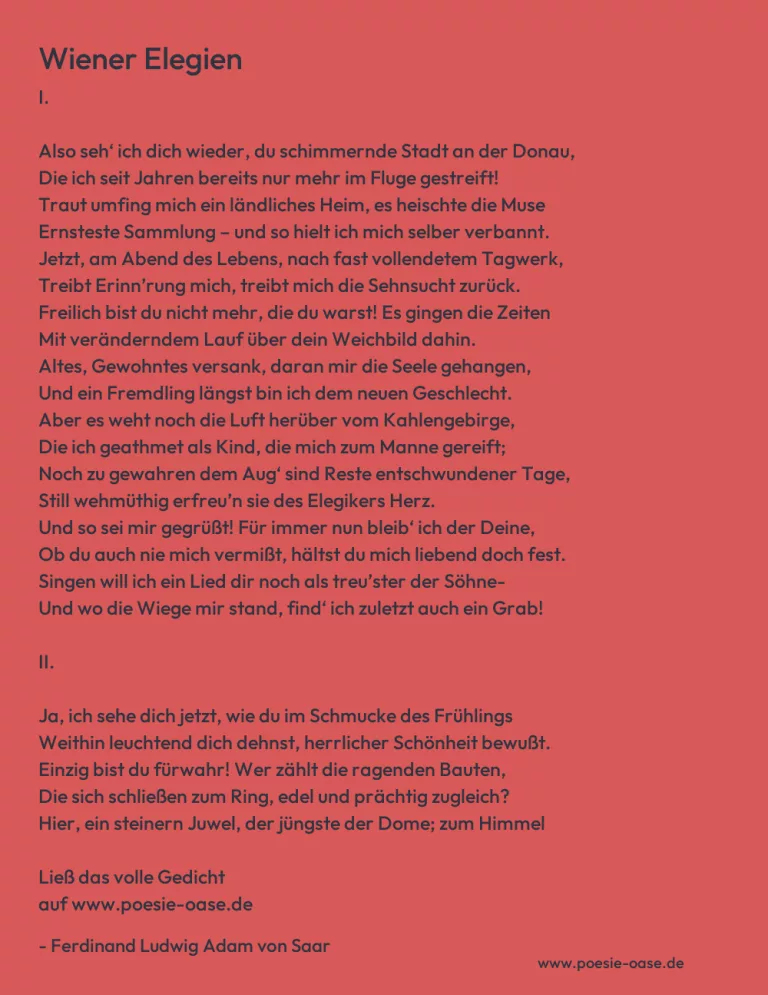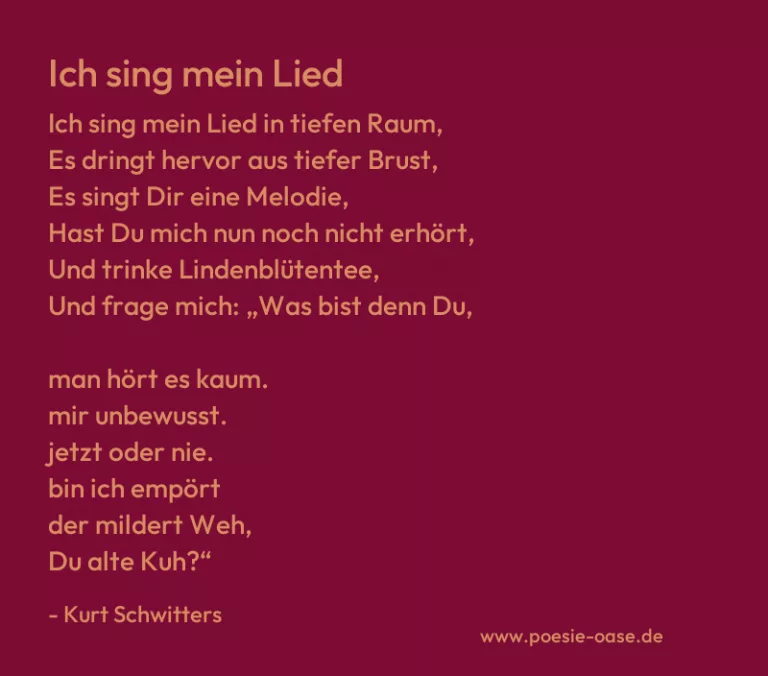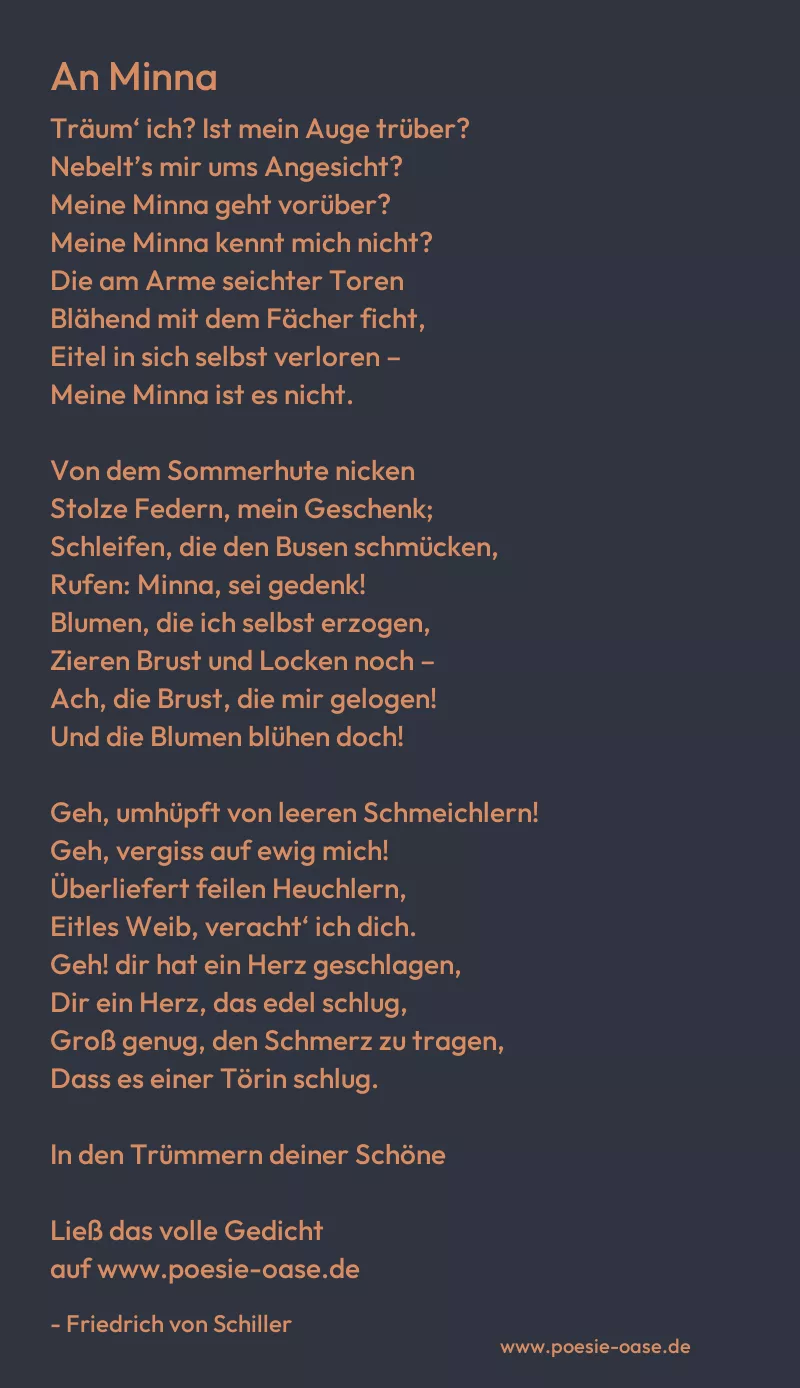Träum‘ ich? Ist mein Auge trüber?
Nebelt’s mir ums Angesicht?
Meine Minna geht vorüber?
Meine Minna kennt mich nicht?
Die am Arme seichter Toren
Blähend mit dem Fächer ficht,
Eitel in sich selbst verloren –
Meine Minna ist es nicht.
Von dem Sommerhute nicken
Stolze Federn, mein Geschenk;
Schleifen, die den Busen schmücken,
Rufen: Minna, sei gedenk!
Blumen, die ich selbst erzogen,
Zieren Brust und Locken noch –
Ach, die Brust, die mir gelogen!
Und die Blumen blühen doch!
Geh, umhüpft von leeren Schmeichlern!
Geh, vergiss auf ewig mich!
Überliefert feilen Heuchlern,
Eitles Weib, veracht‘ ich dich.
Geh! dir hat ein Herz geschlagen,
Dir ein Herz, das edel schlug,
Groß genug, den Schmerz zu tragen,
Dass es einer Törin schlug.
In den Trümmern deiner Schöne
Seh‘ ich dich verlassen stehn,
Weinend in die Blumenszene
Deines Mai’s zurücke sehn.
Schwalben, die im Lenze minnen,
Fliehen, wenn der Nordsturm weht;
Buhler scheucht dein Herbst von hinnen,
Einen Freund hast du verschmäht.
Die mit heißem Liebesgeize
Deinem Kuss entgegenflohn,
Zischen dem erloschnen Reize,
Lachen deinem Winter Hohn.
Ha! wie will ich dann dich höhnen!
Höhnen? Gott bewahre mich!
Weinen will ich bittre Tränen,
Weinen, Minna, über dich!