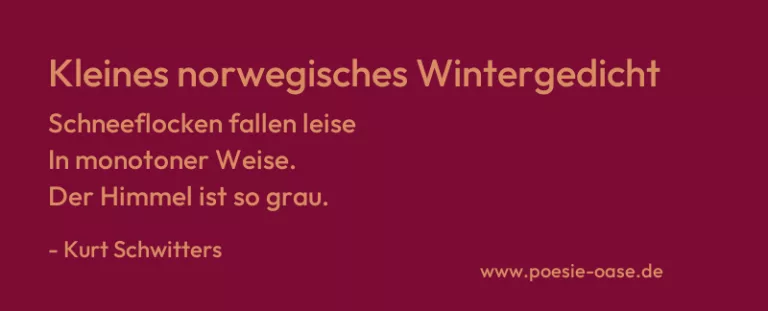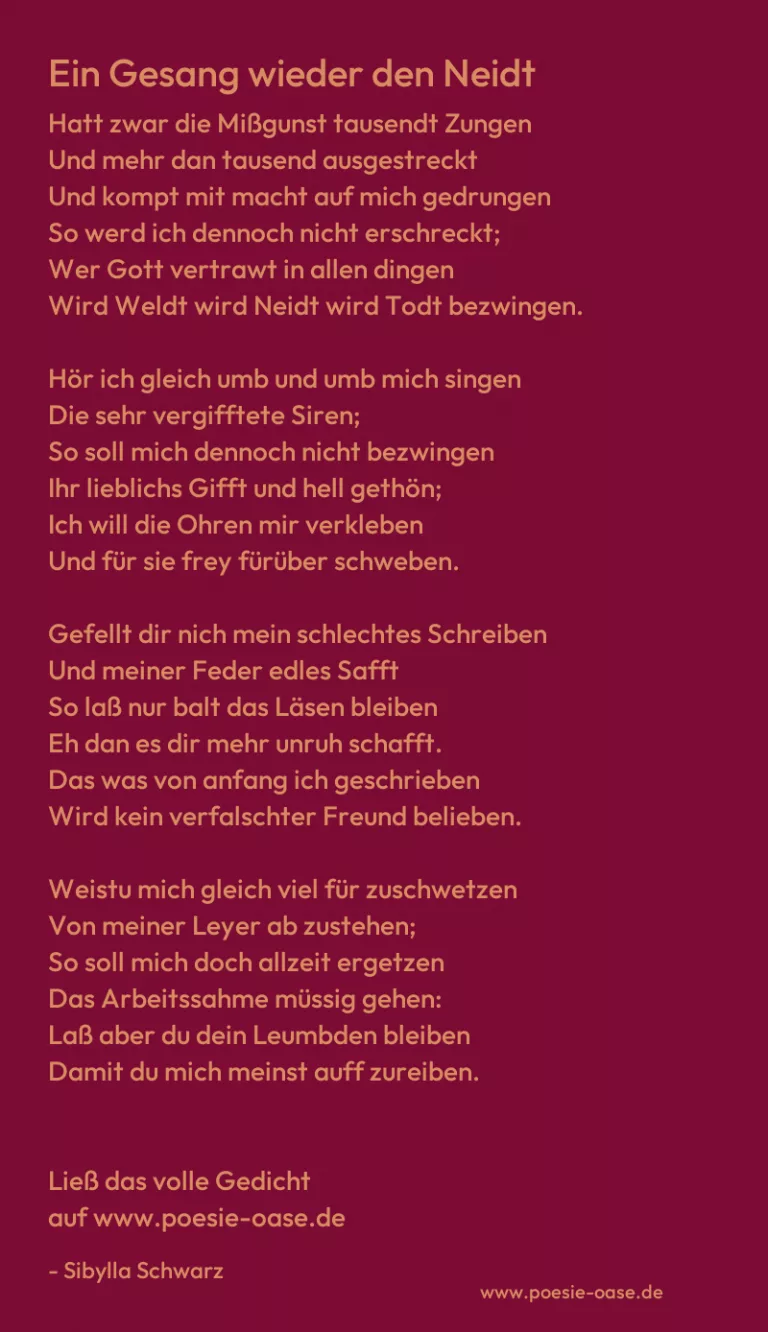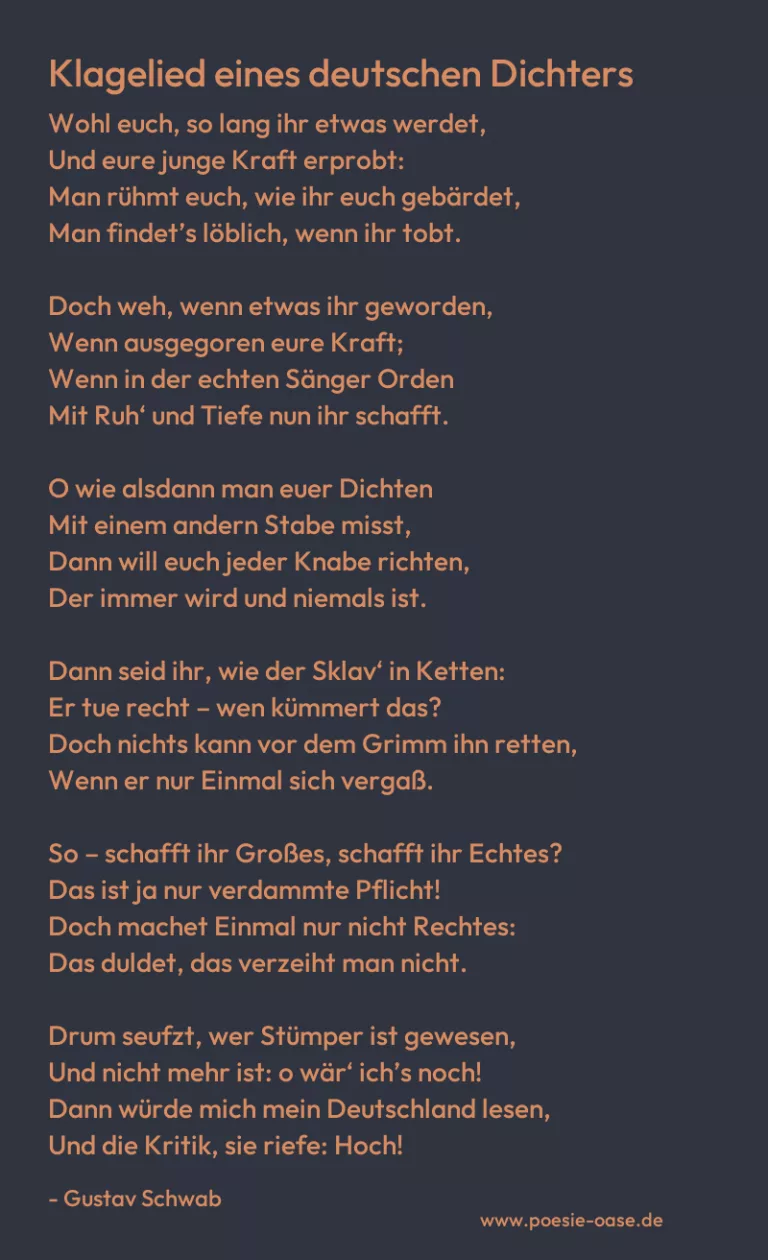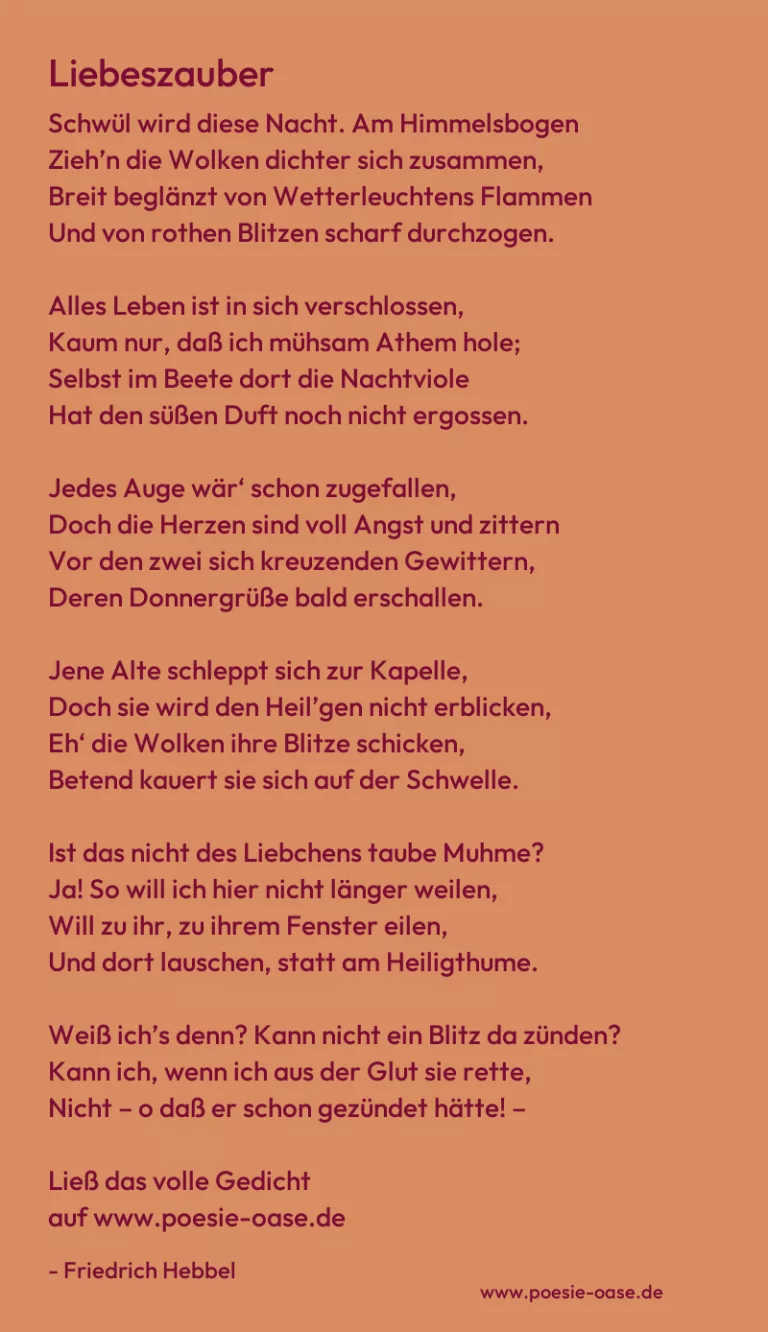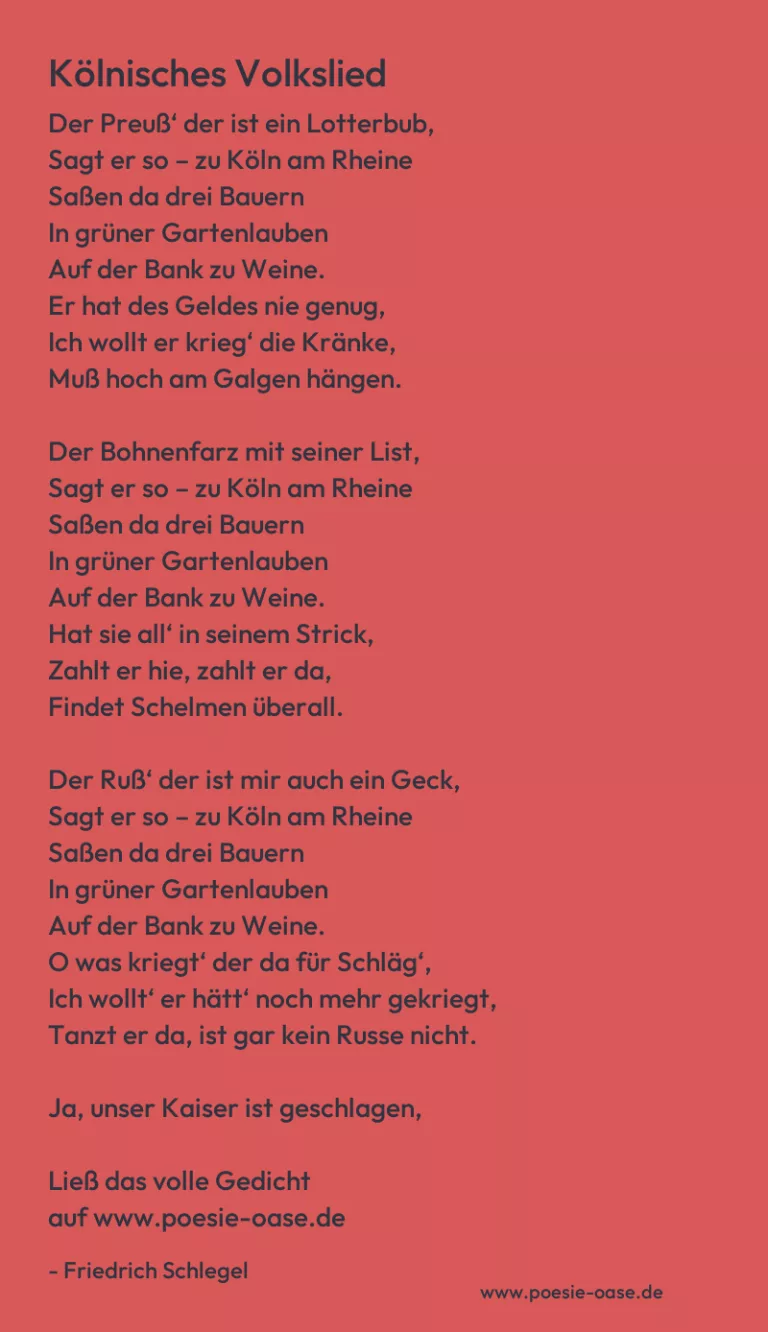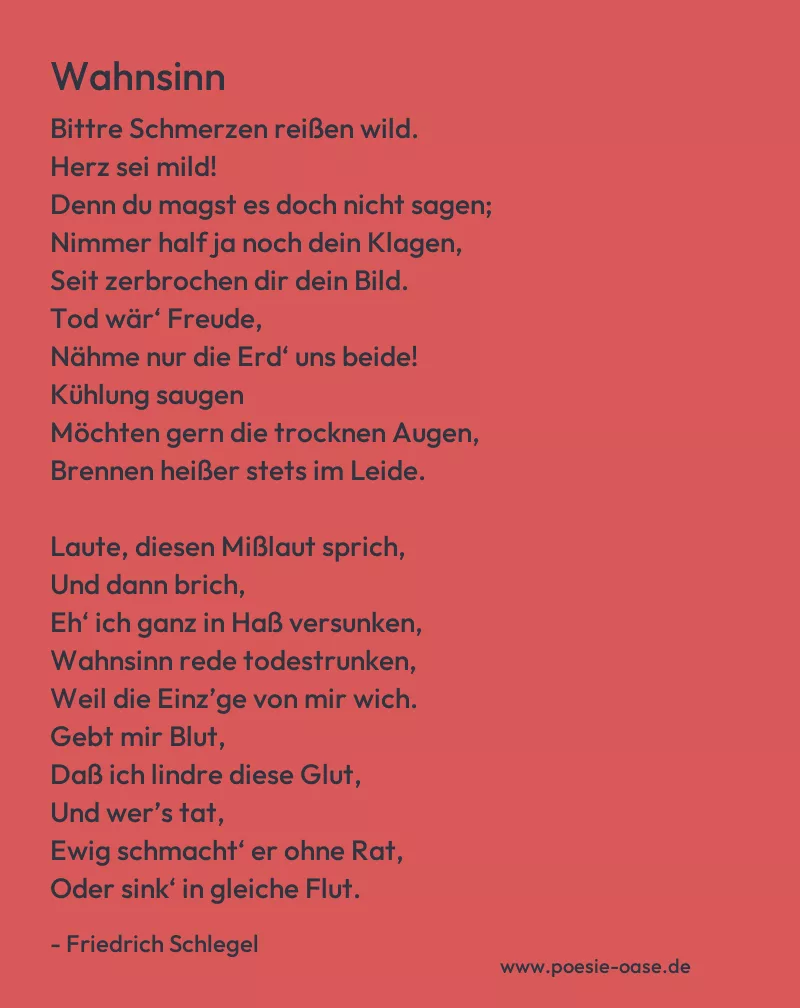Wahnsinn
Bittre Schmerzen reißen wild.
Herz sei mild!
Denn du magst es doch nicht sagen;
Nimmer half ja noch dein Klagen,
Seit zerbrochen dir dein Bild.
Tod wär‘ Freude,
Nähme nur die Erd‘ uns beide!
Kühlung saugen
Möchten gern die trocknen Augen,
Brennen heißer stets im Leide.
Laute, diesen Mißlaut sprich,
Und dann brich,
Eh‘ ich ganz in Haß versunken,
Wahnsinn rede todestrunken,
Weil die Einz’ge von mir wich.
Gebt mir Blut,
Daß ich lindre diese Glut,
Und wer’s tat,
Ewig schmacht‘ er ohne Rat,
Oder sink‘ in gleiche Flut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
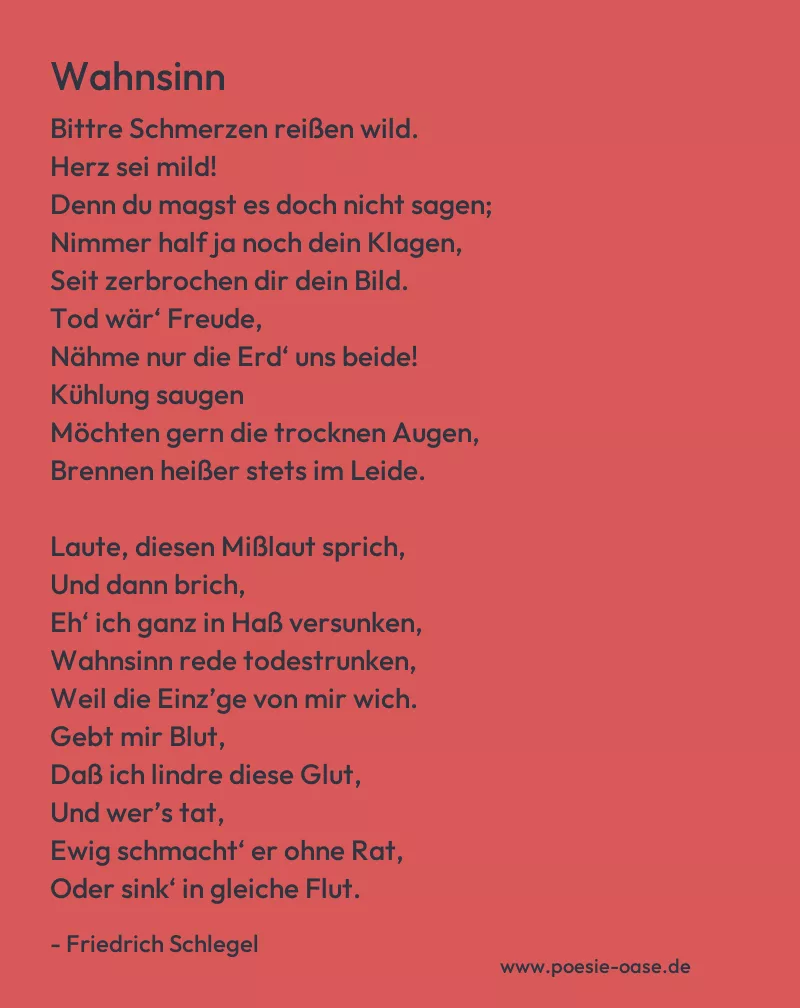
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wahnsinn“ von Friedrich Schlegel fängt die Verzweiflung und den inneren Schmerz eines Menschen ein, der unter Liebeskummer oder einem anderen intensiven Verlust leidet. Die ersten Verse beschreiben die „bittre Schmerzen“, die das Herz des Sprechers zerrissen haben. Die Aufforderung „Herz sei mild!“ zeigt einen inneren Kampf, in dem der Sprecher versucht, seine Emotionen zu zügeln, obwohl das „Klagen“ und die „zerbrochene“ Vorstellung von Liebe ihn nicht loslassen. Diese „Bitterkeit“ und der schmerzhafte Verlust des eigenen „Bildes“ deuten auf eine Identitätskrise hin, die durch den Verlust eines geliebten Menschen oder Ideals verursacht wird.
Die zweite Strophe verdeutlicht die Qualen, die der Sprecher durchlebt. Der Wunsch nach „Tod“ als Erlösung von der unerträglichen Qual macht deutlich, wie tief der Schmerz sitzt. Die „trocknen Augen“, die nach „Kühlung“ suchen, stellen eine starke Metapher für die Sehnsucht nach emotionaler Erleichterung dar. Doch der Schmerz „brennt heißer“ und lässt den Sprecher in einem Zustand ständiger Qual zurück, was die Unmöglichkeit der Flucht vor dem inneren Leid unterstreicht.
In der dritten Strophe äußert sich der innere Wahnsinn des Sprechers in einer ungestümen Reaktion auf den Verlust. Die Forderung „Laute, diesen Mißlaut sprich“ und die Androhung, „Wahnsinn“ zu reden, deutet darauf hin, dass der Schmerz des Sprechers so überwältigend ist, dass er bereit ist, die Kontrolle über seine Gedanken und Worte zu verlieren. Der „Wahnsinn“ wird als eine Art letzte Reaktion auf den Schmerz beschrieben, als ein Zustand des völligen Verfalls, in dem der Sprecher den Verlust nicht mehr ertragen kann.
Die letzte Strophe bringt die Dunkelheit und die Dramatik der Situation auf den Höhepunkt. Der Sprecher verlangt nach „Blut“, um die „Glut“ des Schmerzes zu lindern, was eine verzweifelte Bitte nach Erlösung oder sogar Rache widerspiegelt. Diese Bitte nach Rache wird in der Formulierung „wer’s tat, ewig schmacht‘ er ohne Rat“ noch verstärkt, wobei der Sprecher die Vorstellung hegt, dass derjenige, der ihm das Leid zugefügt hat, in gleicher Weise leiden soll. Der Gedanke, in die gleiche „Flut“ zu sinken, wie der Sprecher selbst, ist eine Darstellung der völligen Verzweiflung und des Gefühls der Ausweglosigkeit.
Schlegel nutzt in diesem Gedicht stark übertriebene Bilder von Schmerz, Wahnsinn und Rache, um die Intensität des Leidens zu vermitteln, das der Sprecher empfindet. Der „Wahnsinn“ wird dabei nicht nur als psychischer Zustand, sondern auch als eine Form der existenziellen Krise dargestellt, die den Sprecher bis an die Grenzen seiner menschlichen Belastbarkeit führt. Das Gedicht ist ein eindrucksvolles Beispiel für die romantische Darstellung von übermäßiger emotionaler Intensität und die schmerzvolle, oft zerstörerische Kraft von unerfüllter Liebe oder Verlust.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.