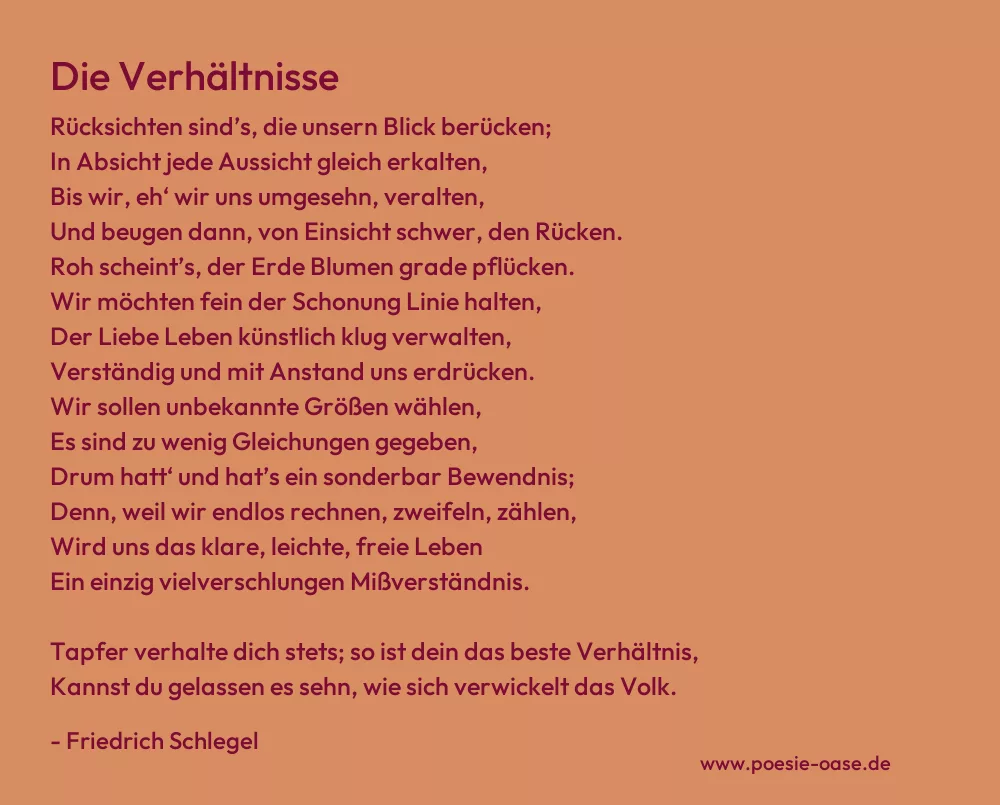Die Verhältnisse
Rücksichten sind’s, die unsern Blick berücken;
In Absicht jede Aussicht gleich erkalten,
Bis wir, eh‘ wir uns umgesehn, veralten,
Und beugen dann, von Einsicht schwer, den Rücken.
Roh scheint’s, der Erde Blumen grade pflücken.
Wir möchten fein der Schonung Linie halten,
Der Liebe Leben künstlich klug verwalten,
Verständig und mit Anstand uns erdrücken.
Wir sollen unbekannte Größen wählen,
Es sind zu wenig Gleichungen gegeben,
Drum hatt‘ und hat’s ein sonderbar Bewendnis;
Denn, weil wir endlos rechnen, zweifeln, zählen,
Wird uns das klare, leichte, freie Leben
Ein einzig vielverschlungen Mißverständnis.
Tapfer verhalte dich stets; so ist dein das beste Verhältnis,
Kannst du gelassen es sehn, wie sich verwickelt das Volk.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
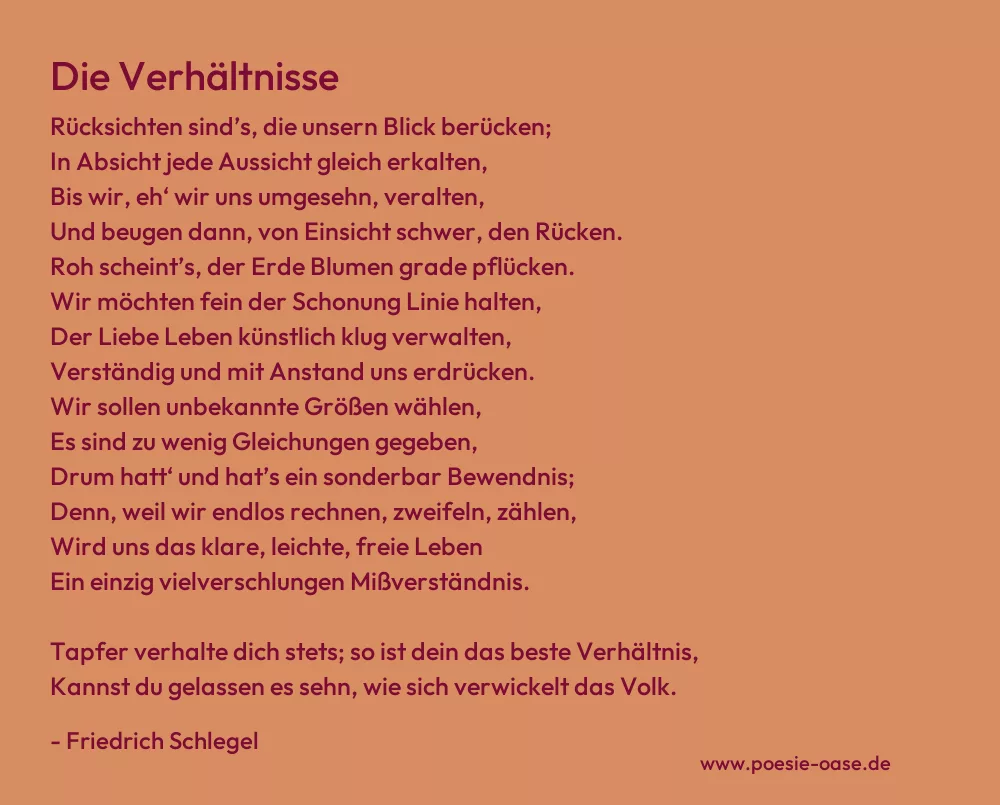
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Verhältnisse“ von Friedrich Schlegel reflektiert auf tiefgründige Weise die Komplexität menschlicher Beziehungen und das Dilemma, sich in einer Welt voller „Rücksichten“ und „Absichten“ zurechtzufinden. Die erste Strophe beschreibt, wie „Rücksichten“ den Blick des Menschen trüben und die „Aussicht“ auf das Leben „erkalten“ lassen. Diese Rücksichten – also die überlegten, oft auch beherrschten und pragmatischen Überlegungen – verhindern ein spontanes und leidenschaftliches Leben. Die Idee, dass der Mensch „veraltet“, ohne sich bewusst darüber zu sein, spiegelt die Idee wider, dass der Mensch von seinen eigenen Überlegungen und den gesellschaftlichen Normen gefangen wird, was ihn in einen Zustand der Resignation führt.
In der zweiten Strophe wird die Vorstellung weitergeführt, dass der Mensch in seiner Kunstfertigkeit und Klugheit das „Leben künstlich klug verwalten“ möchte. Das Bild, dass der Mensch „mit Anstand sich erdrücken“ lässt, vermittelt die Vorstellung, dass die ständige Vorsicht und Überlegung in menschlichen Beziehungen – besonders in der Liebe – zu einer Art erstickender „Verwaltung“ führt. Schlegel kritisiert hier die Tendenz, die Natürlichkeit und Spontaneität in zwischenmenschlichen Beziehungen durch eine zu rationale Herangehensweise zu ersetzen, wodurch das Leben zunehmend weniger lebendig wird.
Die dritte Strophe thematisiert das Dilemma, vor dem der Mensch steht: er muss „unbekannte Größen wählen“, weil er mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens konfrontiert ist und dennoch zu wenig „Gleichungen“ hat, um diese Unsicherheiten korrekt zu berechnen. Diese Unklarheit wird als das „sonderbar Bewendnis“ beschrieben – die Erkenntnis, dass es keine klaren Antworten auf die komplexen Fragen des Lebens gibt. Der ständige Versuch, das Leben in logische und rationale Formeln zu fassen, führt zu einem „Mißverständnis“ – einem Missverhältnis zwischen den Erwartungen und der Wirklichkeit des Lebens. Schlegel zeigt hier die Absurdität des menschlichen Versuchs, alles rational und messbar zu machen.
In der letzten Zeile fordert Schlegel eine Haltung der Gelassenheit und Tapferkeit. Das „beste Verhältnis“ ist demnach nicht das, das von „Rücksichten“ und „Absichten“ bestimmt wird, sondern das, das mit der Gewissheit lebt, dass das Leben nicht immer berechenbar oder verständlich ist. „Tapfer verhalte dich stets“ ruft dazu auf, das Leben mit einer gewissen inneren Stärke und Ruhe zu akzeptieren, ohne in den Zwängen des rationalen Überdenkens und der gesellschaftlichen Erwartungen zu ersticken. Die „verwickelten“ Verhältnisse des „Volkes“ symbolisieren die Komplexität der sozialen Strukturen, die den Einzelnen oft verwirren und belasten.
Schlegels Gedicht ist eine kritische Reflexion über die Unvereinbarkeit von menschlicher Freiheit und den ständigen Versuchen, das Leben und die Beziehungen in ein rationales System zu zwängen. Es fordert dazu auf, das Leben zu leben, ohne sich von den „Verhältnissen“ und „Rücksichten“ erdrücken zu lassen, und betont die Bedeutung von Gelassenheit und einer Tapferkeit, die den Menschen in einer verwirrenden Welt zu seiner inneren Freiheit führen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.