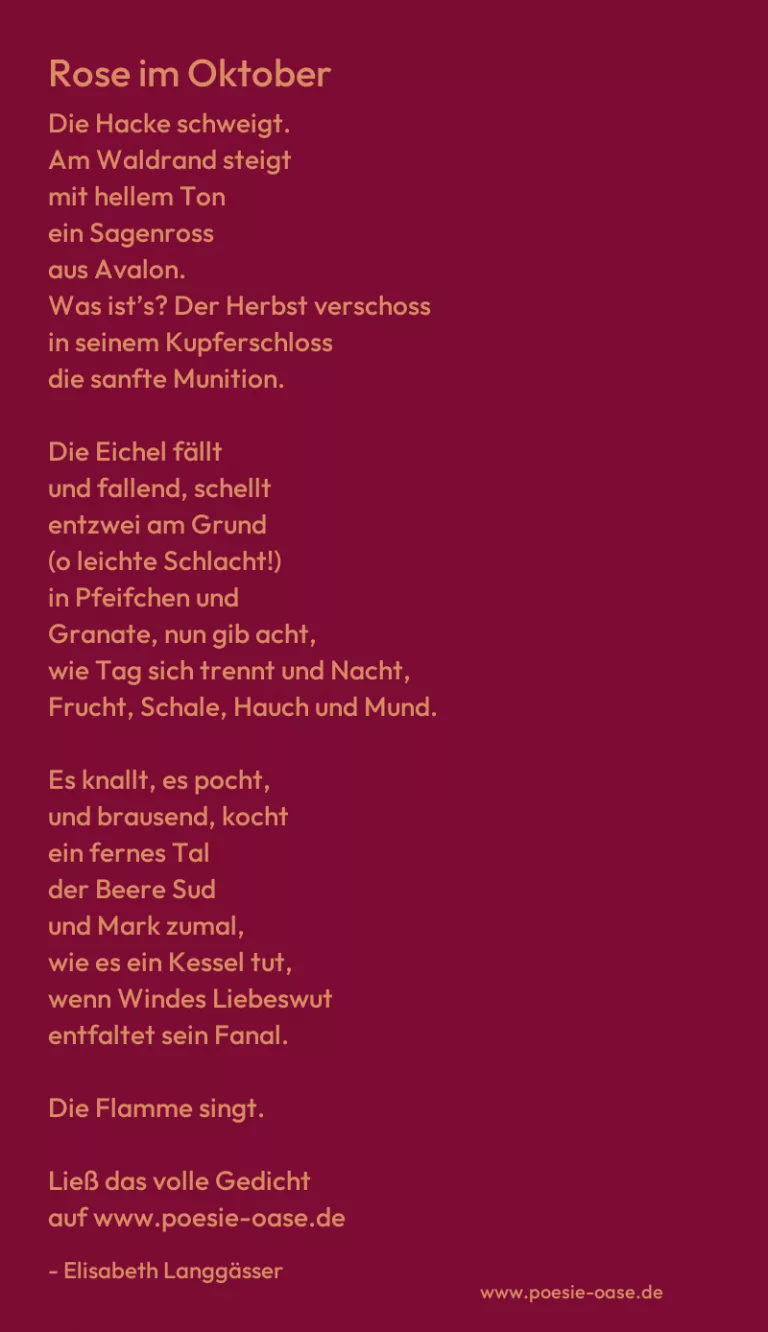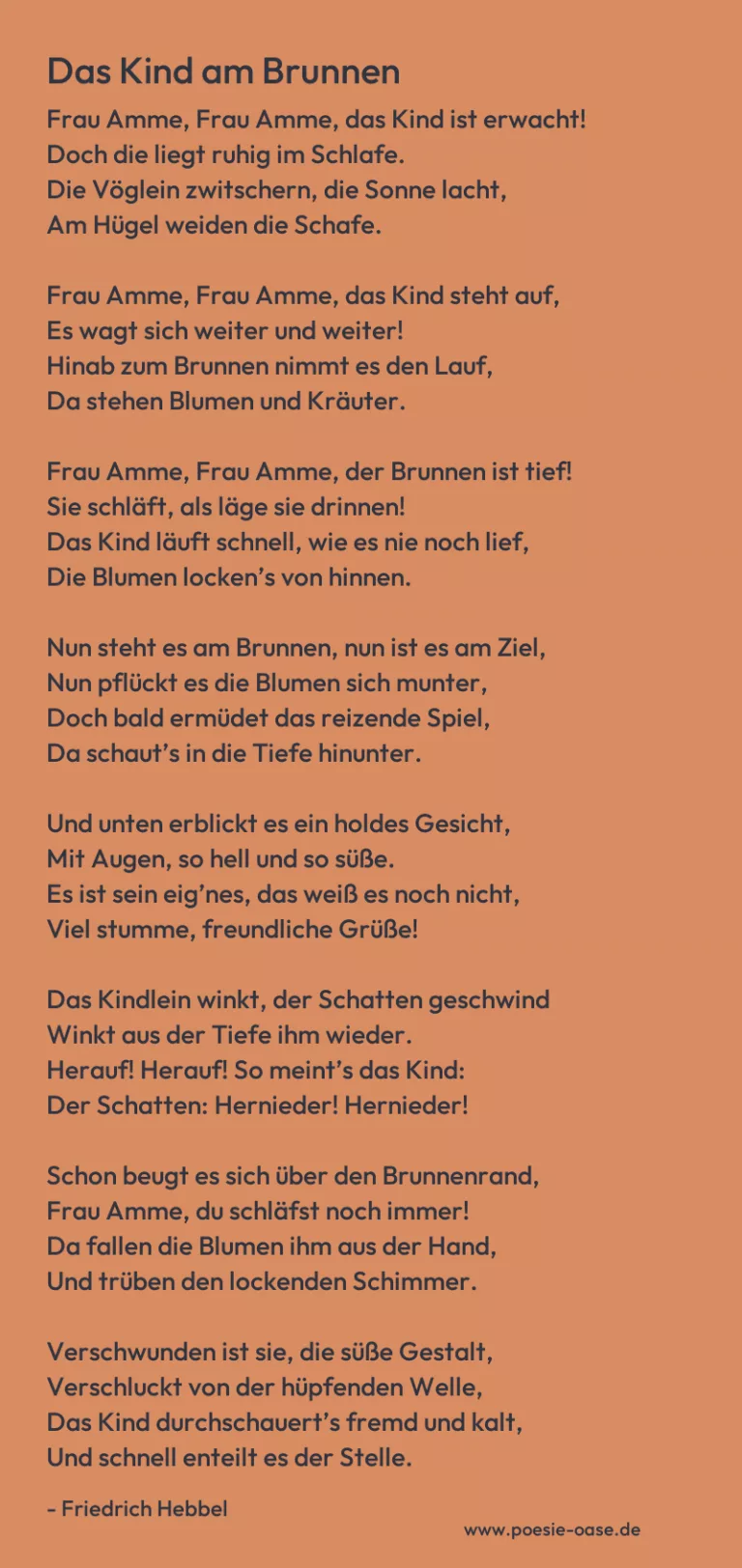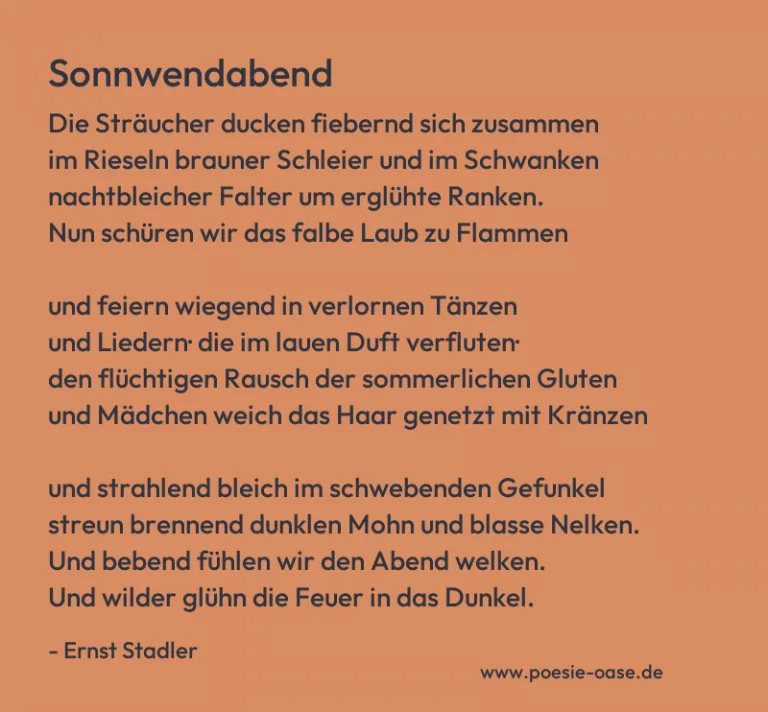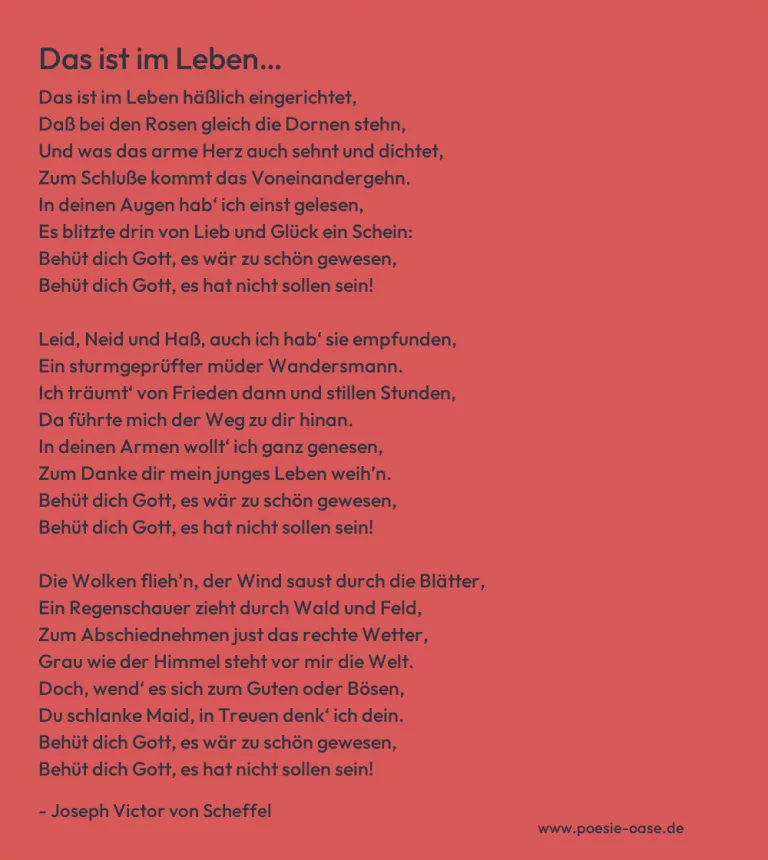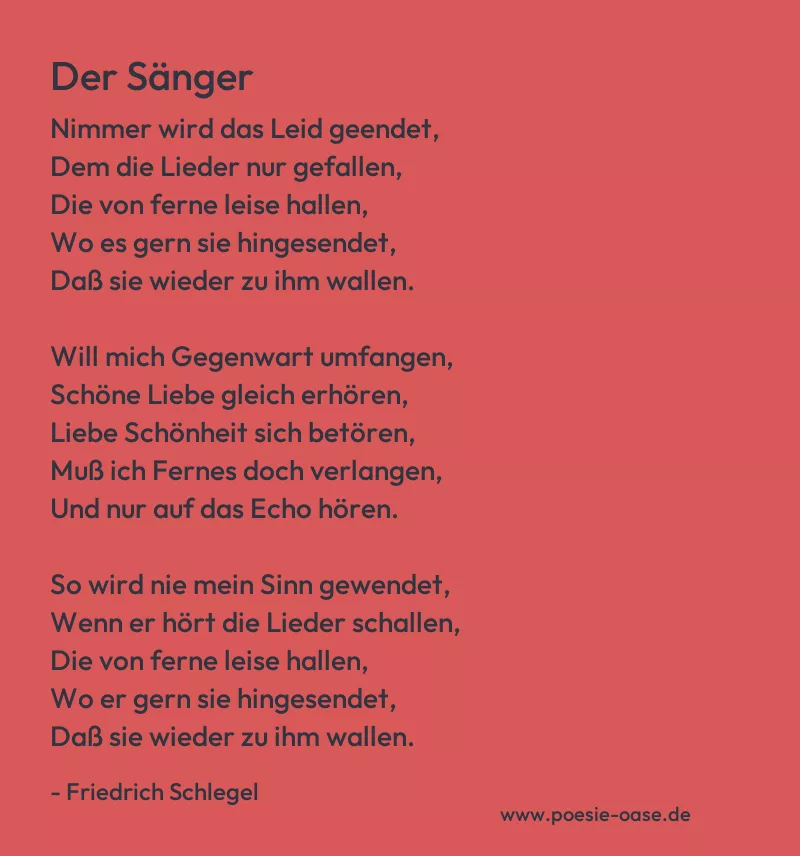Der Sänger
Nimmer wird das Leid geendet,
Dem die Lieder nur gefallen,
Die von ferne leise hallen,
Wo es gern sie hingesendet,
Daß sie wieder zu ihm wallen.
Will mich Gegenwart umfangen,
Schöne Liebe gleich erhören,
Liebe Schönheit sich betören,
Muß ich Fernes doch verlangen,
Und nur auf das Echo hören.
So wird nie mein Sinn gewendet,
Wenn er hört die Lieder schallen,
Die von ferne leise hallen,
Wo er gern sie hingesendet,
Daß sie wieder zu ihm wallen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
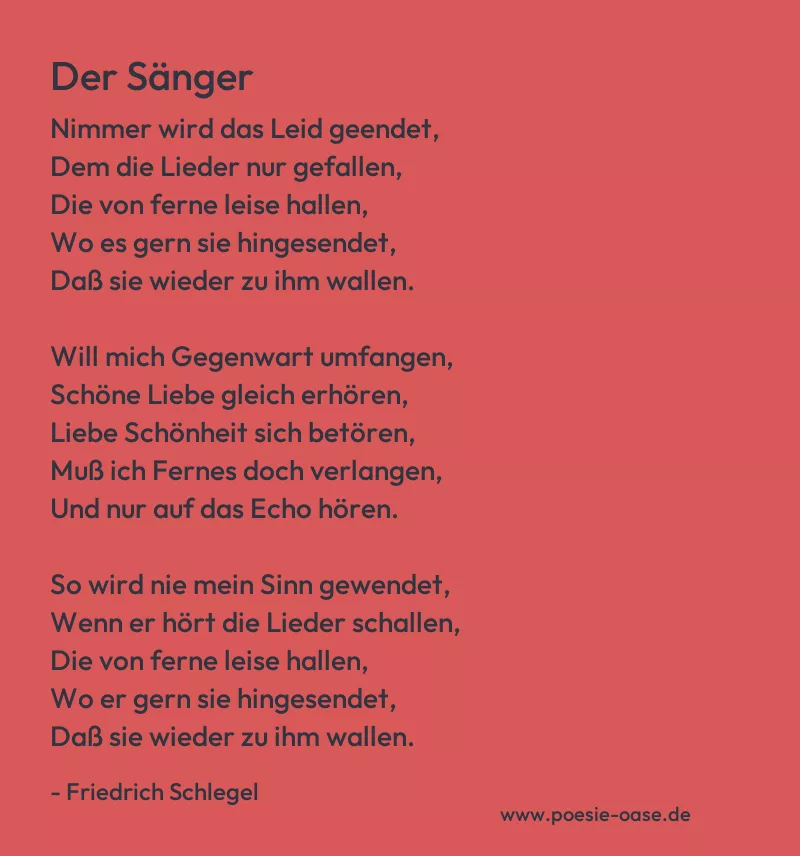
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sänger“ von Friedrich Schlegel thematisiert auf eindrucksvolle Weise den Konflikt zwischen der Gegenwart und der Sehnsucht nach etwas Fernem, Unnahbarem. Die erste Strophe stellt das Leid des Sängers dar, der in seinen Lieder nur das Fernweh und die Sehnsucht nach einem unerreichbaren Ziel finden kann. Die „Lieder“, die „von ferne leise hallen“, symbolisieren eine entfernte, unerreichbare Schönheit oder Liebe, die der Sänger mit seiner Musik anzieht und die zurückkehrt, als Echo seiner eigenen Sehnsucht. Dieser Kreislauf von Verlangen und Unerreichbarkeit wird als eine nie endende Quelle des Leids beschrieben.
In der zweiten Strophe zeigt sich der innere Konflikt des Sängers noch deutlicher. Der Wunsch, die „Gegenwart“ zu erleben und „schöne Liebe“ zu erfahren, steht im Gegensatz zu seinem inneren Bedürfnis nach dem „Fernen“. Das Gedicht spielt mit der Idee, dass wahre Liebe und wahre Schönheit immer in der Ferne liegen und die Gegenwart nicht in der Lage ist, diese Sehnsüchte zu stillen. Die paradoxe Situation des Sängers wird deutlich: Um die „Liebe“ und „Schönheit“ der Gegenwart zu erfahren, muss er sich weiterhin nach dem Ferneren sehnen und nur dem „Echo“ seiner eigenen Wünsche lauschen.
Die Wiederholung der ersten Strophe in der letzten Verszeile unterstreicht den Kreis aus Sehnsucht und Unerreichbarkeit, in dem der Sänger gefangen ist. Die „Lieder“, die „von ferne leise hallen“, sind eine Metapher für das ständige Streben nach etwas, das nie vollständig erreicht werden kann. Das Echo dieser Lieder ist ein ständiges Erinnern an das, was nicht da ist, und es zieht den Sänger immer wieder in den Kreis der Sehnsucht zurück, ohne ihm eine wirkliche Erfüllung zu bringen.
In diesem Gedicht thematisiert Schlegel die Dualität von Wunsch und Erfüllung, von Nähe und Ferne, und die Idee, dass wahre Liebe und wahre Schönheit stets etwas sind, nach dem der Mensch strebt, ohne es je vollständig zu erreichen. Der Sänger bleibt in einem Zustand der Unvollständigkeit, und sein Leid wird durch den unaufhörlichen Wunsch nach dem Fernen und Unerreichbaren genährt. Schlegel fängt damit die universelle Erfahrung menschlicher Sehnsucht ein – das Streben nach etwas, das man nie ganz erlangen kann, und die permanente Unruhe, die damit einhergeht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.