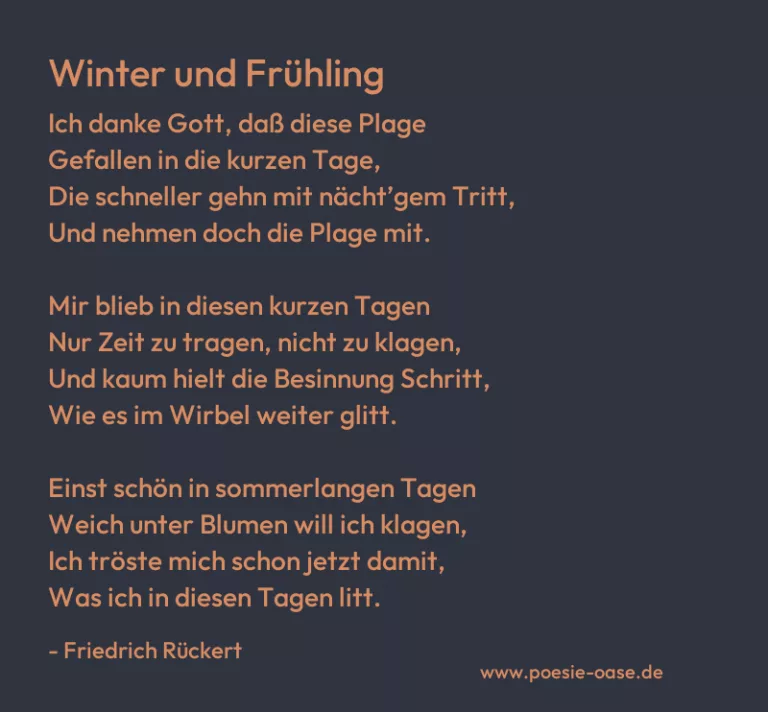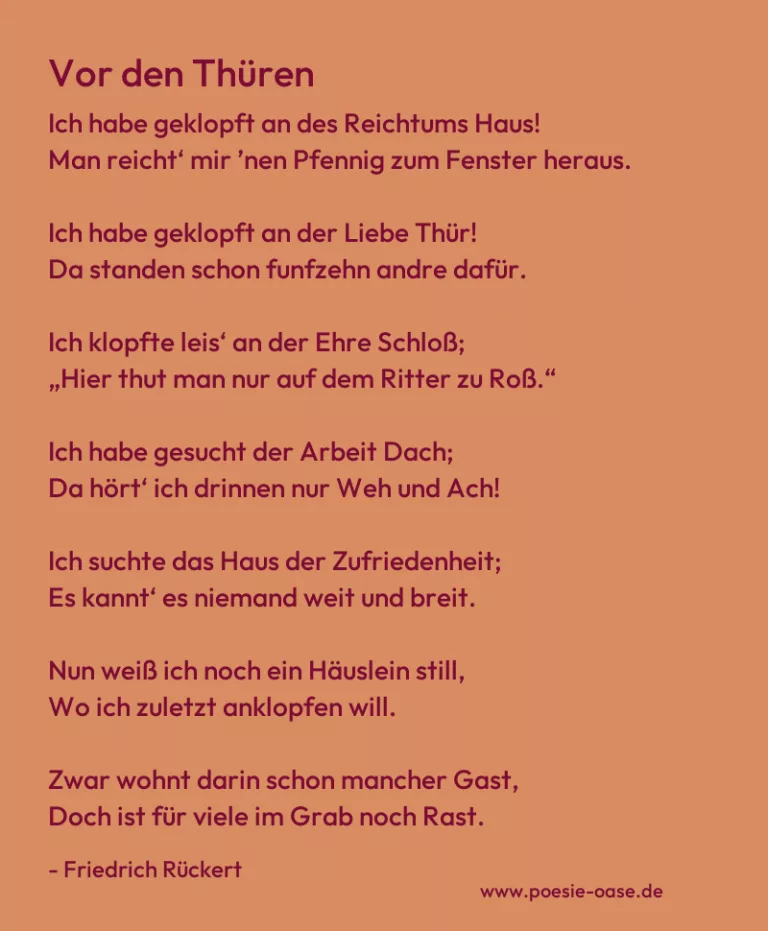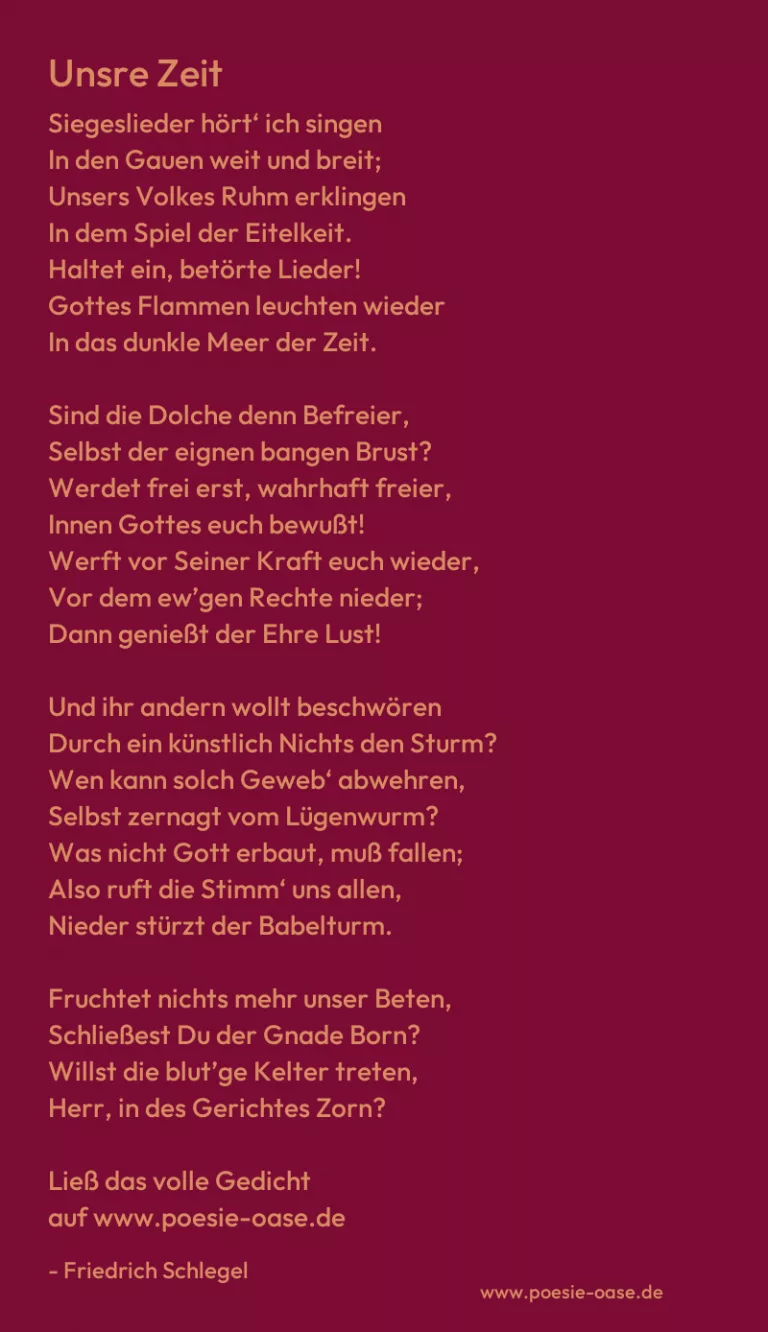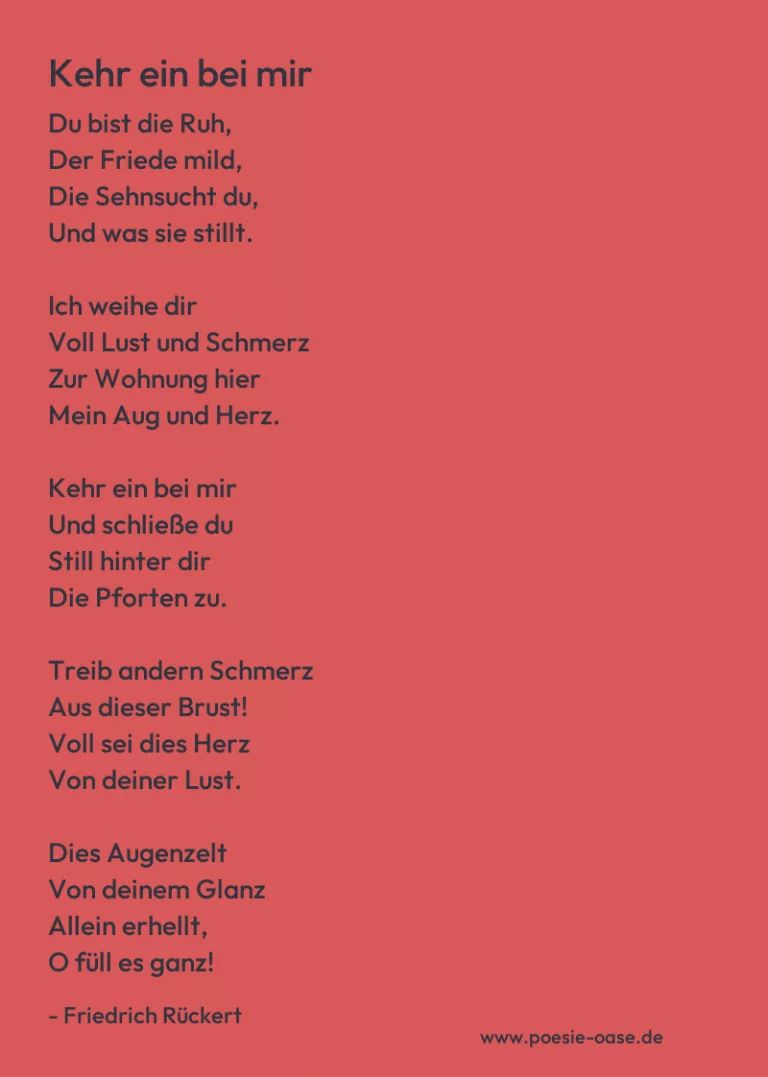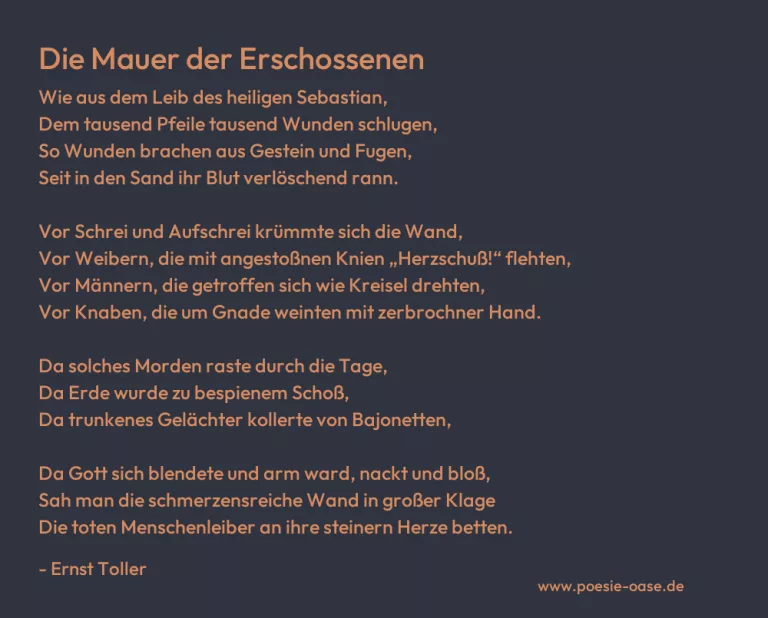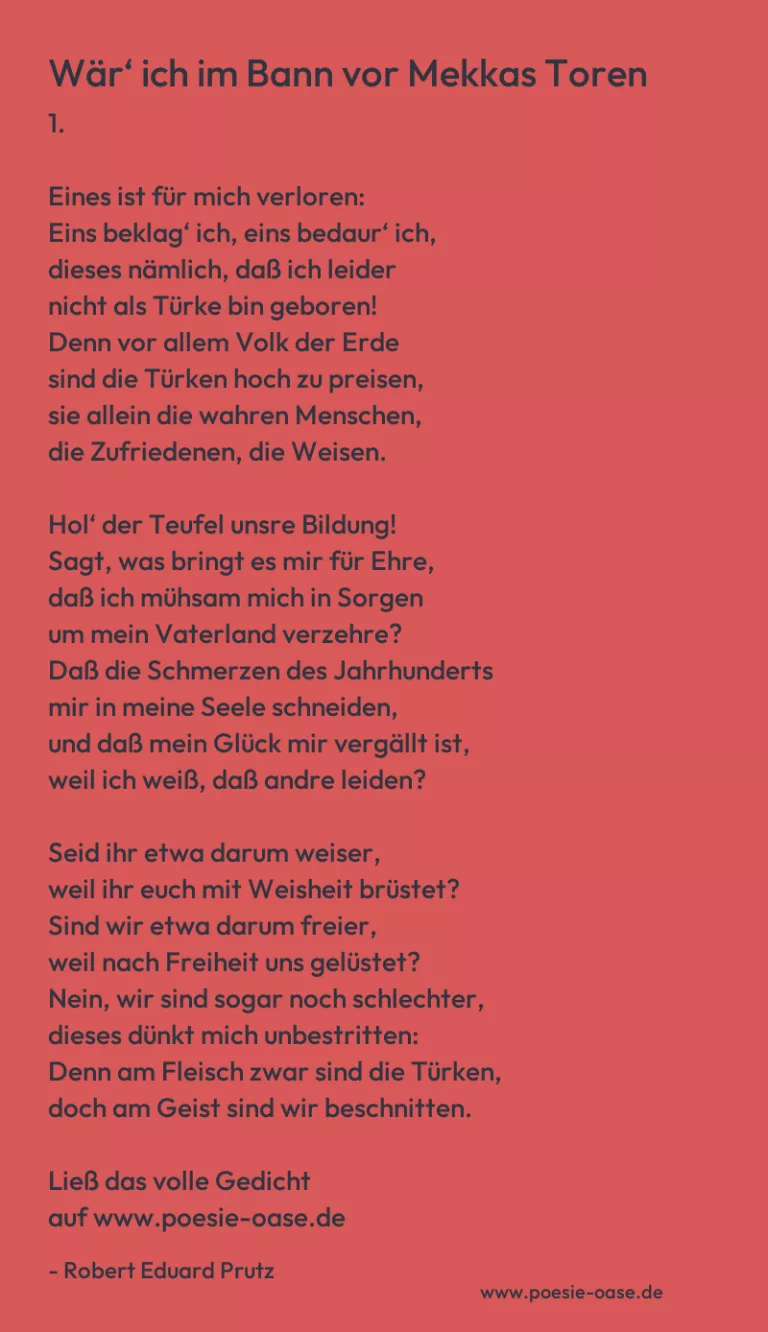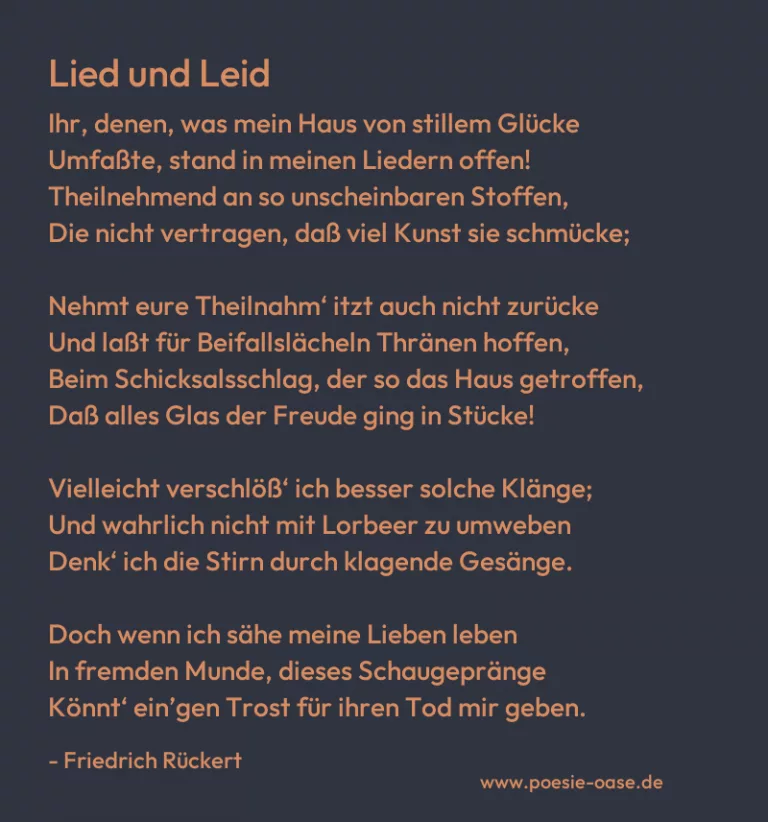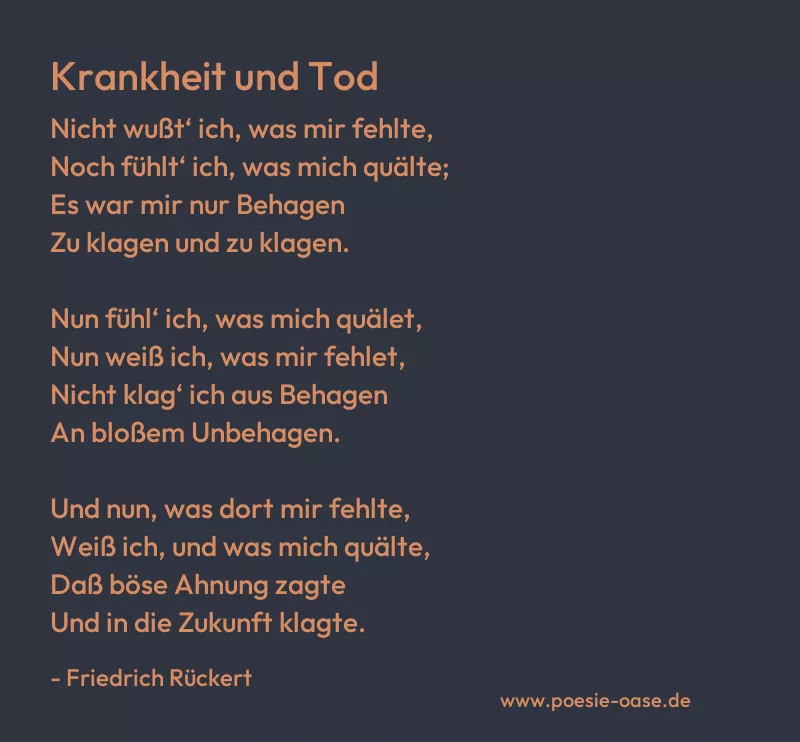Krankheit und Tod
Nicht wußt‘ ich, was mir fehlte,
Noch fühlt‘ ich, was mich quälte;
Es war mir nur Behagen
Zu klagen und zu klagen.
Nun fühl‘ ich, was mich quälet,
Nun weiß ich, was mir fehlet,
Nicht klag‘ ich aus Behagen
An bloßem Unbehagen.
Und nun, was dort mir fehlte,
Weiß ich, und was mich quälte,
Daß böse Ahnung zagte
Und in die Zukunft klagte.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
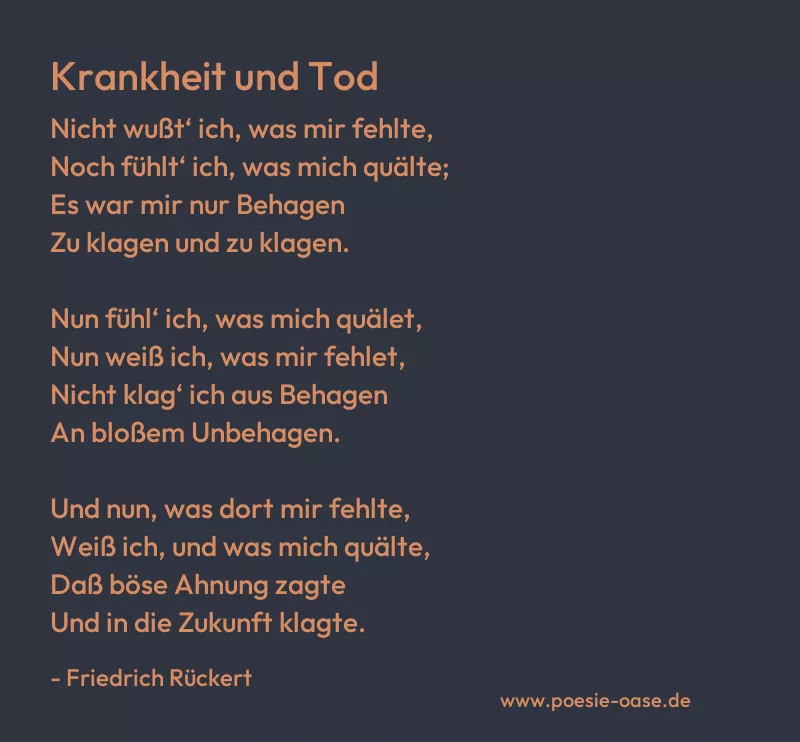
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Krankheit und Tod“ von Friedrich Rückert beschreibt in klaren, ruhigen Versen eine Entwicklung vom unbestimmten inneren Unbehagen hin zur bewussten Erkenntnis von Leid und Vorahnung. Zu Beginn schildert Rückert einen Zustand der inneren Unruhe: Ohne zu wissen, was ihm fehlt oder ihn quält, verspürt der Sprecher dennoch ein Bedürfnis zu klagen – ein diffuses, aber drängendes Unbehagen.
Im weiteren Verlauf des Gedichts tritt eine Wendung ein: Der Sprecher erkennt nun bewusst, was ihn quält, und sein Leiden erhält eine konkrete Gestalt. Die frühere, beinahe ziellose Klage wird nun durch ein echtes, tief empfundenes Leid ersetzt. Das bloße Unbehagen wird abgelöst von einer schmerzhaften Wahrheit.
In der abschließenden Strophe wird deutlich, dass das ursprüngliche Unwohlsein eine Vorahnung des Kommenden war. Das, was dem Sprecher damals fehlte, war ein noch unklarer, aber zutiefst gespürter Blick in eine leidvolle Zukunft – eine düstere Ahnung von Krankheit und Tod, die sich jetzt bestätigt hat.
Rückert gelingt es, mit schlichter Sprache und einer fast kreisförmigen Struktur die schleichende Erkenntnis des eigenen Schicksals zu gestalten. Das Gedicht vermittelt eine stille, resignative Traurigkeit über das menschliche Erleben von Leid, das sich zuerst unbestimmt ankündigt und dann in schmerzlicher Klarheit offenbart.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.