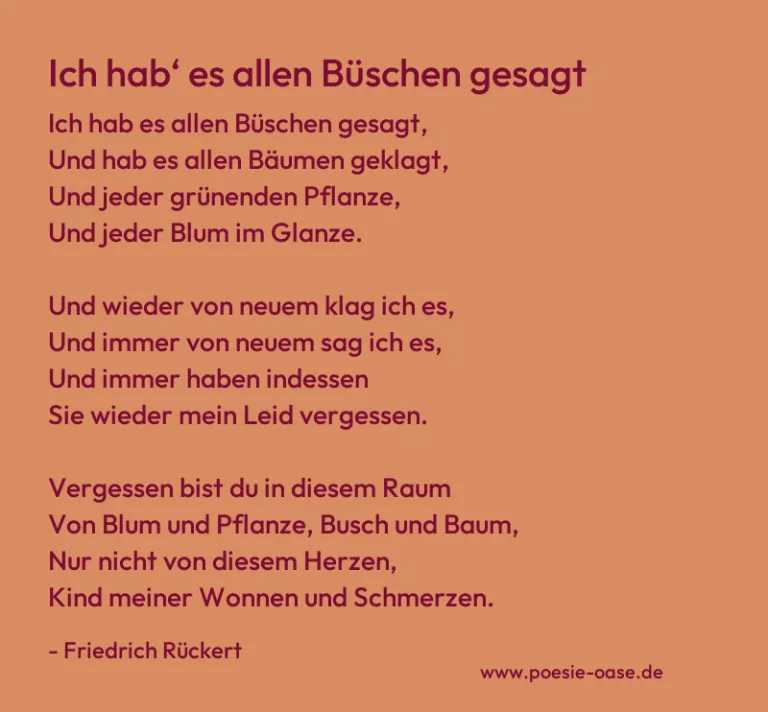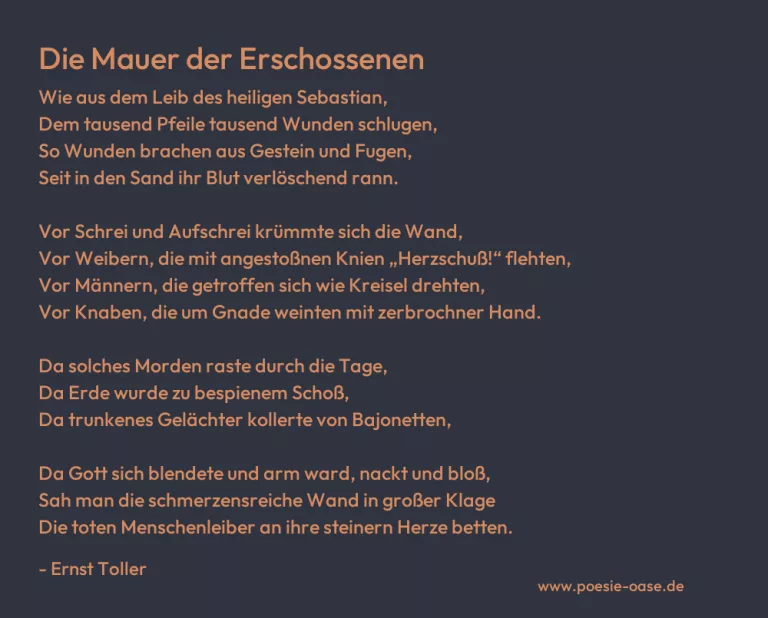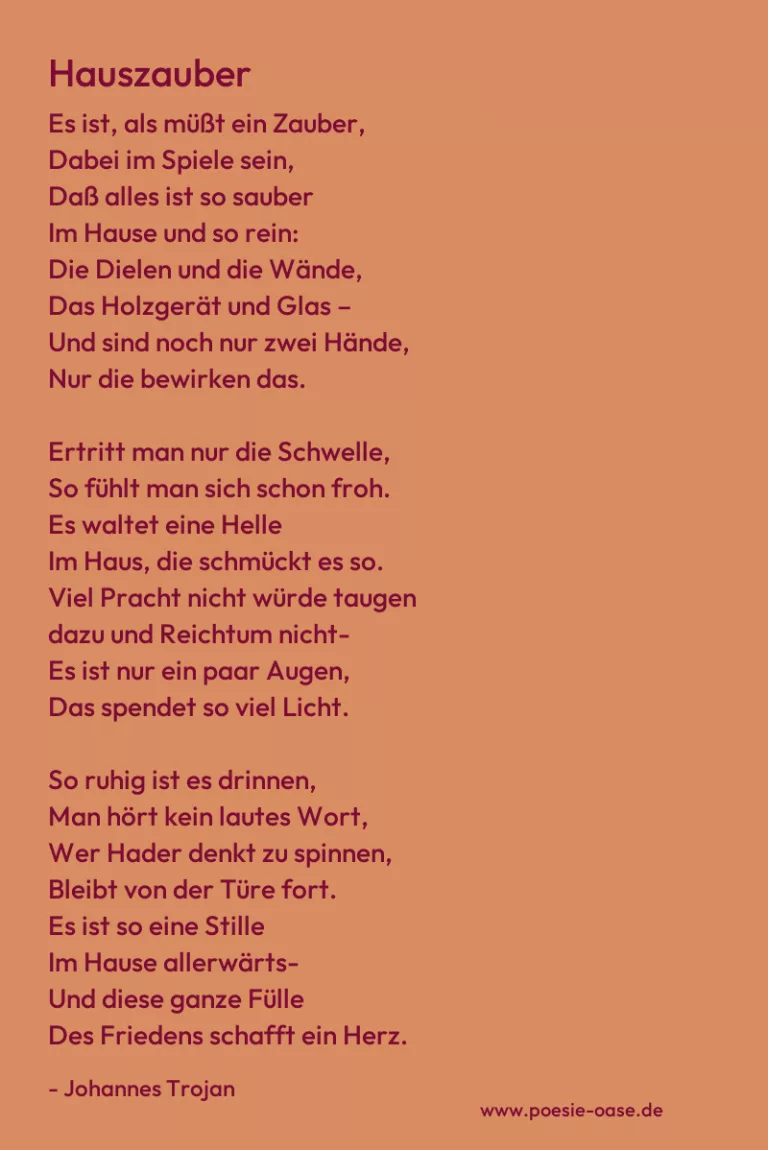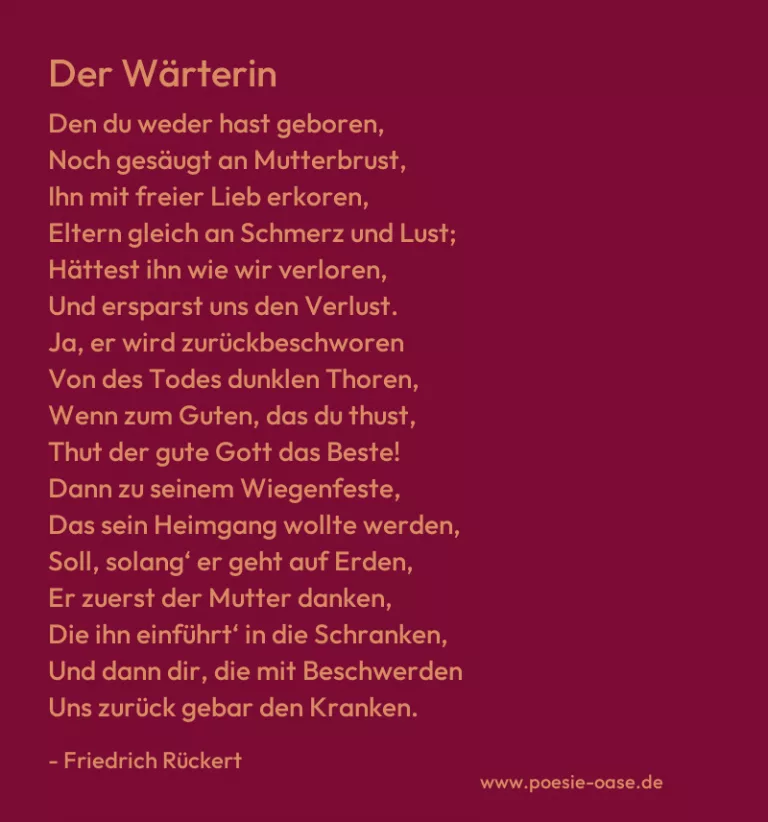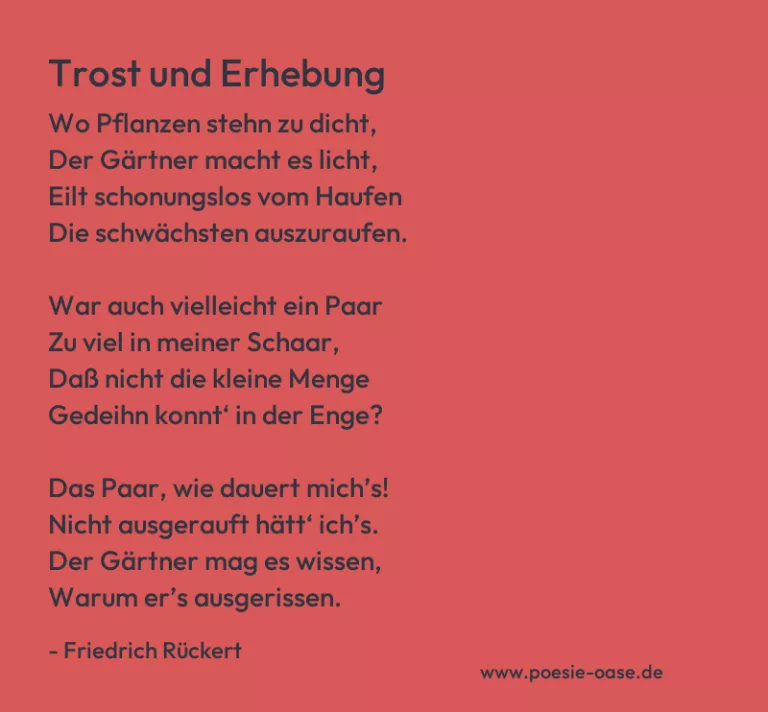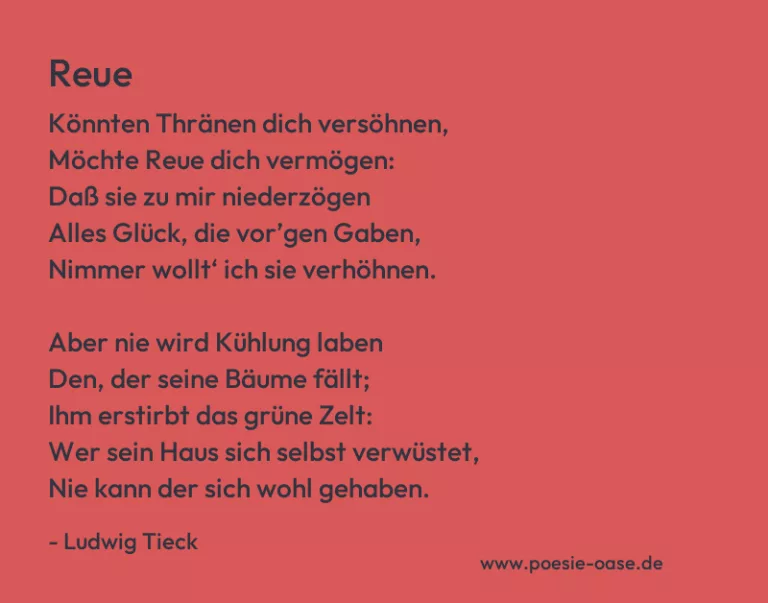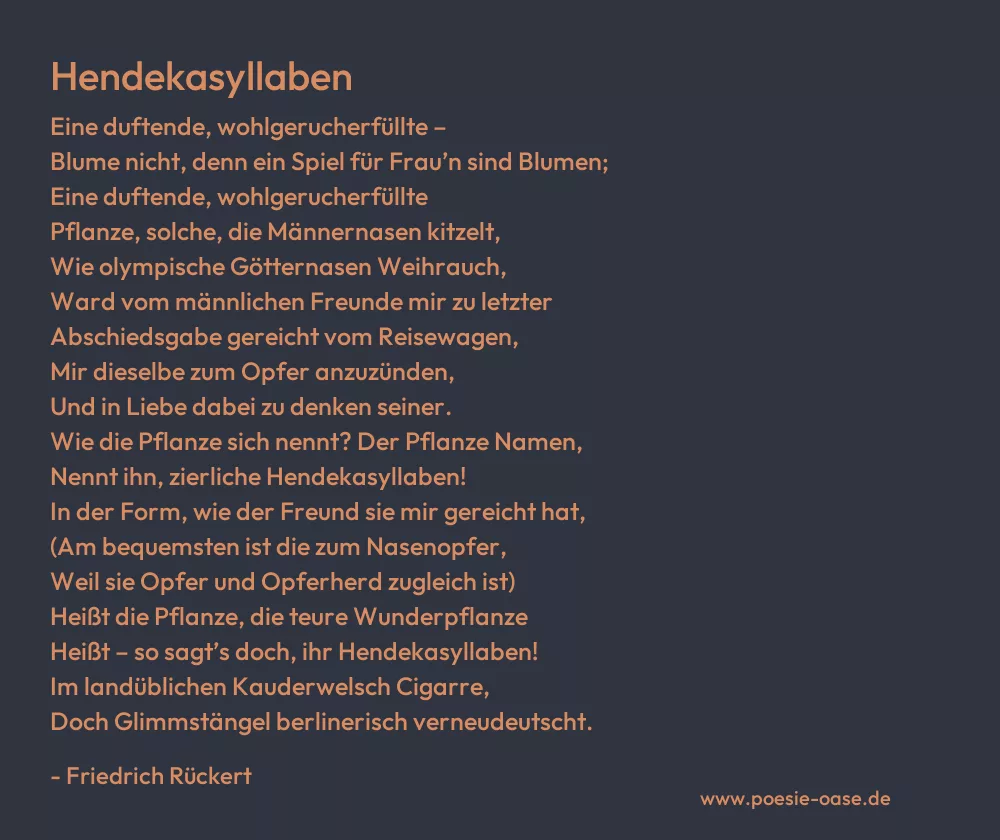Hendekasyllaben
Eine duftende, wohlgerucherfüllte –
Blume nicht, denn ein Spiel für Frau’n sind Blumen;
Eine duftende, wohlgerucherfüllte
Pflanze, solche, die Männernasen kitzelt,
Wie olympische Götternasen Weihrauch,
Ward vom männlichen Freunde mir zu letzter
Abschiedsgabe gereicht vom Reisewagen,
Mir dieselbe zum Opfer anzuzünden,
Und in Liebe dabei zu denken seiner.
Wie die Pflanze sich nennt? Der Pflanze Namen,
Nennt ihn, zierliche Hendekasyllaben!
In der Form, wie der Freund sie mir gereicht hat,
(Am bequemsten ist die zum Nasenopfer,
Weil sie Opfer und Opferherd zugleich ist)
Heißt die Pflanze, die teure Wunderpflanze
Heißt – so sagt’s doch, ihr Hendekasyllaben!
Im landüblichen Kauderwelsch Cigarre,
Doch Glimmstängel berlinerisch verneudeutscht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
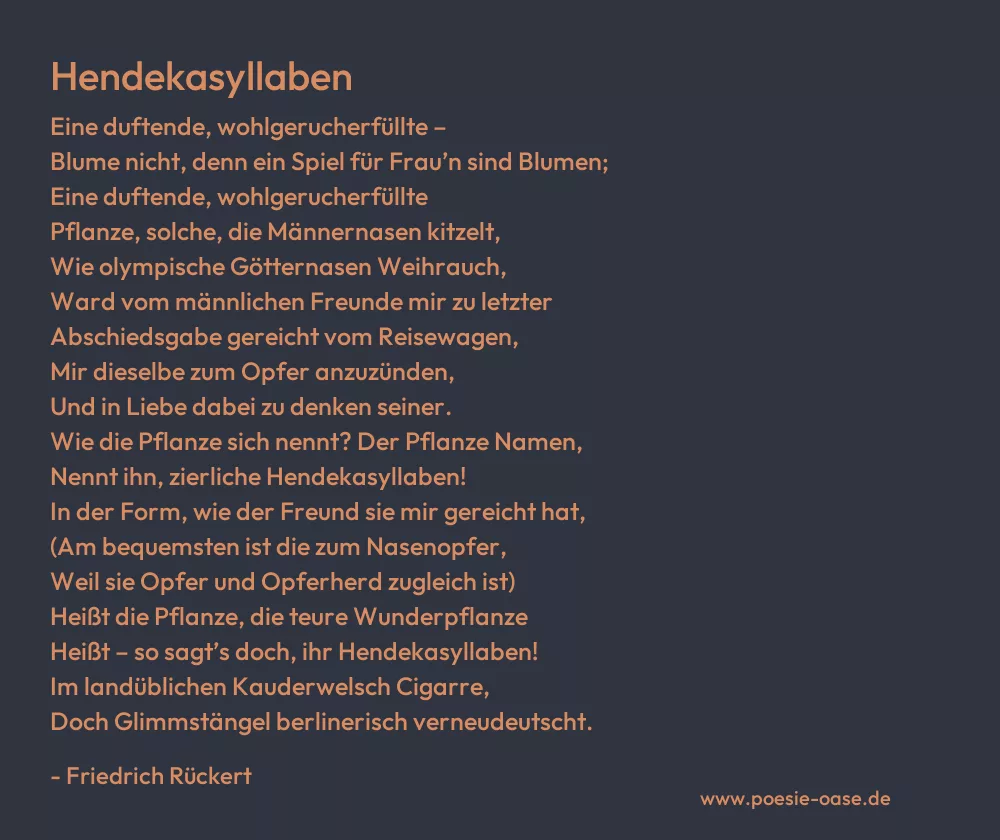
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hendekasyllaben“ von Friedrich Rückert ist eine humorvolle und zugleich kunstvolle Auseinandersetzung mit Sprache, Form und Alltagskultur. Rückert nutzt das klassische Versmaß der Hendekasyllaben – eine elf-silbige Zeile aus der antiken Dichtung – und stellt sie augenzwinkernd in den Dienst einer modernen Thematik: der Zigarrenraucherei.
Im Text wird eine duftende Pflanze besungen, die zunächst geheimnisvoll und ehrwürdig erscheint, ähnlich einem heiligen Opfer, das von olympischen Göttern empfangen wird. Erst nach und nach wird die wahre Identität dieser „Wunderpflanze“ enthüllt: Es handelt sich schlicht um eine Zigarre. Durch diese Ironisierung wird die Diskrepanz zwischen der hochstilisierten Form und dem profanen Inhalt spielerisch deutlich.
Das Gedicht reflektiert auf charmante Weise die Verbindung zwischen klassischer Bildung und zeitgenössischem Leben. Rückert zeigt, dass selbst scheinbar banale Gegenstände wie eine Zigarre durch poetische Sprache und kunstvolle Form eine Aufwertung erfahren können. Die Hendekasyllaben verleihen dem Text dabei eine feierliche und zugleich leichte Bewegung, die den Witz der Enthüllung umso stärker zur Geltung bringt.
Auffällig ist zudem der bewusste Umgang mit Sprache: Rückert spielt mit dem Gegensatz zwischen dem edlen Klang des Gedichts und der nüchternen, „verneudeutschten“ Bezeichnung „Glimmstängel“. So wird nicht nur der Gegenstand, sondern auch die Sprachentwicklung selbst auf humorvolle Weise kommentiert. Das Gedicht ist somit ein kleines Meisterstück im Umgang mit Form, Erwartung und Ironie.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.