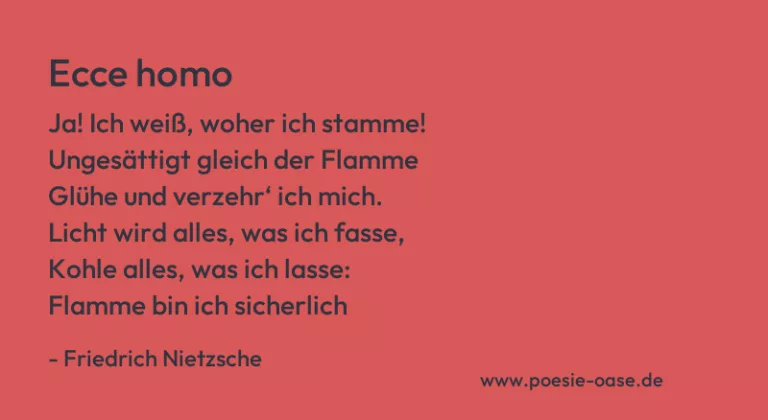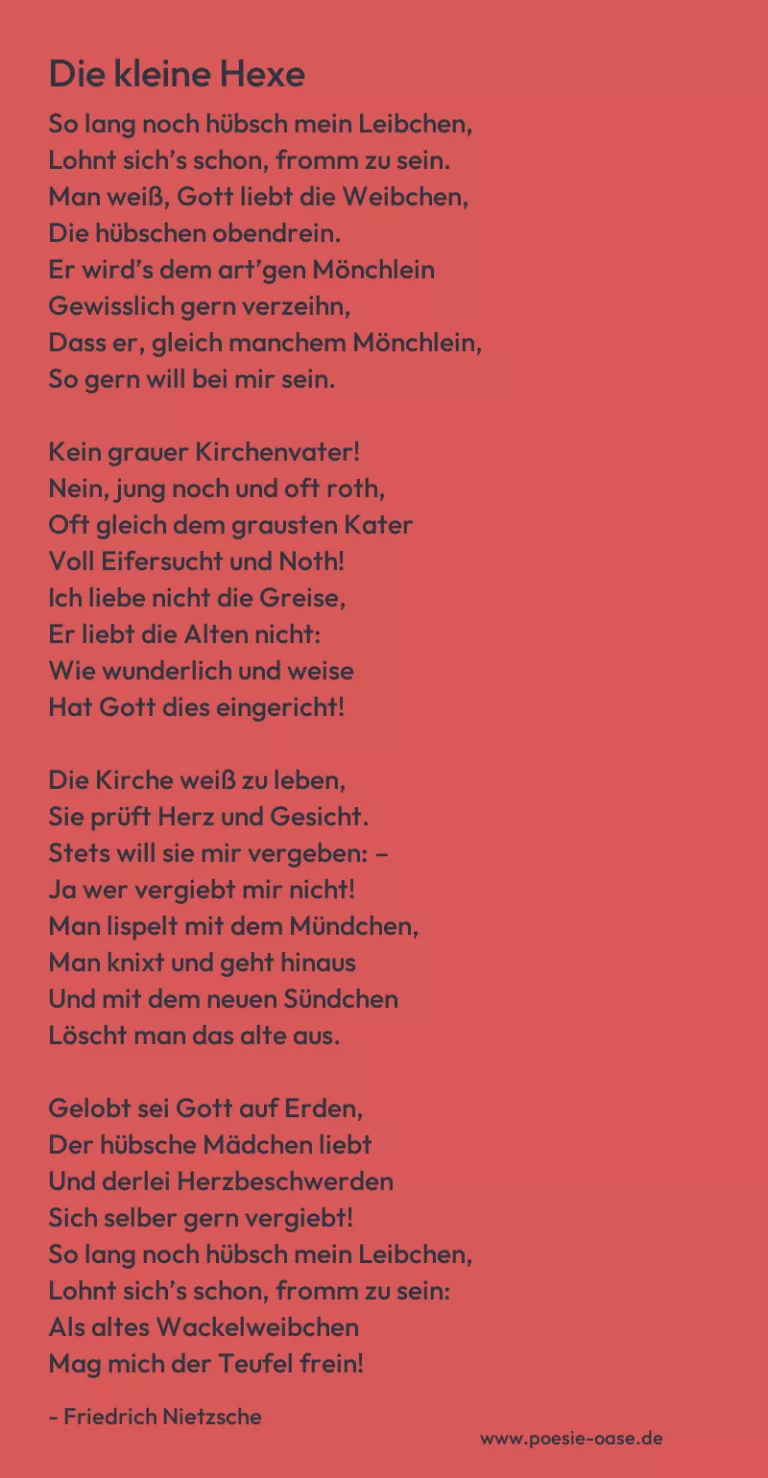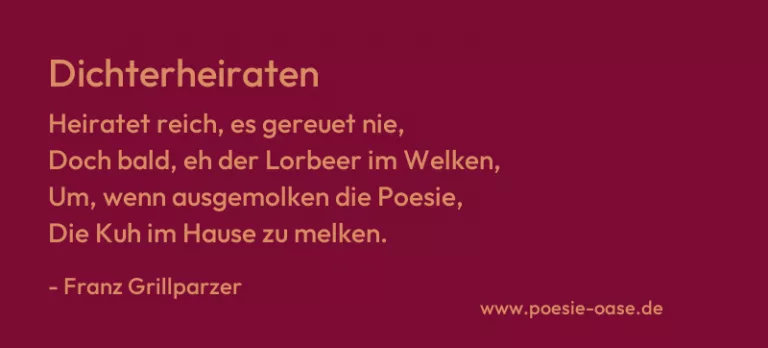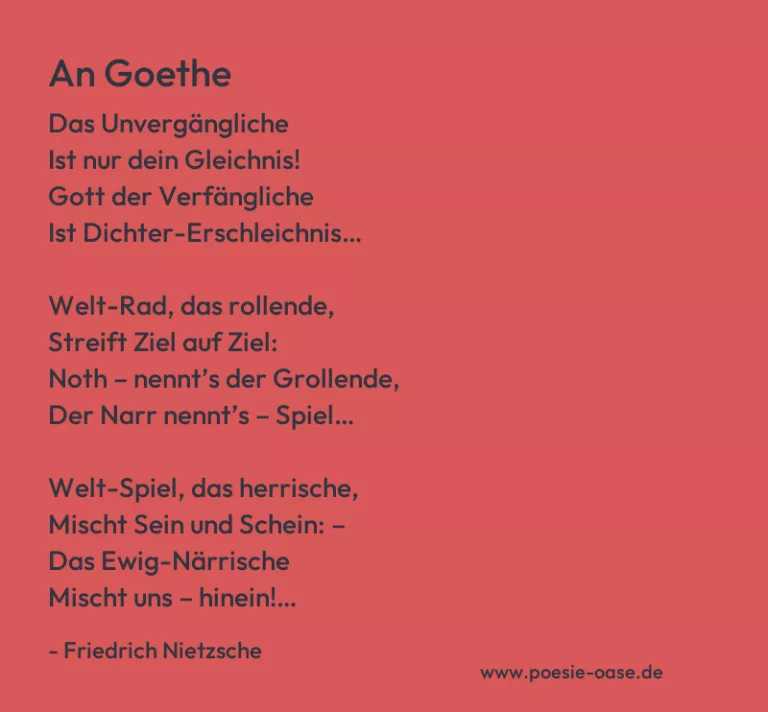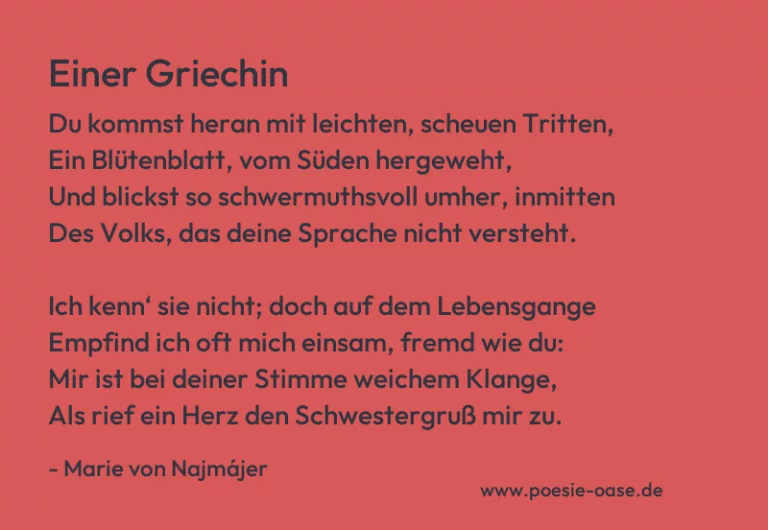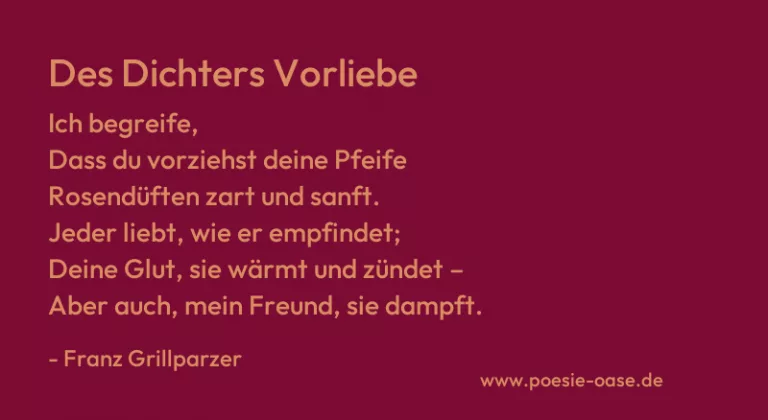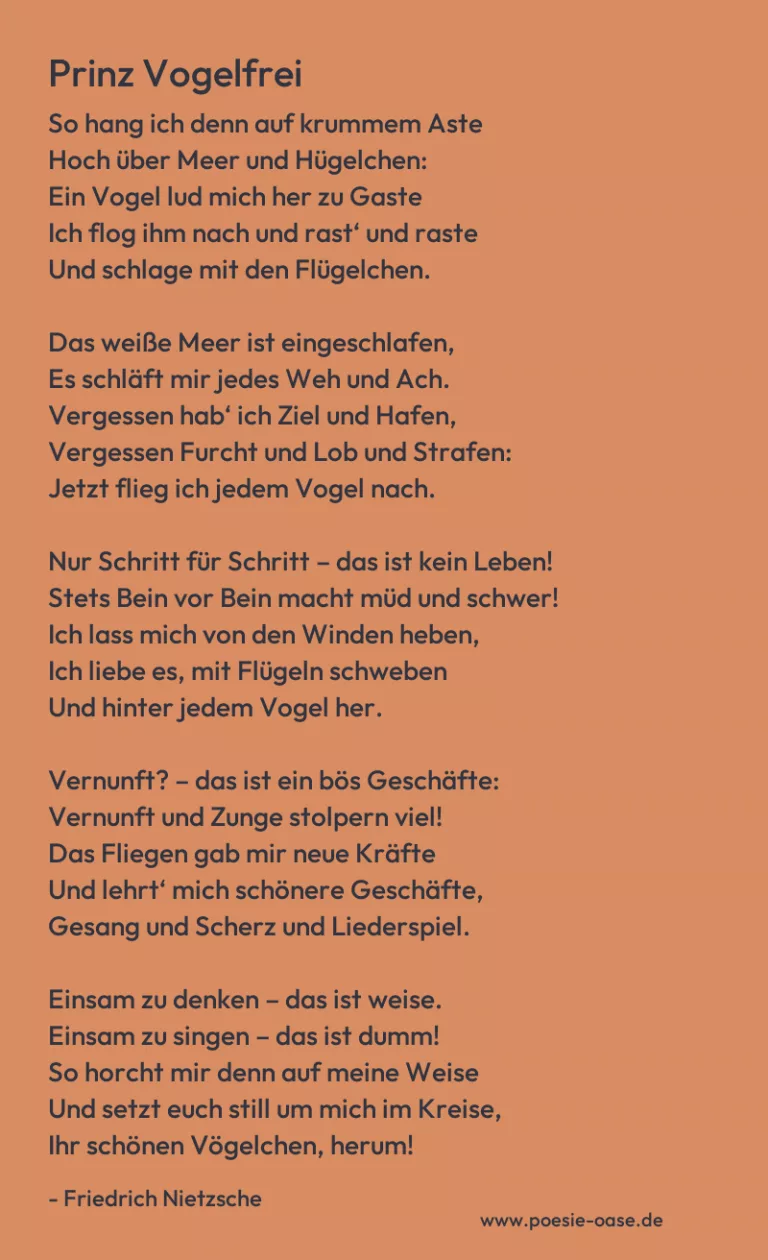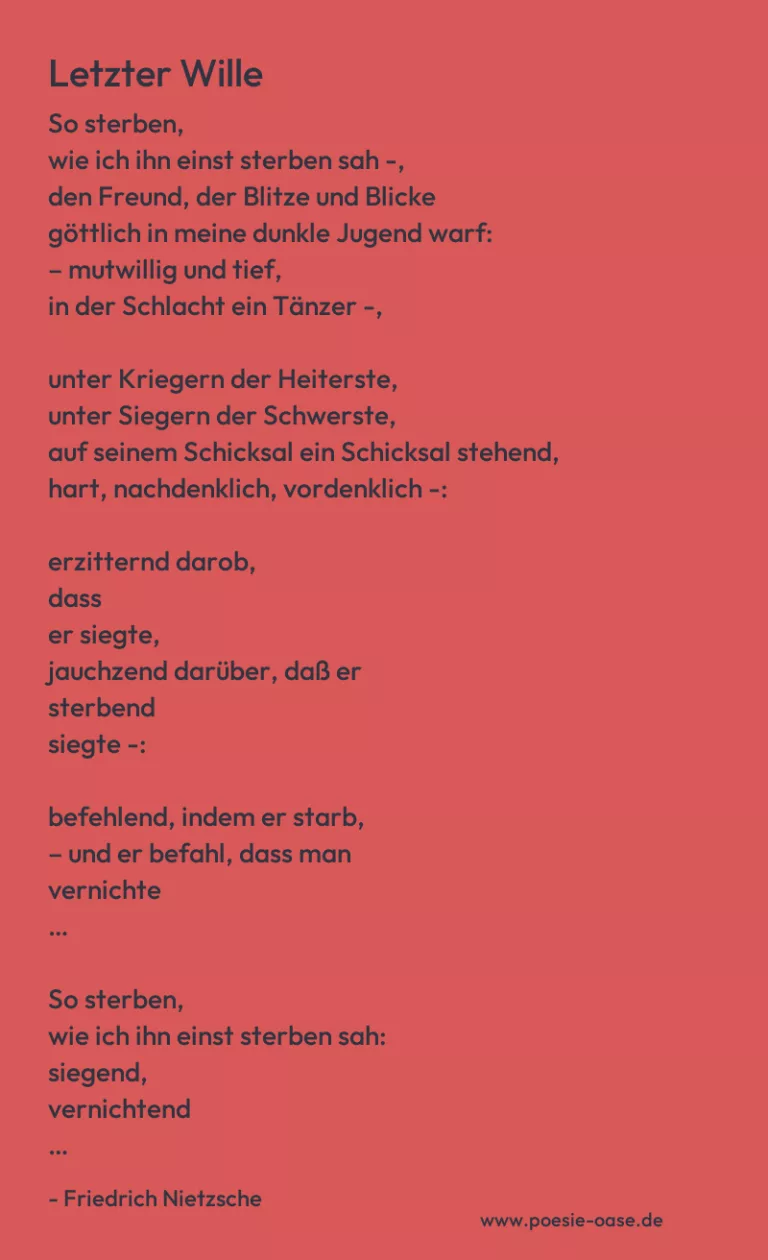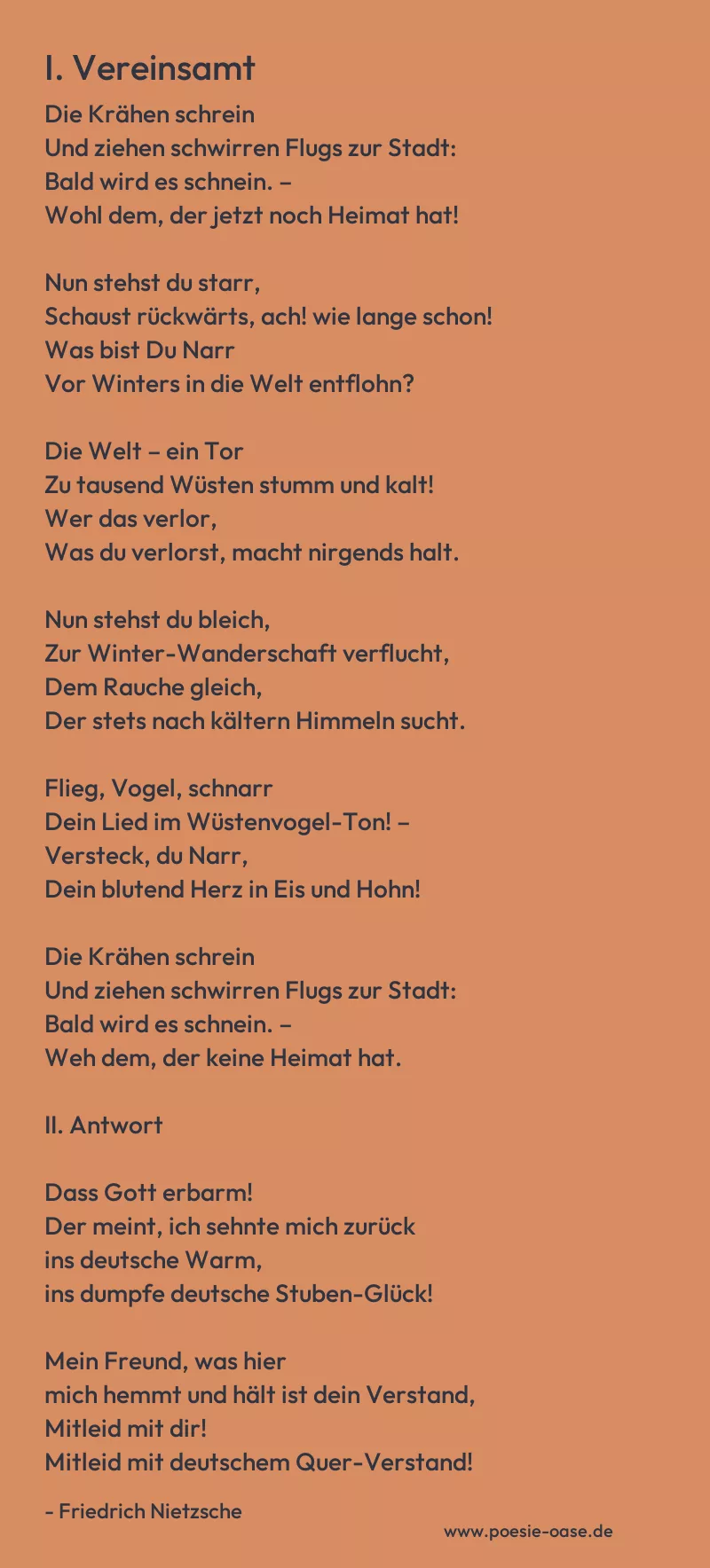I. Vereinsamt
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein. –
Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat!
Nun stehst du starr,
Schaust rückwärts, ach! wie lange schon!
Was bist Du Narr
Vor Winters in die Welt entflohn?
Die Welt – ein Tor
Zu tausend Wüsten stumm und kalt!
Wer das verlor,
Was du verlorst, macht nirgends halt.
Nun stehst du bleich,
Zur Winter-Wanderschaft verflucht,
Dem Rauche gleich,
Der stets nach kältern Himmeln sucht.
Flieg, Vogel, schnarr
Dein Lied im Wüstenvogel-Ton! –
Versteck, du Narr,
Dein blutend Herz in Eis und Hohn!
Die Krähen schrein
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnein. –
Weh dem, der keine Heimat hat.
II. Antwort
Dass Gott erbarm!
Der meint, ich sehnte mich zurück
ins deutsche Warm,
ins dumpfe deutsche Stuben-Glück!
Mein Freund, was hier
mich hemmt und hält ist dein Verstand,
Mitleid mit dir!
Mitleid mit deutschem Quer-Verstand!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
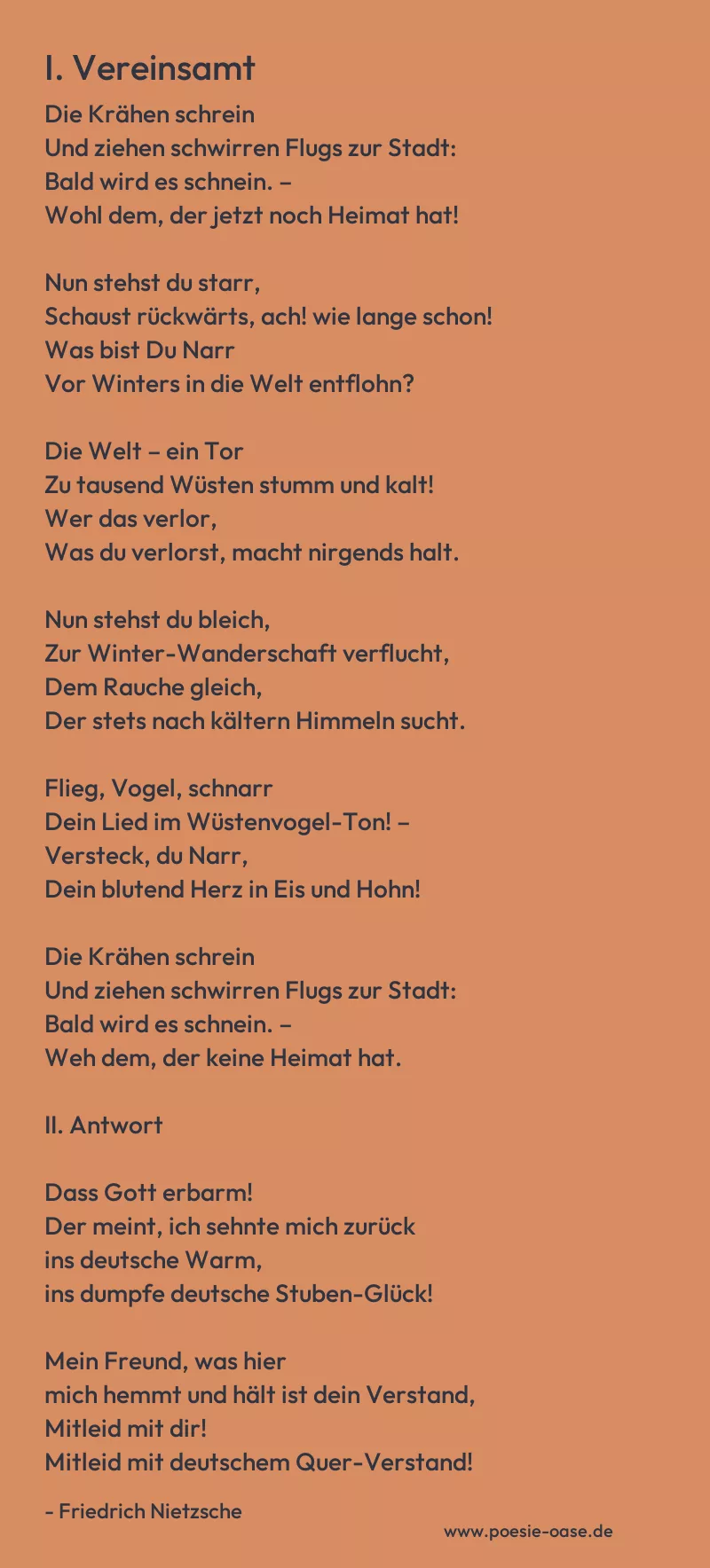
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „I. Vereinsamt“ von Friedrich Nietzsche zeichnet in düsterer, eindringlicher Bildsprache das Schicksal eines vereinsamten Menschen, der in der kalten, leeren Welt keinen Halt mehr findet. Es ist eines der bekanntesten Gedichte Nietzsches und steht exemplarisch für die existenzielle Einsamkeit, das Außenseitertum und die metaphysische Kälte, die viele seiner Texte durchziehen. Im Kontrast dazu steht das kurze Gegengedicht „II. Antwort“, in dem Nietzsche mit scharfem Spott auf eine vermeintlich sentimentale Lesart reagiert. Zusammen entfalten die beiden Teile ein vielschichtiges poetisches Selbstbild zwischen Tragik und Trotz.
In „Vereinsamt“ wird die Natur als Spiegel innerer Verlorenheit genutzt. Die krächzenden Krähen, die sich zur Stadt hin aufmachen, kündigen den Winter und den Schnee an – ein Sinnbild für Kälte, Rückzug und Vereinsamung. Die wiederholte Wendung „Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat!“ markiert den zentralen Kontrast: Heimatlosigkeit ist gleichbedeutend mit einem existenziellen Ausgeliefertsein an die Kälte des Daseins. Das lyrische Ich erscheint als Narr, der sich zu früh und zu unbedacht von Wärme und Geborgenheit entfernt hat.
Die Welt wird als „Tor zu tausend Wüsten“ beschrieben – ein Bild, das auf Nietzsches Philosophie des Nihilismus verweist. Wer wie der Sprecher seine „Heimat“ (im übertragenen Sinn: Glauben, Sinn, Orientierung) verloren hat, für den ist überall Wüste: stumm, kalt, trostlos. Das Bild des Rauchs, der sich nach immer kälteren Himmeln richtet, unterstreicht diese Rastlosigkeit. Es gibt keinen Rückzugsort mehr, keine Wiederkehr – nur ein ruheloses Weiterziehen in abweisende Leere.
In der letzten Strophe tritt die Verzweiflung offen zutage: Der einsame Wanderer wird zum Wüstenvogel, der nur noch in einem scharfen, schnarrenden Ton singen kann – einem Lied von Schmerz, Hohn und unterdrücktem Gefühl. Das Herz ist blutend, doch es wird hinter Eis und Spott verborgen. Der letzte Vers spiegelt den Anfang, doch das „Weh dem“ ersetzt nun das frühere „Wohl dem“ – das Leid der Heimatlosigkeit wird endgültig ausgesprochen.
„II. Antwort“ ist wie ein nachträglicher Einschub, der mit beißender Ironie eine falsche Interpretation des ersten Gedichts abwehrt. Nietzsche distanziert sich hier von einer verklärenden Lesart, die seine Vereinsamung als Sehnsucht nach dem „deutschen Stuben-Glück“ missversteht. Stattdessen erklärt er, es sei Mitleid mit dem beschränkten Denken („Quer-Verstand“) seiner Mitmenschen, das ihn noch hemme – eine Kritik am deutschen Bildungsbürgertum, das er als engstirnig und geistig träge empfand.
Zusammen zeigen beide Texte das Spannungsfeld, in dem sich Nietzsche bewegt: einerseits die tiefe Einsamkeit des radikal Denkenden, andererseits die bewusste, oft trotzige Abkehr von der Herde. Das Gedicht ist Ausdruck existenziellen Leidens und zugleich ein Bekenntnis zur geistigen Freiheit – auch wenn sie mit Schmerz, Isolation und „blutendem Herzen“ erkauft ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.