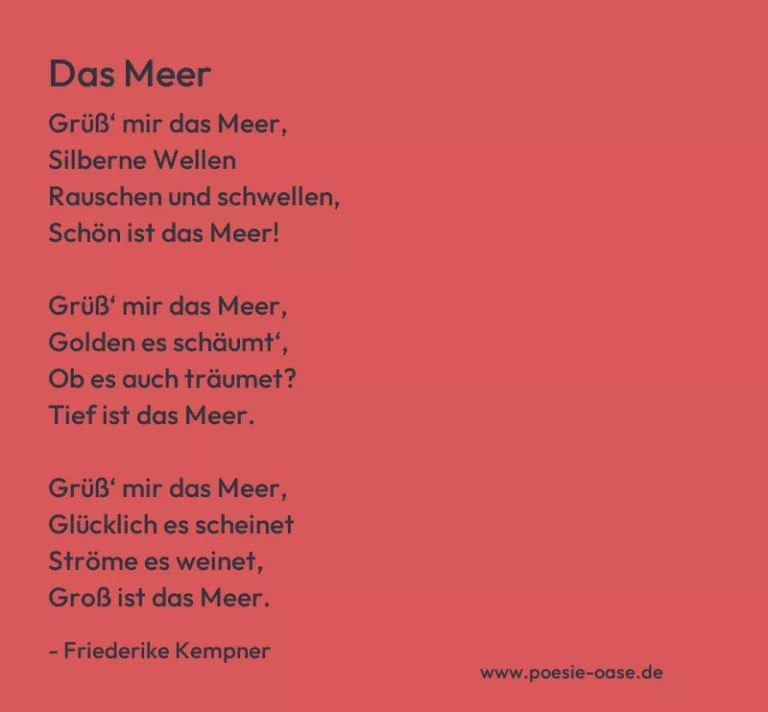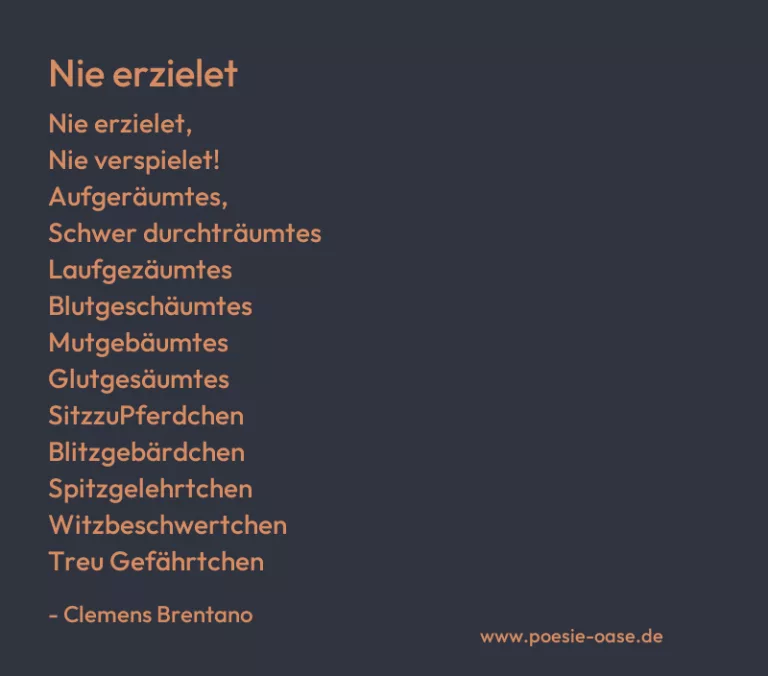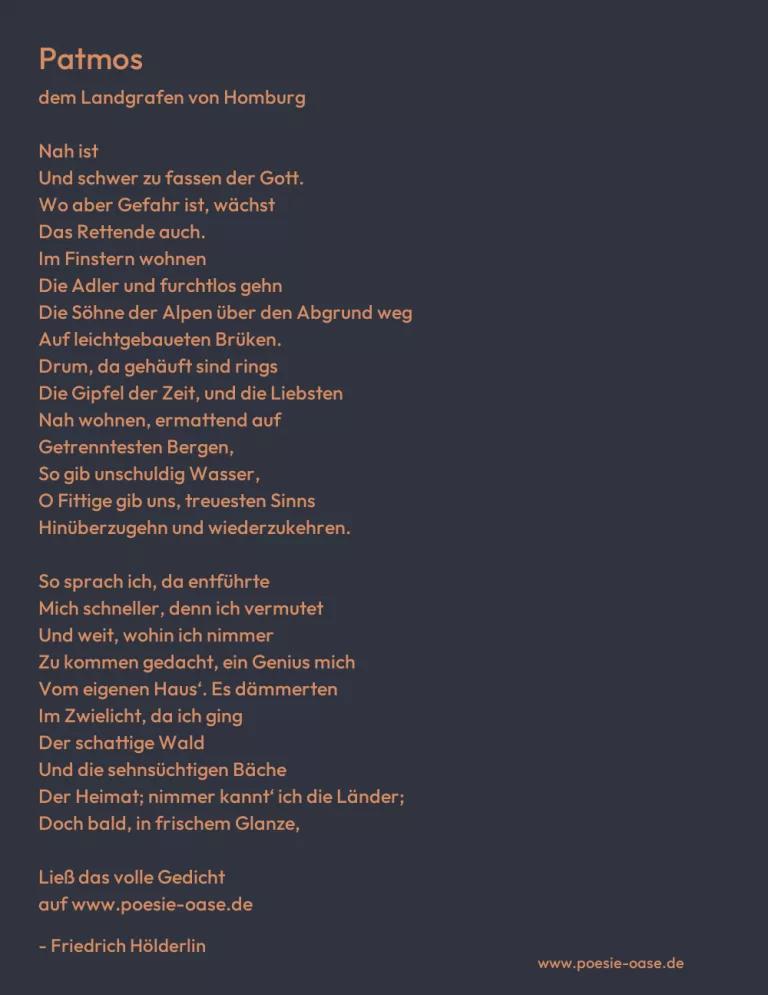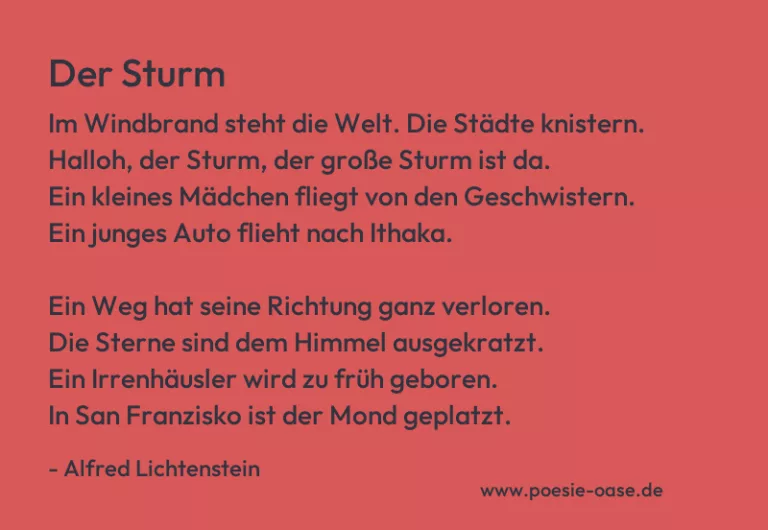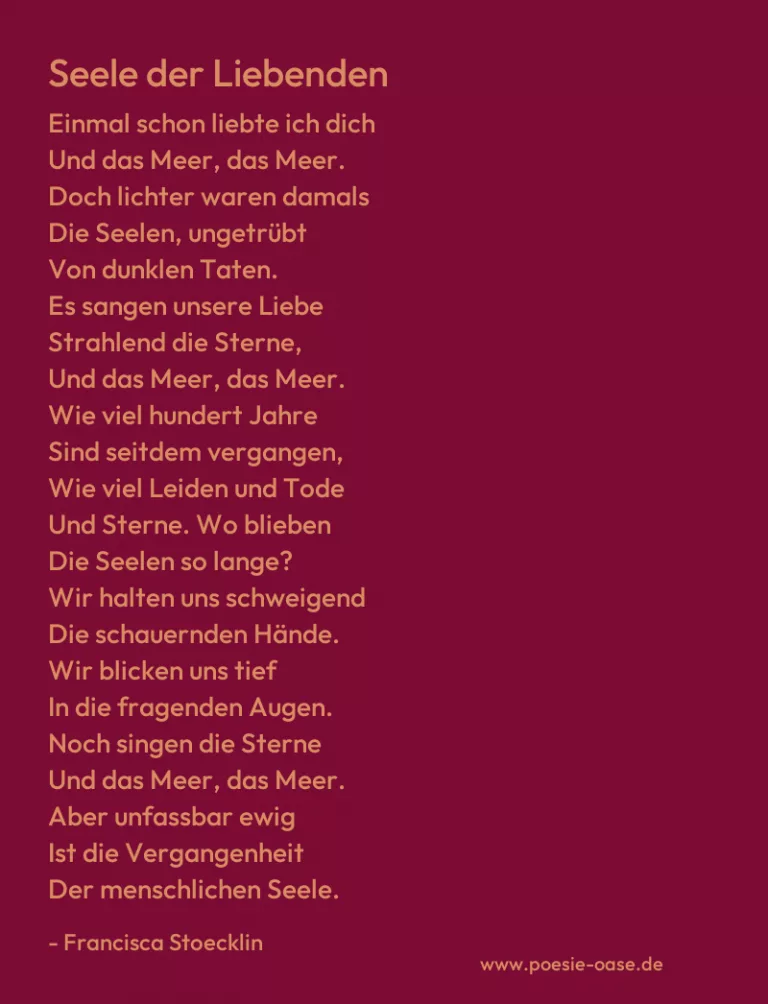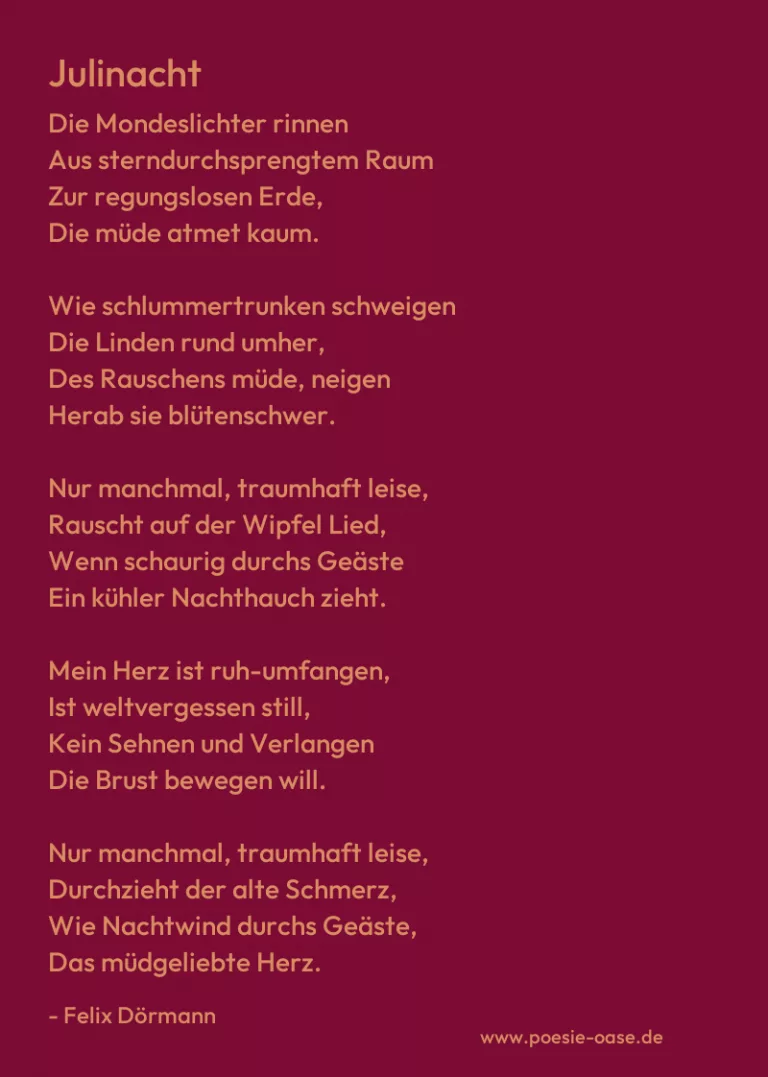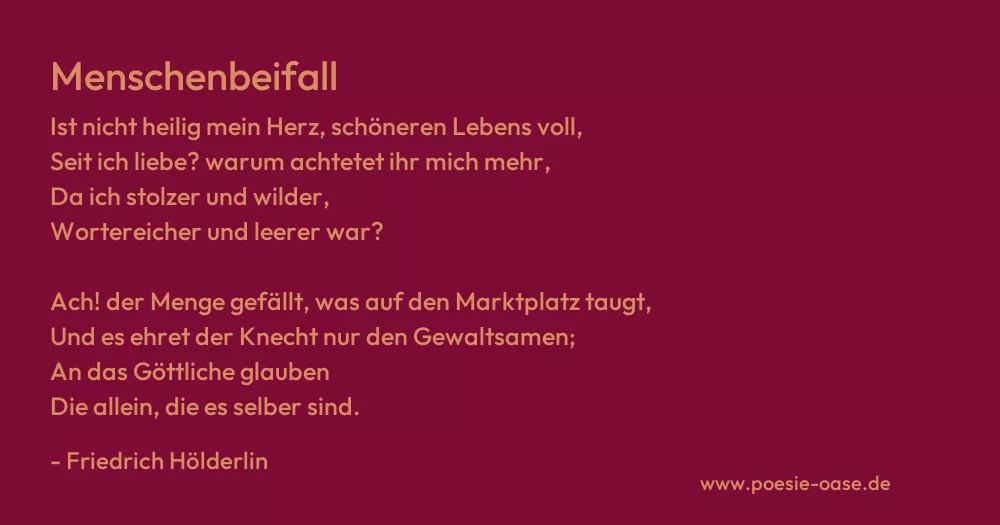Menschenbeifall
Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
Seit ich liebe? warum achtetet ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war?
Ach! der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
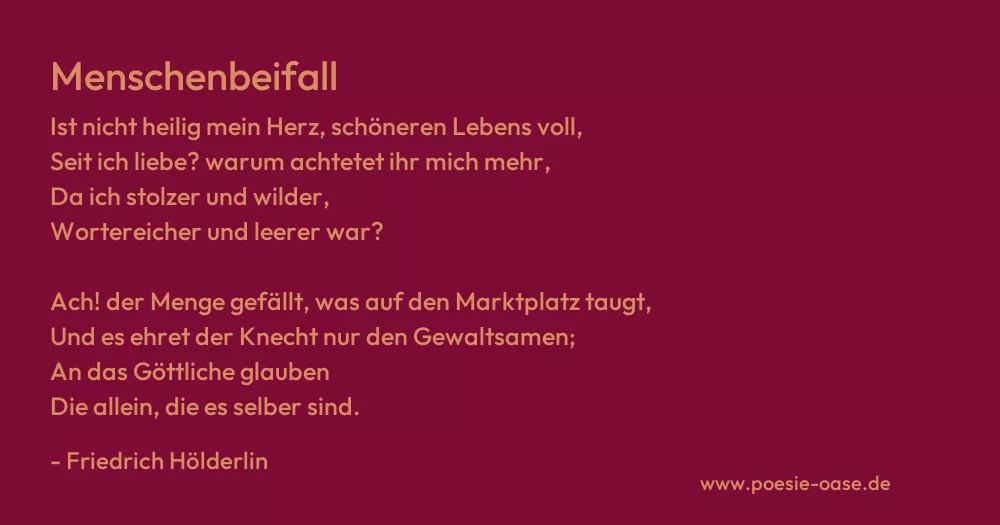
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Menschenbeifall“ von Friedrich Hölderlin thematisiert die Entfremdung des Dichters von der oberflächlichen Gesellschaft und stellt eine Reflexion über wahre Größe und innere Erfüllung dar. Im Zentrum steht die kritische Gegenüberstellung von äußerer Anerkennung und innerem Wachstum, insbesondere durch die Erfahrung der Liebe.
Das lyrische Ich beginnt mit der Feststellung, dass sein Herz durch die Liebe „heiliger“ und „schöneren Lebens voll“ geworden sei. Die rhetorische Frage macht deutlich, dass diese innere Wandlung für die Außenwelt unsichtbar geblieben ist. Die Menschen schätzten den Sprecher vielmehr in einer früheren, „stolzeren“ und „wilderen“ Lebensphase, als er noch „wortreicher und leerer“ war – eine Kritik an der oberflächlichen Beurteilung durch die Gesellschaft, die äußere Stärke und Lautstärke mehr bewundert als echte Tiefe.
Im zweiten Teil wird die Kritik an der „Menge“ noch zugespitzt: Das, was auf dem „Marktplatz“, also in der Öffentlichkeit, wirkt und laut erscheint, gefällt der Masse. Der Begriff „Knecht“ verweist auf die Unterwürfigkeit und das Bedürfnis nach Machtanbetung; nur der „Gewaltsame“ wird geehrt, nicht der wahrhaft Edle.
Die letzten beiden Zeilen enthalten die Kernaussage des Gedichts: „An das Göttliche glauben / Die allein, die es selber sind.“ Damit deutet Hölderlin an, dass nur jene, die in sich selbst das Göttliche, das Wahre und Erhabene tragen, auch wirklich daran glauben und es erkennen können. Das Gedicht wird so zu einer Abrechnung mit dem oberflächlichen Beifall der Massen und zu einer Feier der inneren Wahrhaftigkeit, die sich durch Liebe und echte Geistigkeit offenbart.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.