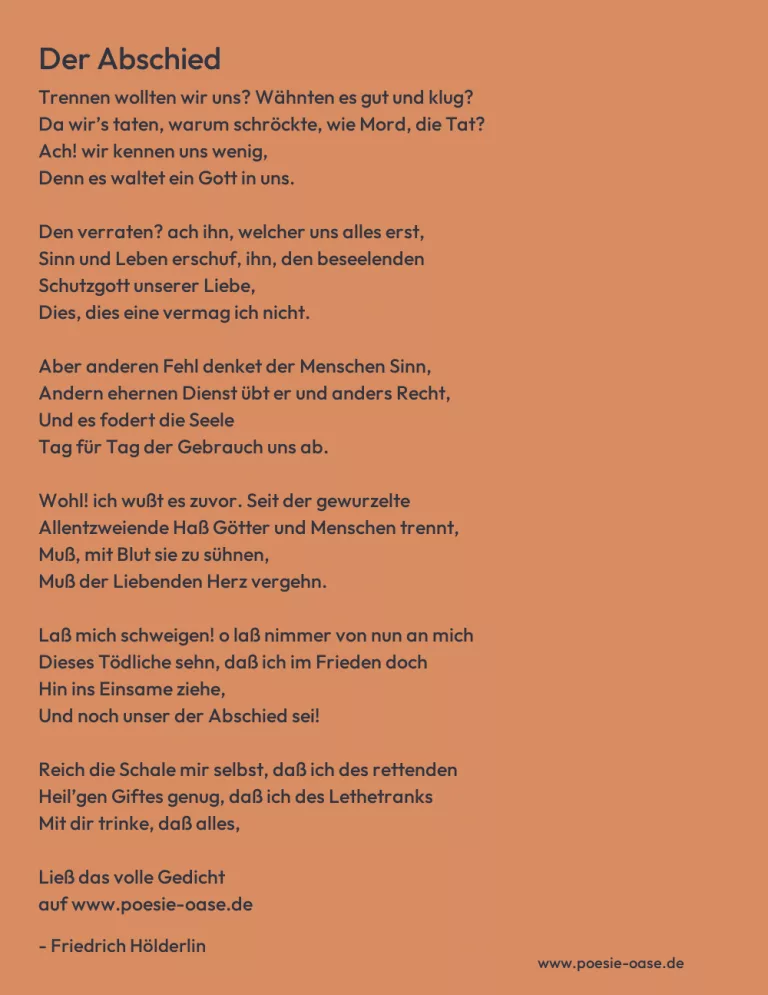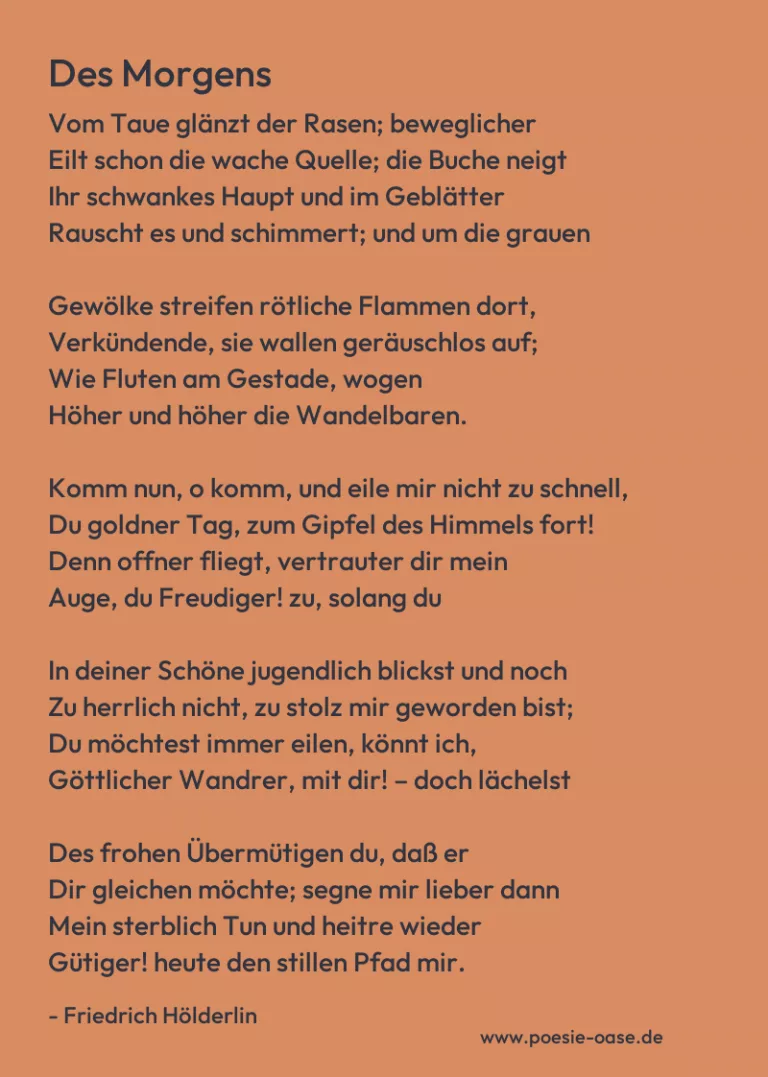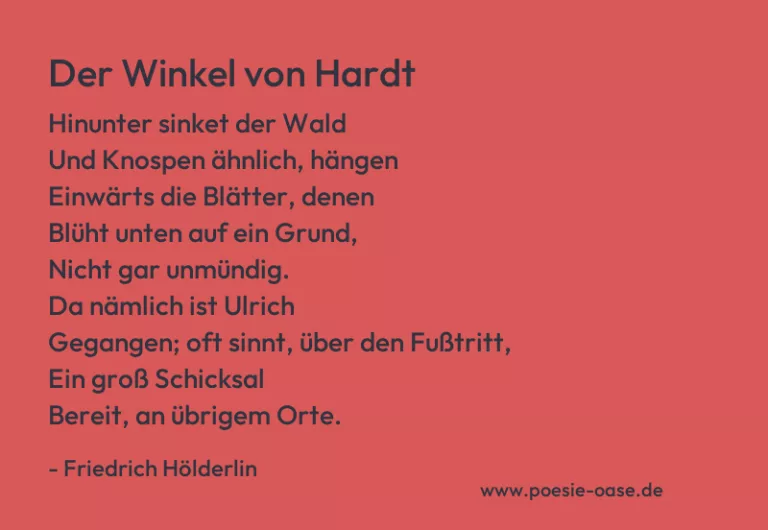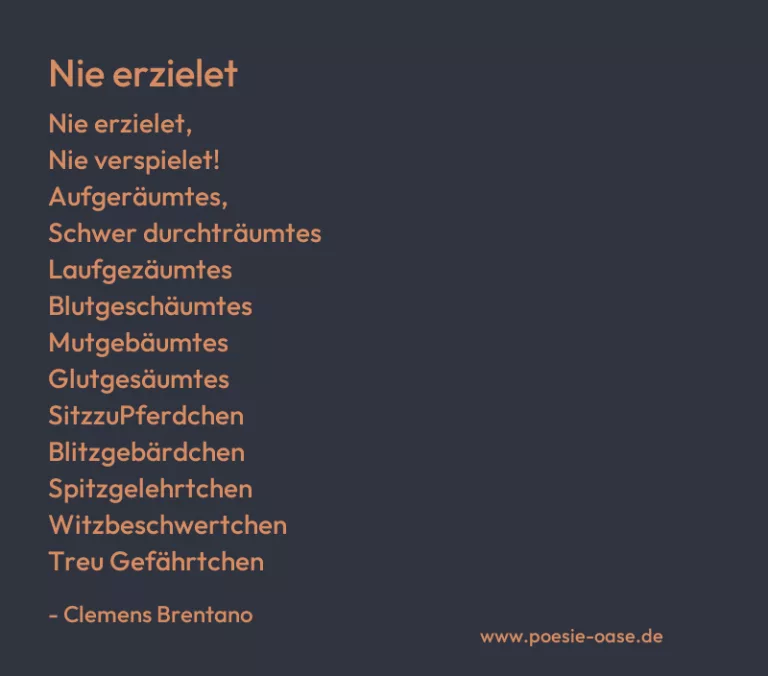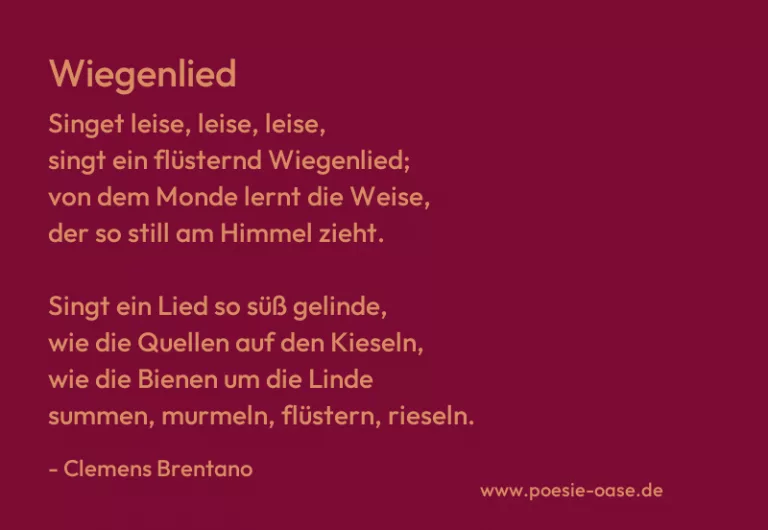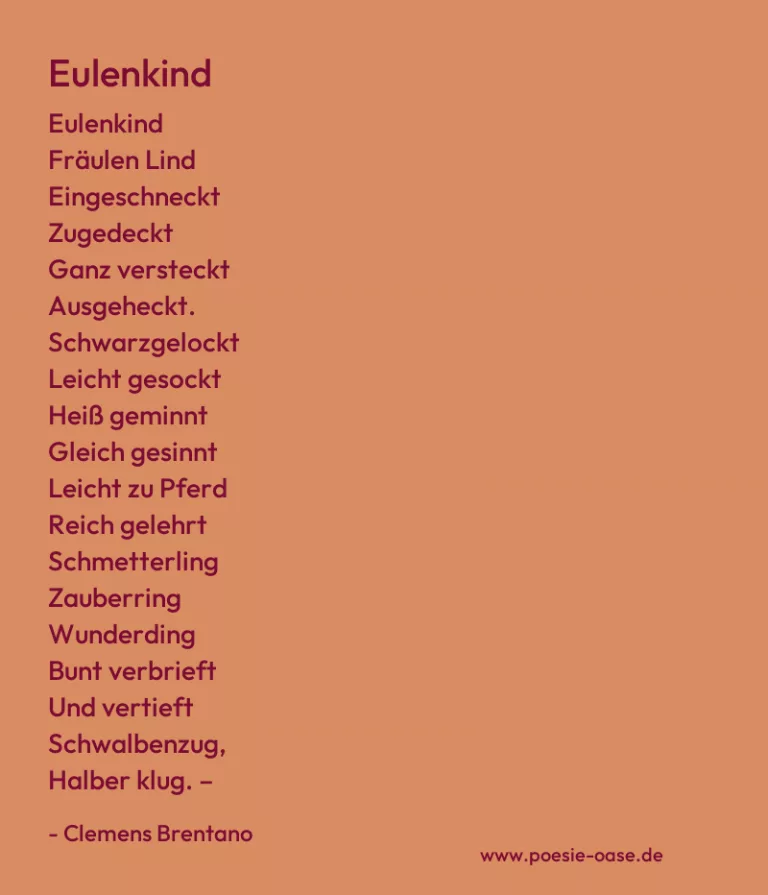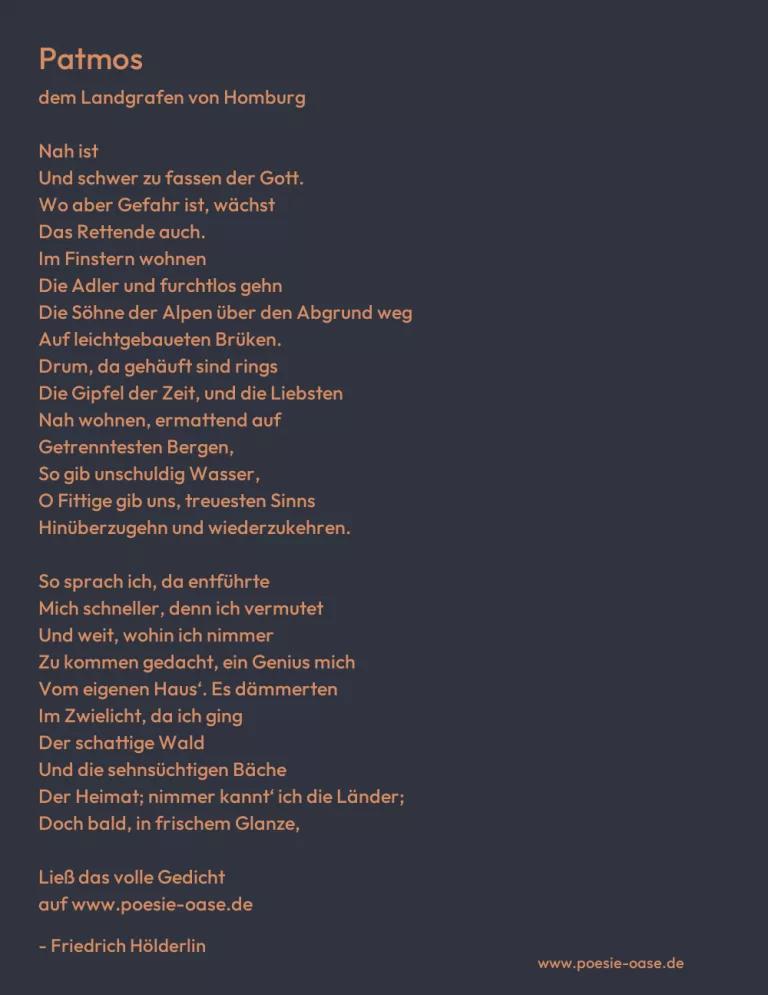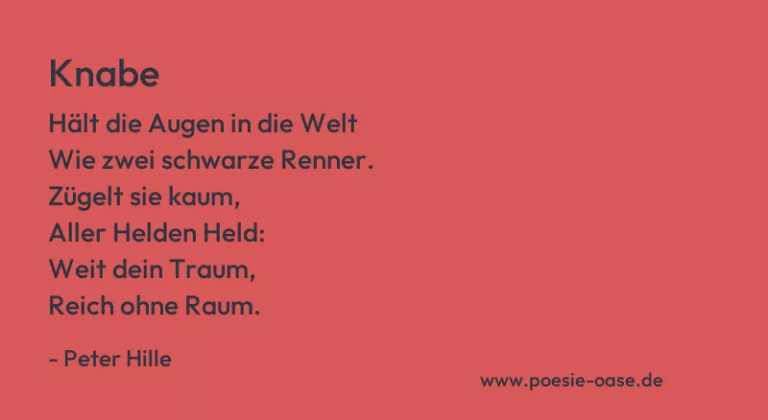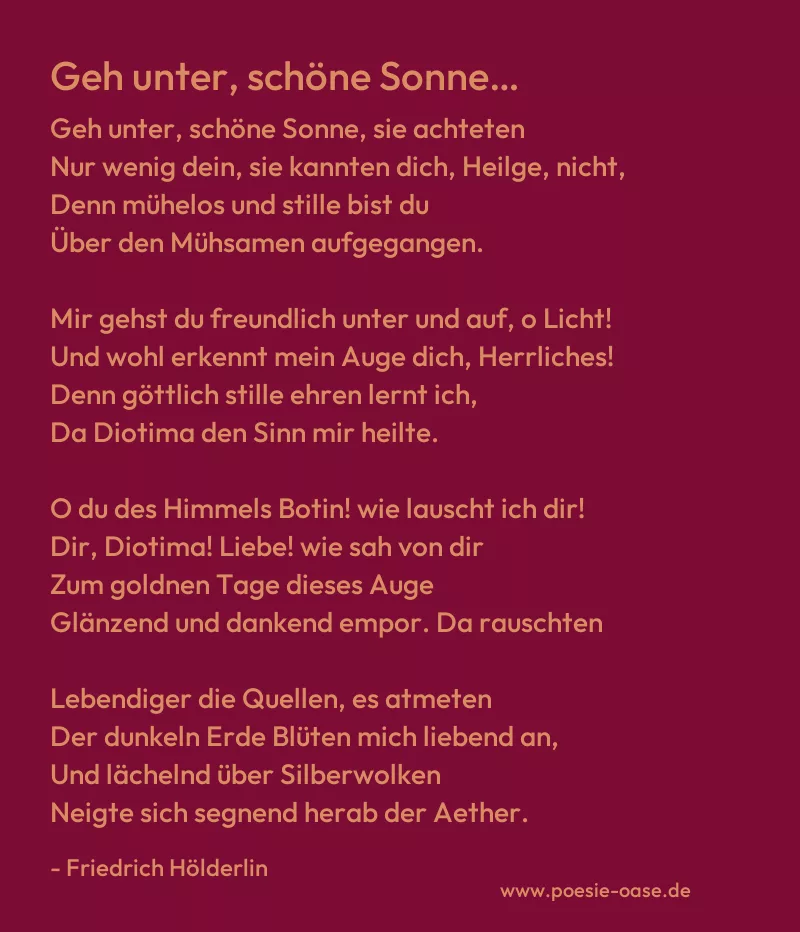Geh unter, schöne Sonne…
Geh unter, schöne Sonne, sie achteten
Nur wenig dein, sie kannten dich, Heilge, nicht,
Denn mühelos und stille bist du
Über den Mühsamen aufgegangen.
Mir gehst du freundlich unter und auf, o Licht!
Und wohl erkennt mein Auge dich, Herrliches!
Denn göttlich stille ehren lernt ich,
Da Diotima den Sinn mir heilte.
O du des Himmels Botin! wie lauscht ich dir!
Dir, Diotima! Liebe! wie sah von dir
Zum goldnen Tage dieses Auge
Glänzend und dankend empor. Da rauschten
Lebendiger die Quellen, es atmeten
Der dunkeln Erde Blüten mich liebend an,
Und lächelnd über Silberwolken
Neigte sich segnend herab der Aether.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
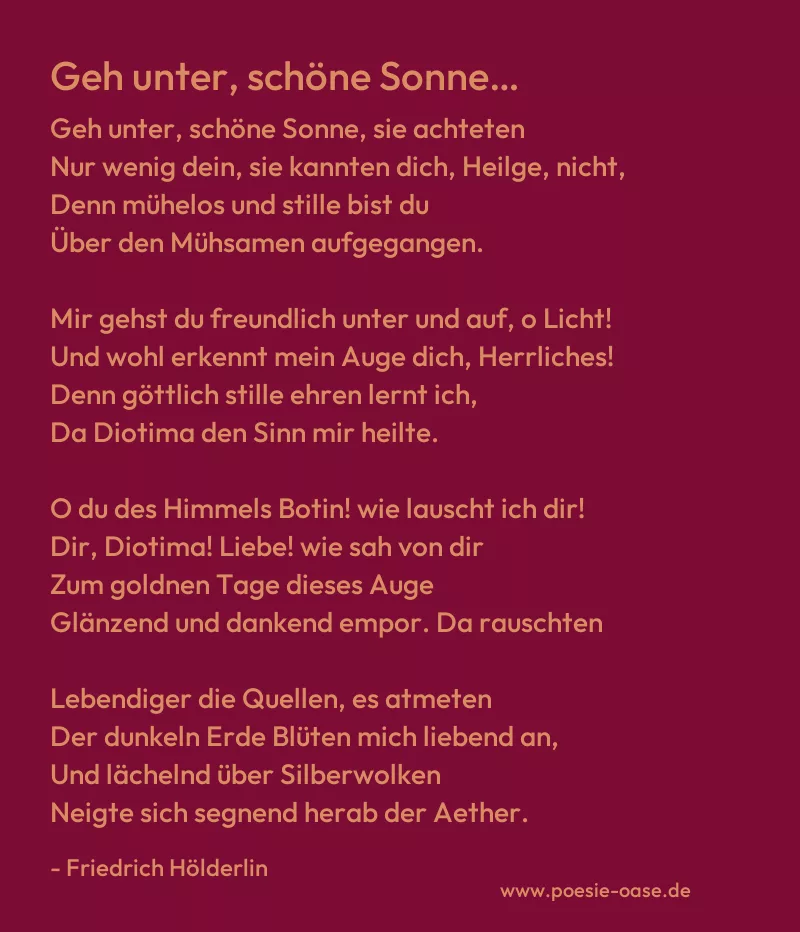
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Geh unter, schöne Sonne…“ von Friedrich Hölderlin thematisiert die spirituelle und sinnliche Erweckung des lyrischen Ichs durch die Liebe und die Schönheit der Natur. Die Sonne wird dabei zum Symbol für das Göttliche und Erhabene, das vom gewöhnlichen Menschen verkannt, vom Sprecher jedoch tief empfunden und verstanden wird.
In den ersten Versen beklagt das lyrische Ich, dass die Menschen die Heiligkeit der Sonne nicht zu würdigen wissen. Sie leben in Mühe und Unachtsamkeit, während die Sonne ruhig und übermächtig über ihnen steht. Diese Distanz zwischen der göttlichen Natur und den „Mühsamen“ wird durch den Kontrast zwischen der „stille[n]“ Sonne und den „Mühsamen“ betont.
Mit der Erwähnung von Diotima – einer weisen Frau aus Hölderlins Werk – erfährt die Deutung eine Wendung. Diotima steht hier als Verkörperung der Liebe und spirituellen Erkenntnis. Durch sie hat das lyrische Ich gelernt, die göttliche Stille und Schönheit zu erkennen und zu verehren. Die Liebe zu Diotima öffnet ihm die Augen für das „Herrliche“, die tiefere Bedeutung des Lichts und der Natur.
In den letzten Strophen wird die Verbindung zwischen Natur, Liebe und Spiritualität weiter verdichtet. Das Ich erlebt die Natur intensiver und lebendiger: Quellen „rauschen“, Blüten „atmen“ ihn „liebend an“ und der „Aether“ neigt sich „segnend“ herab. Diese Naturbeschreibung ist von einer fast mystischen Harmonie durchdrungen und zeigt, wie sehr das Ich sich durch die Liebe und die spirituelle Erkenntnis mit der Natur und dem Göttlichen verbunden fühlt.
Hölderlins Gedicht verknüpft somit das Motiv der erhabenen Natur mit der heilenden Kraft der Liebe und betont die Fähigkeit des Einzelnen, durch innere Läuterung und Hingabe eine tiefere Wahrheit und Schönheit in der Welt zu erkennen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.