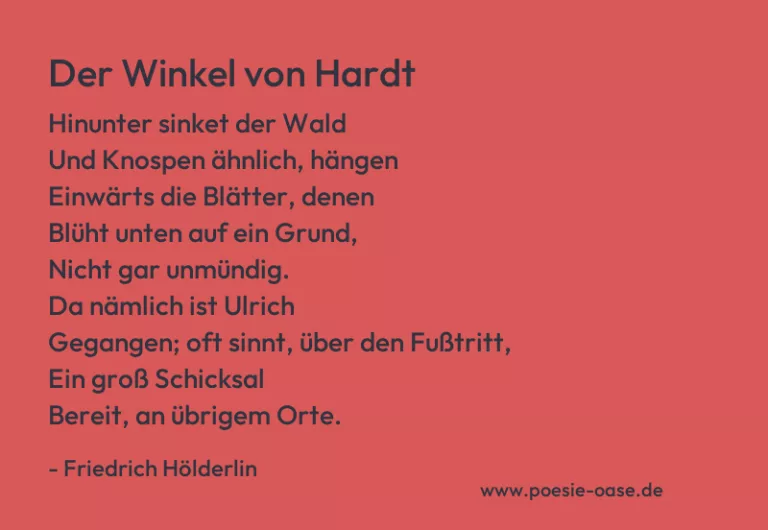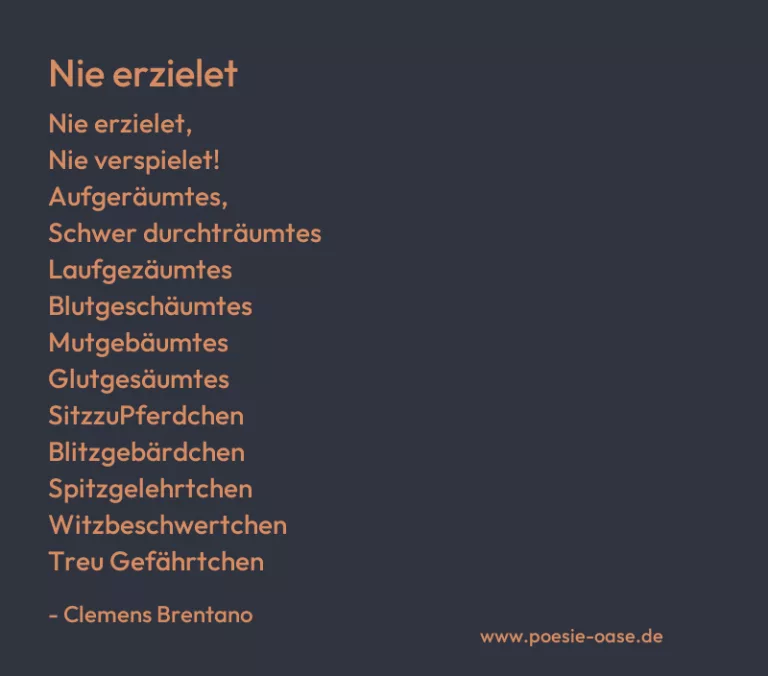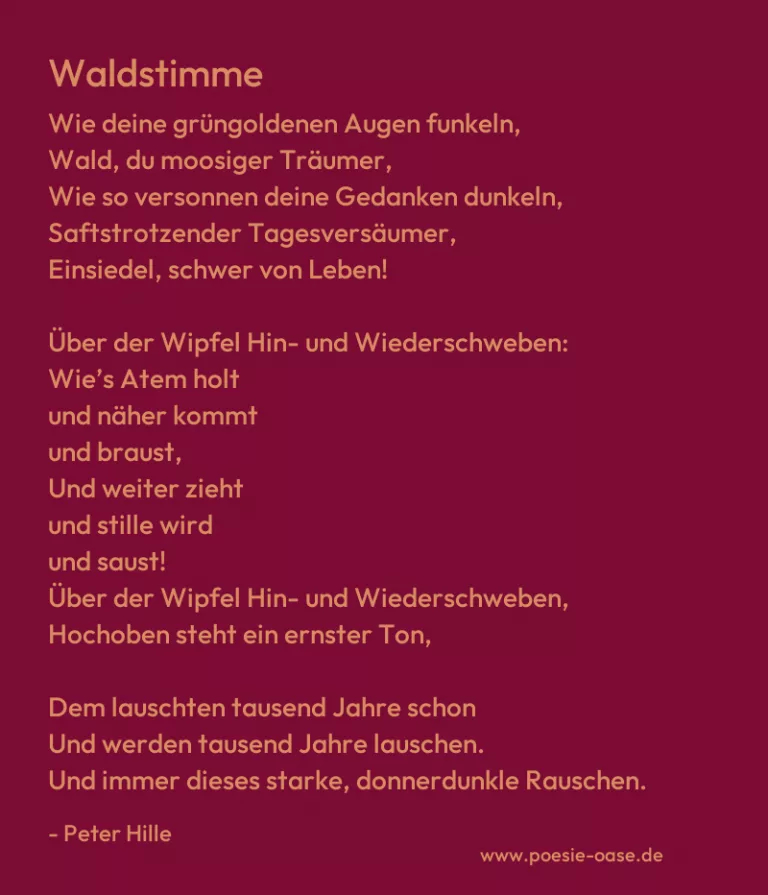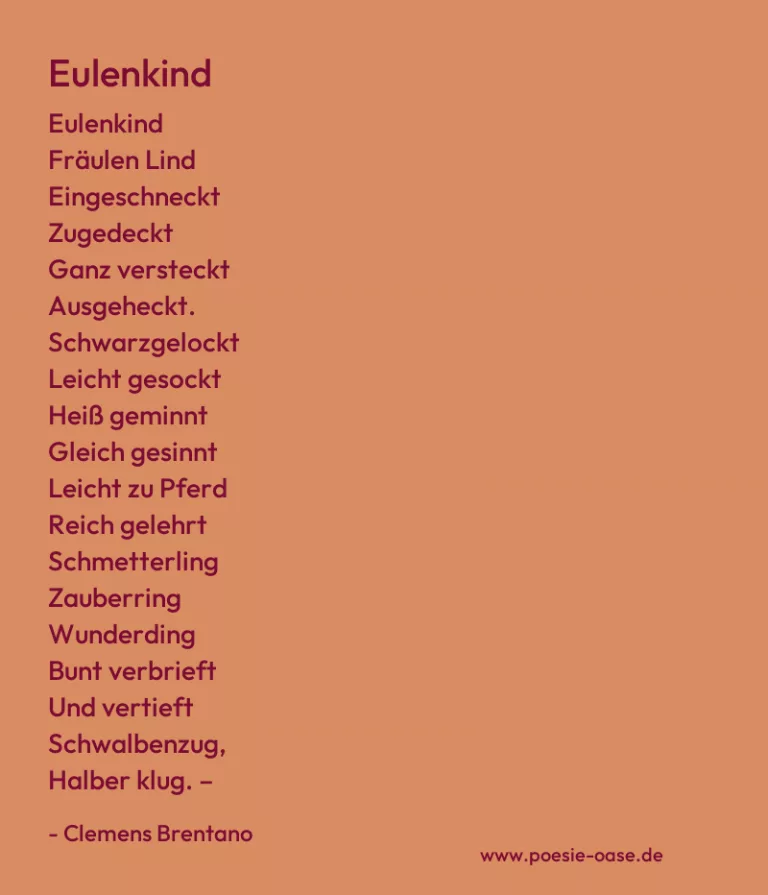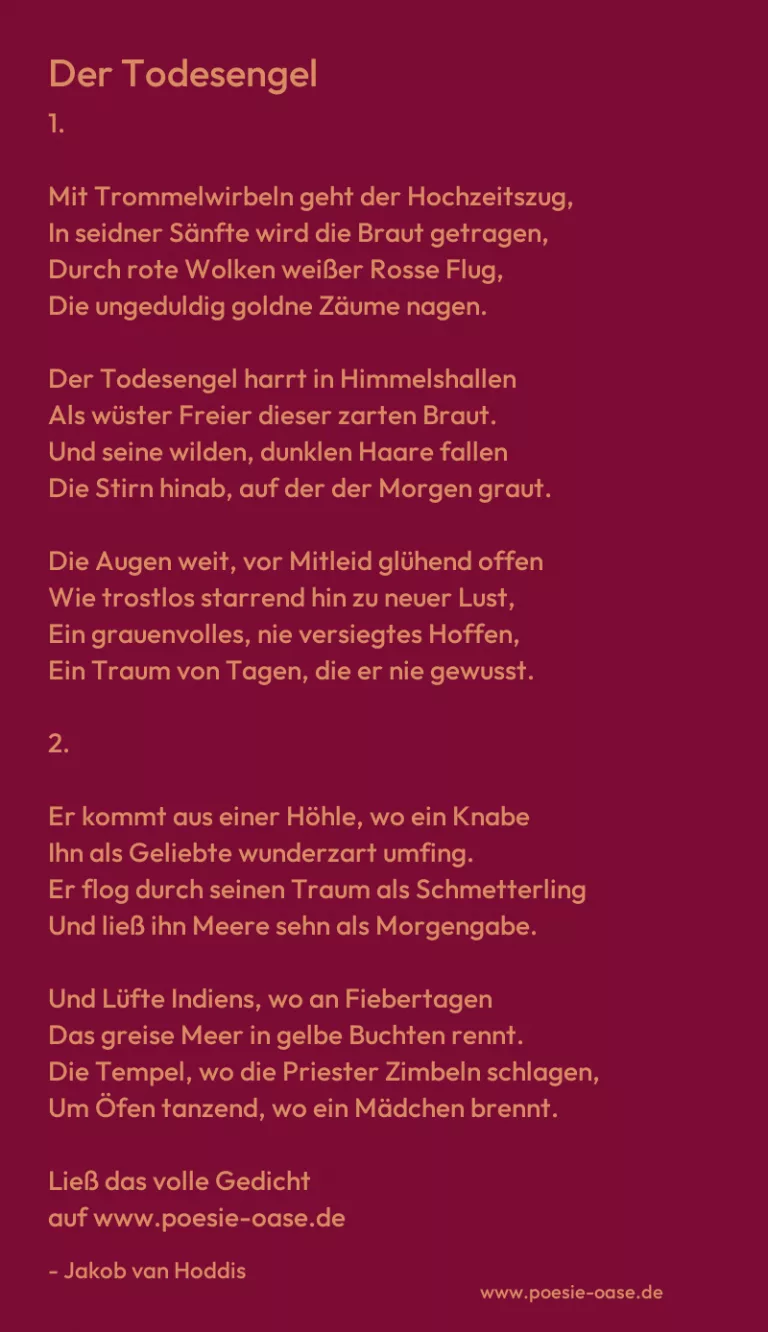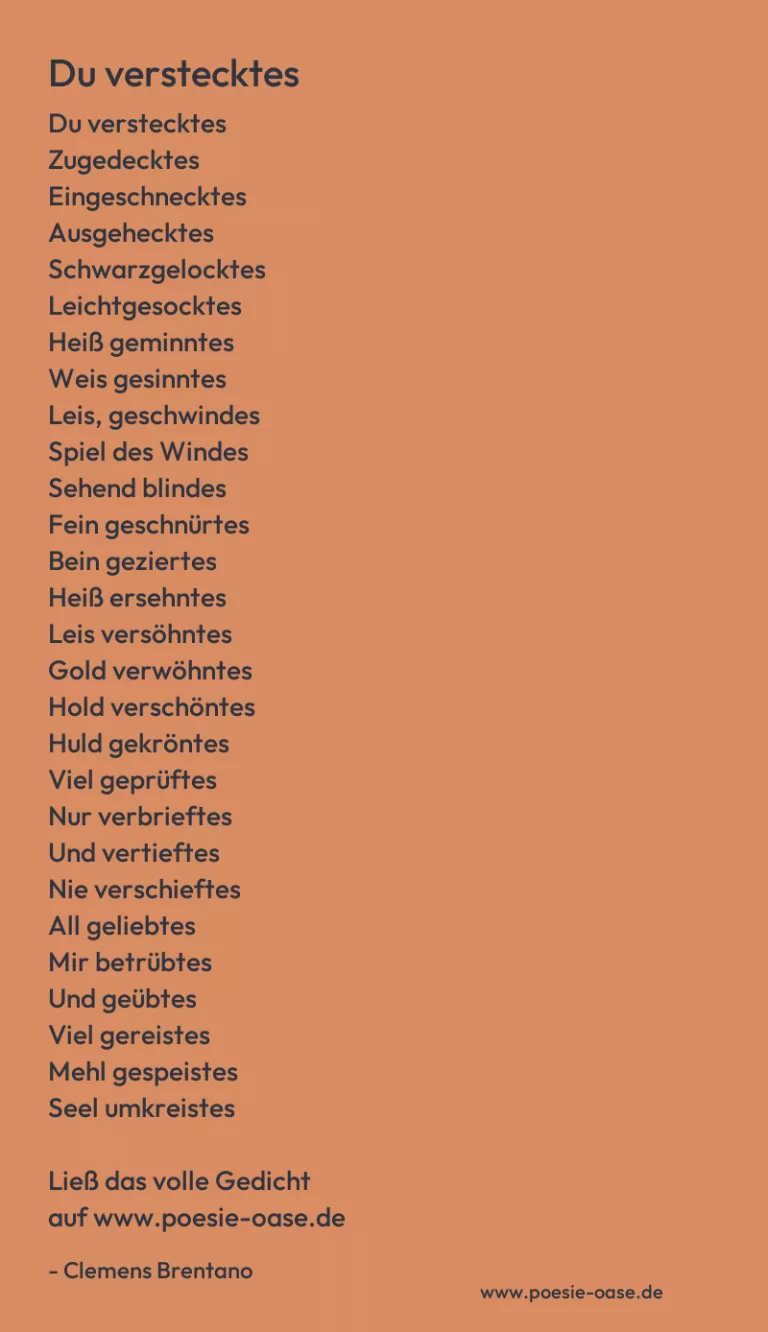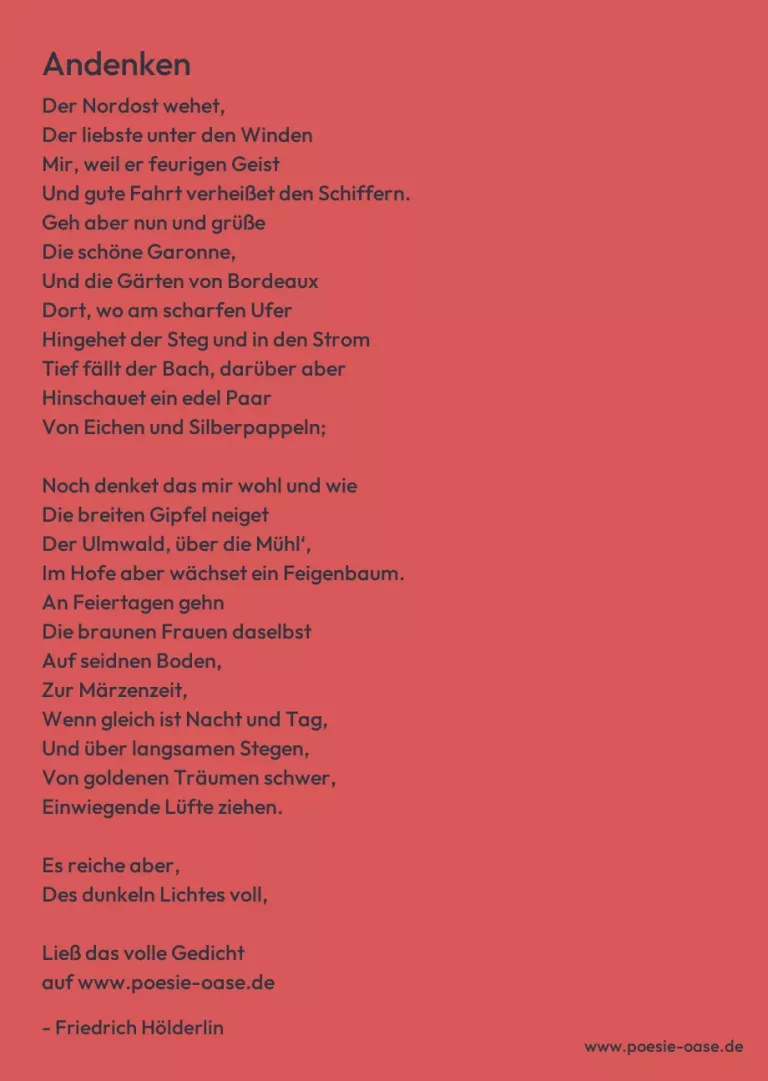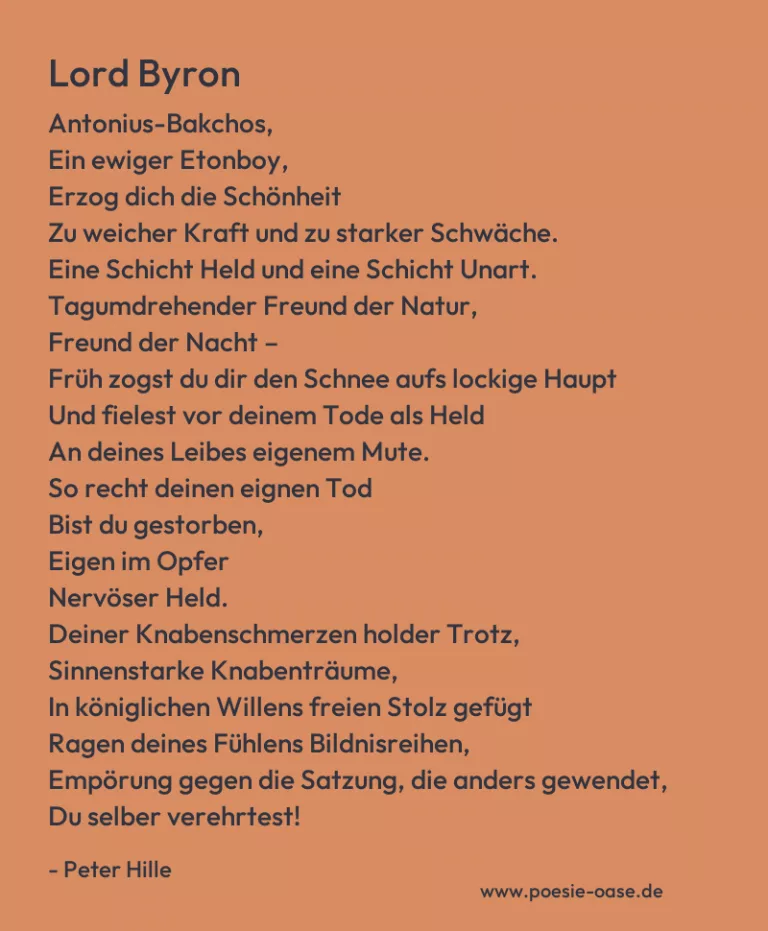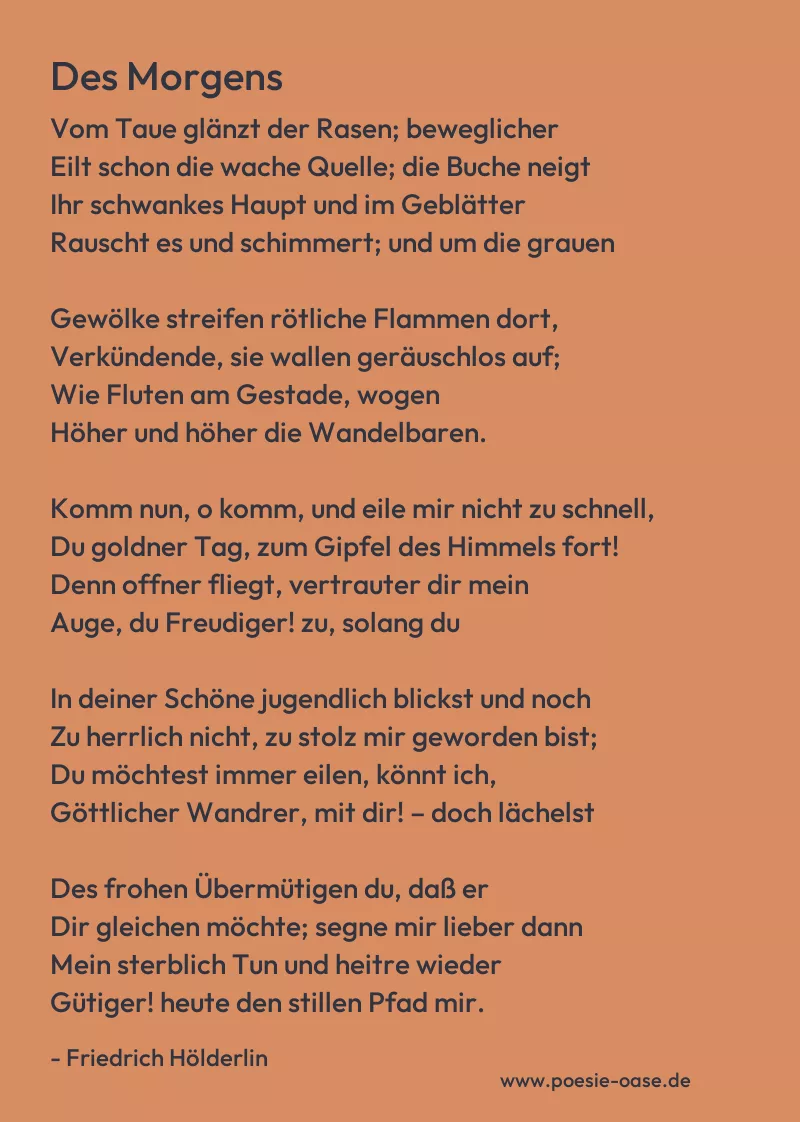Des Morgens
Vom Taue glänzt der Rasen; beweglicher
Eilt schon die wache Quelle; die Buche neigt
Ihr schwankes Haupt und im Geblätter
Rauscht es und schimmert; und um die grauen
Gewölke streifen rötliche Flammen dort,
Verkündende, sie wallen geräuschlos auf;
Wie Fluten am Gestade, wogen
Höher und höher die Wandelbaren.
Komm nun, o komm, und eile mir nicht zu schnell,
Du goldner Tag, zum Gipfel des Himmels fort!
Denn offner fliegt, vertrauter dir mein
Auge, du Freudiger! zu, solang du
In deiner Schöne jugendlich blickst und noch
Zu herrlich nicht, zu stolz mir geworden bist;
Du möchtest immer eilen, könnt ich,
Göttlicher Wandrer, mit dir! – doch lächelst
Des frohen Übermütigen du, daß er
Dir gleichen möchte; segne mir lieber dann
Mein sterblich Tun und heitre wieder
Gütiger! heute den stillen Pfad mir.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
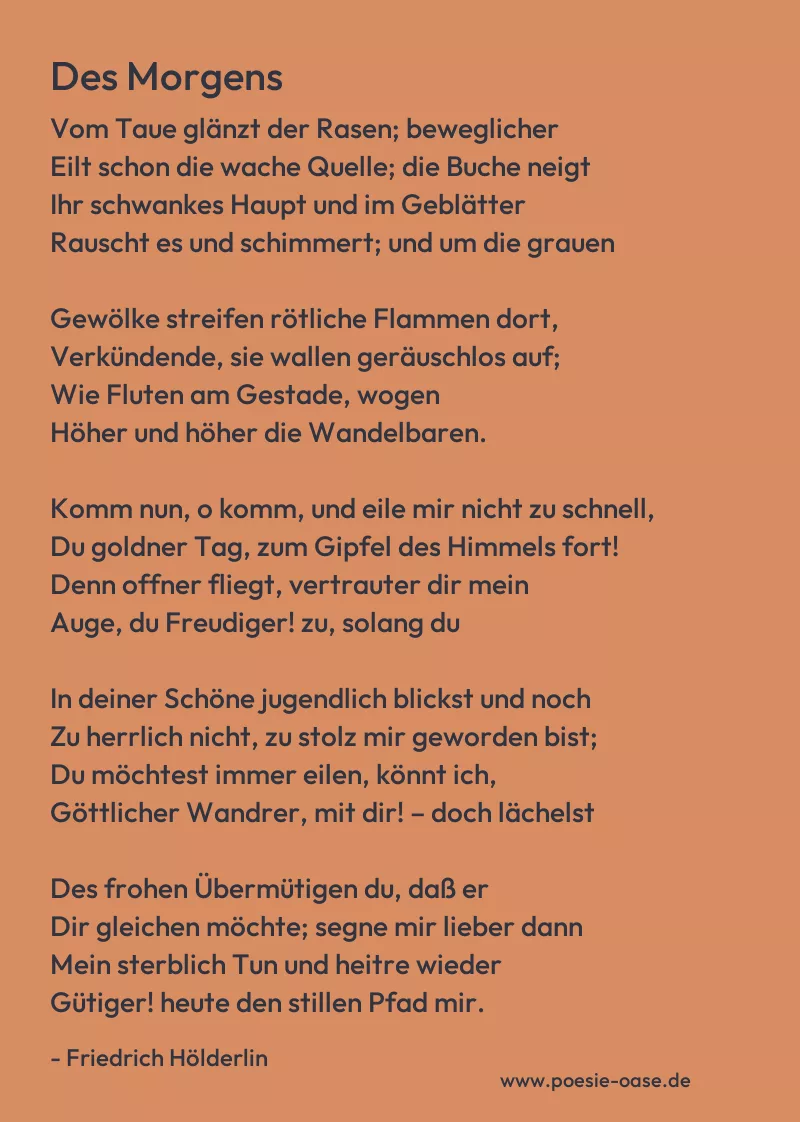
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Des Morgens“ von Friedrich Hölderlin beschreibt die Morgenstimmung mit einer lebendigen und fast mystischen Darstellung der Natur. Zu Beginn schildert der Sprecher den glänzenden, taufeuchten Rasen und die sprudelnde Quelle, die ein Bild der Frische und Erneuerung vermittelt. Die Buche, die ihr „schwankes Haupt“ neigt, sowie das Rauschen und Schimmern des Blätterwerks sind Zeichen der Lebendigkeit und der Bewegung der Natur zu Beginn des Tages. Diese Szenen sind von einer subtilen Dynamik geprägt, die den Übergang von der Nacht zum Tag und das Erwachen der Welt symbolisieren.
In der zweiten Strophe zieht der Sprecher die Aufmerksamkeit auf die „rötlichen Flammen“ der aufgehenden Sonne, die an den grauen Wolken vorbeistreifen und damit das Bild eines neuen, erleuchteten Tages erzeugen. Die „Wandelbaren“ – möglicherweise eine Metapher für die Wolken oder den Verlauf des Tages – werden als wogende Fluten dargestellt, die sich unaufhaltsam bewegen und damit die Unbeständigkeit und das stetige Werden des Lebens verdeutlichen. Diese dramatische Darstellung des Morgens vermittelt eine tiefere Verbundenheit mit der natürlichen Welt und deren ständigen Wandel.
Der Sprecher richtet sich dann an den „goldnen Tag“, der sich gerade entfaltet, und bittet ihn, nicht zu schnell zu vergehen. Das Bild des Tages als „göttlicher Wanderer“ verweist auf das idealisierte Bild eines perfekten Moments, der sowohl jugendlich als auch schön ist. Die Aufforderung, der Tag möge „noch nicht zu stolz“ werden, spricht von der Sehnsucht nach der Unbeschwertheit und Reinheit des Augenblicks, der noch in seiner vollen Frische und Unschuld erlebt wird. Der Sprecher wünscht sich, diesen Moment mit dem Tag zu teilen und den Verlauf der Zeit langsamer zu erleben, um die Schönheit und den Frieden des Morgens länger zu genießen.
In den letzten Zeilen gibt der Sprecher zu, dass der Wunsch, dem Tag gleichzukommen, übermütig ist, und er bittet den „göttlichen Wanderer“ darum, ihm in seiner Sterblichkeit gnädiger zu sein. Der Sprecher sehnt sich nach einer heiteren und freundlichen Begleitung durch den Tag, wobei er die Grenzen seines menschlichen Daseins anerkennt. Diese Bitte um Segen und eine „gütige“ Führung auf dem „stillen Pfad“ des Lebens zeigt eine tiefe Demut und das Streben nach innerer Ruhe, die im Einklang mit der natürlichen Welt und ihrer unaufhaltsamen Veränderung steht.
Das Gedicht thematisiert die Vergänglichkeit des Lebens und die Schönheit des Moments, während es gleichzeitig die Sehnsucht nach einer friedlichen, harmonischen Begleitung durch die Zeit ausdrückt. Hölderlin verbindet die lebendigen Bilder der Natur mit der menschlichen Erfahrung und lässt dabei die Idee von göttlicher Begleitung und der natürlichen Ordnung durchscheinen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.