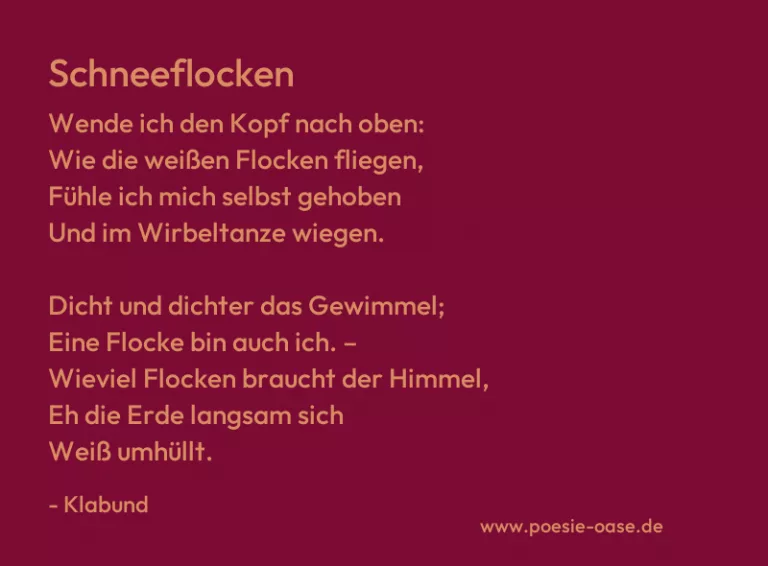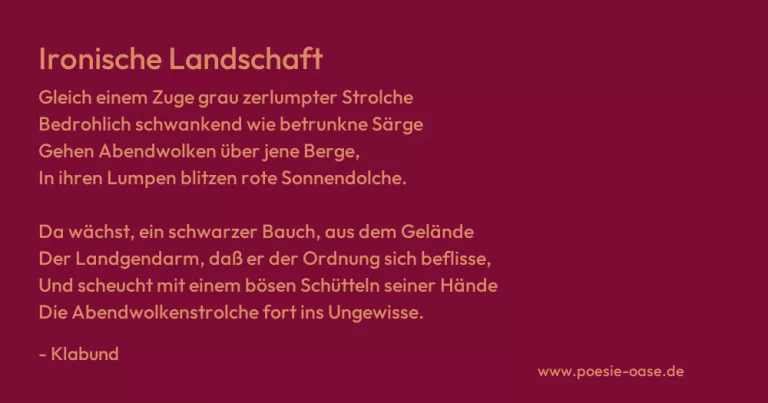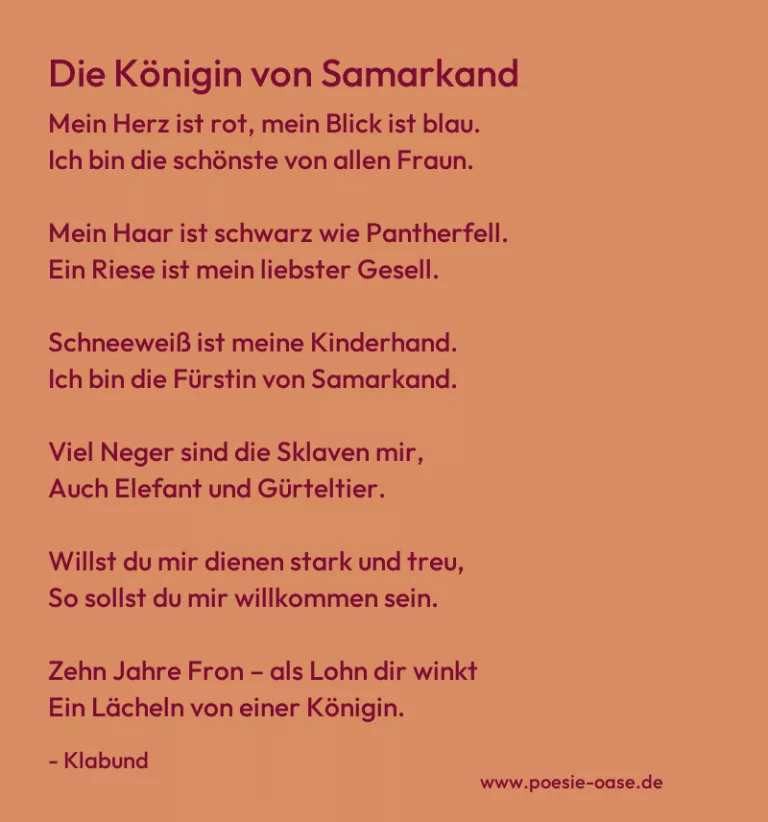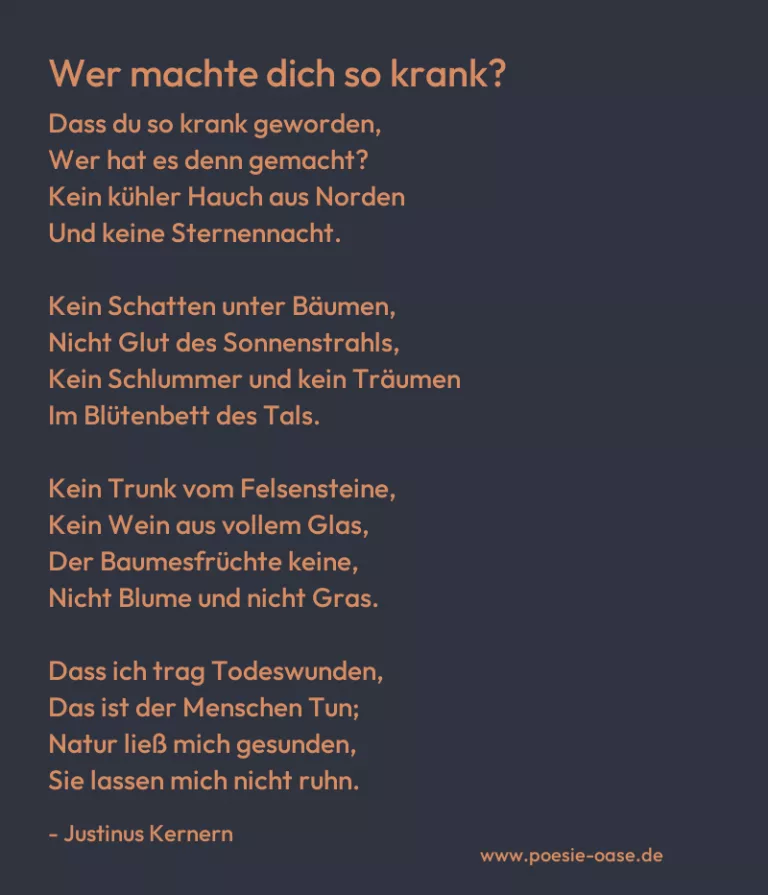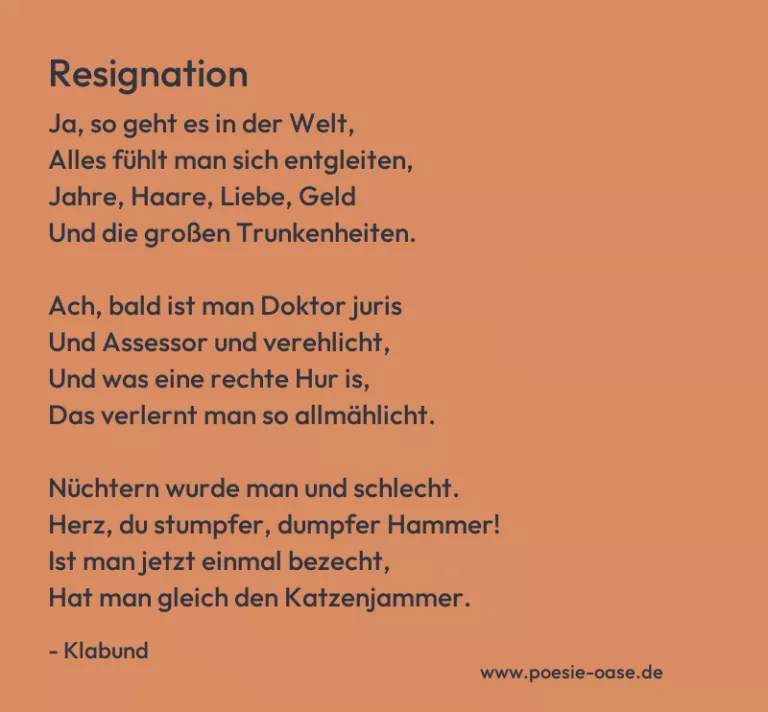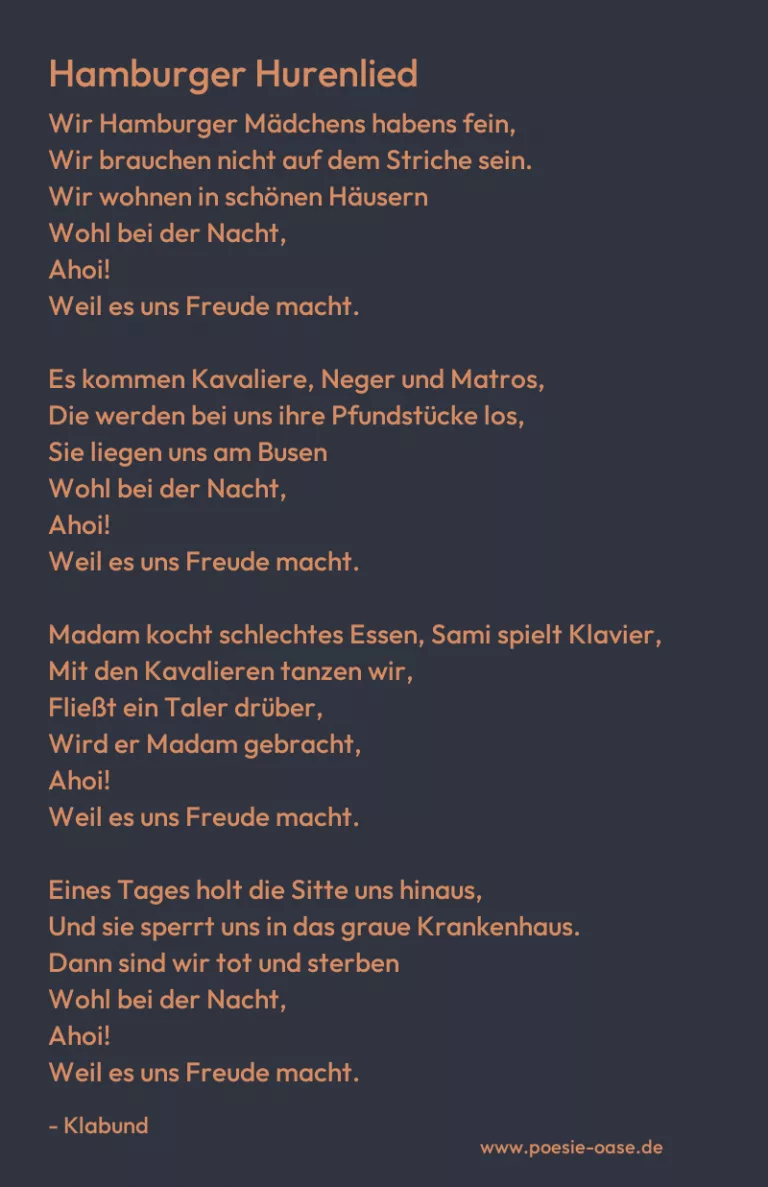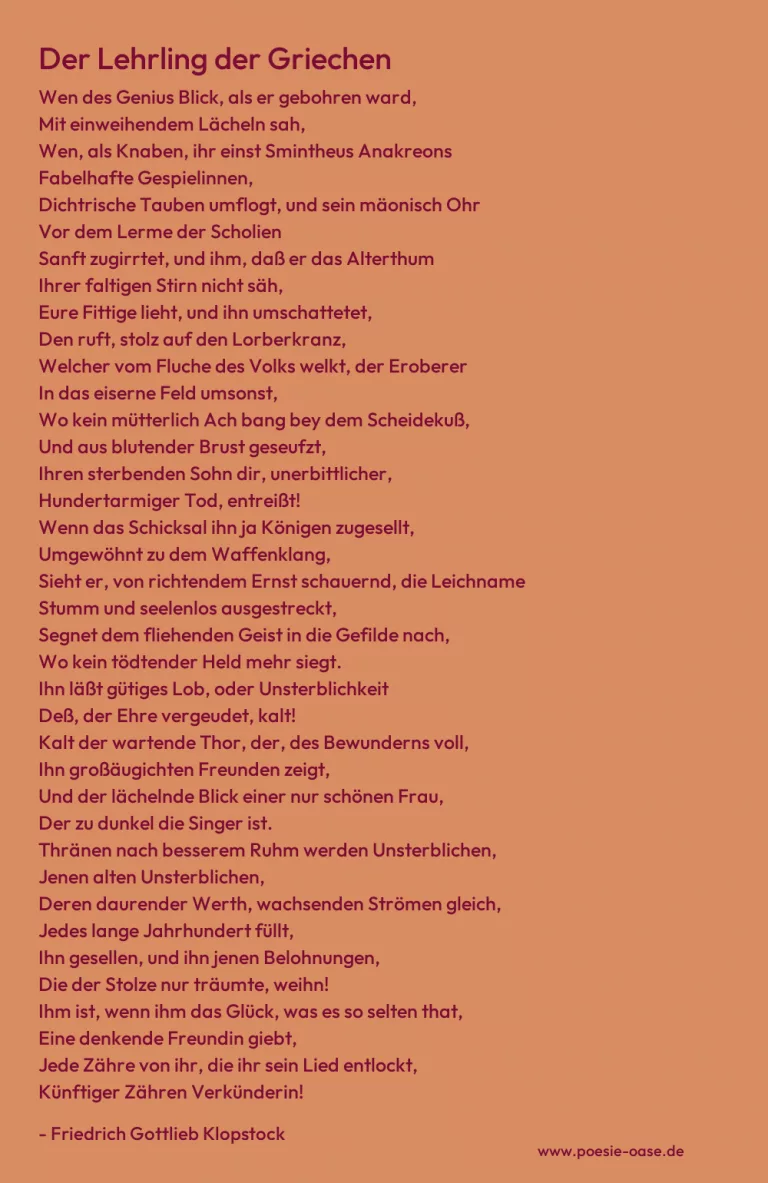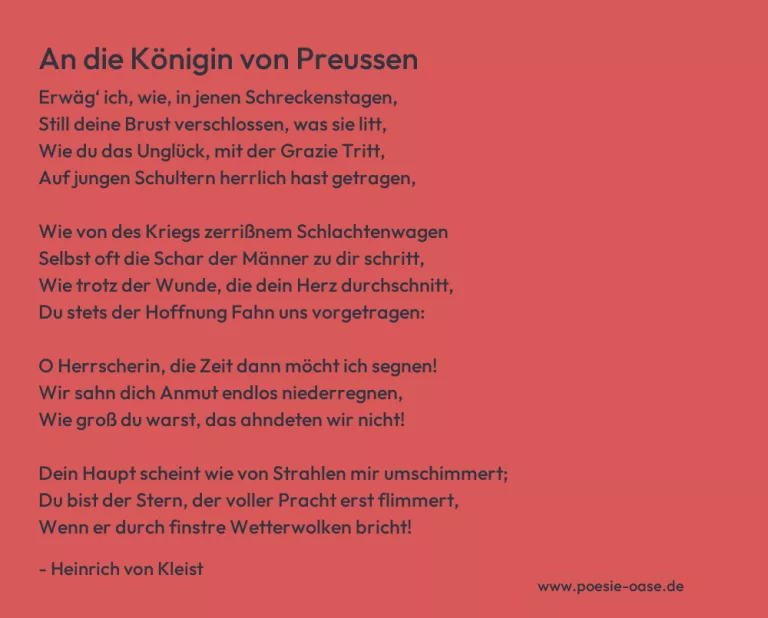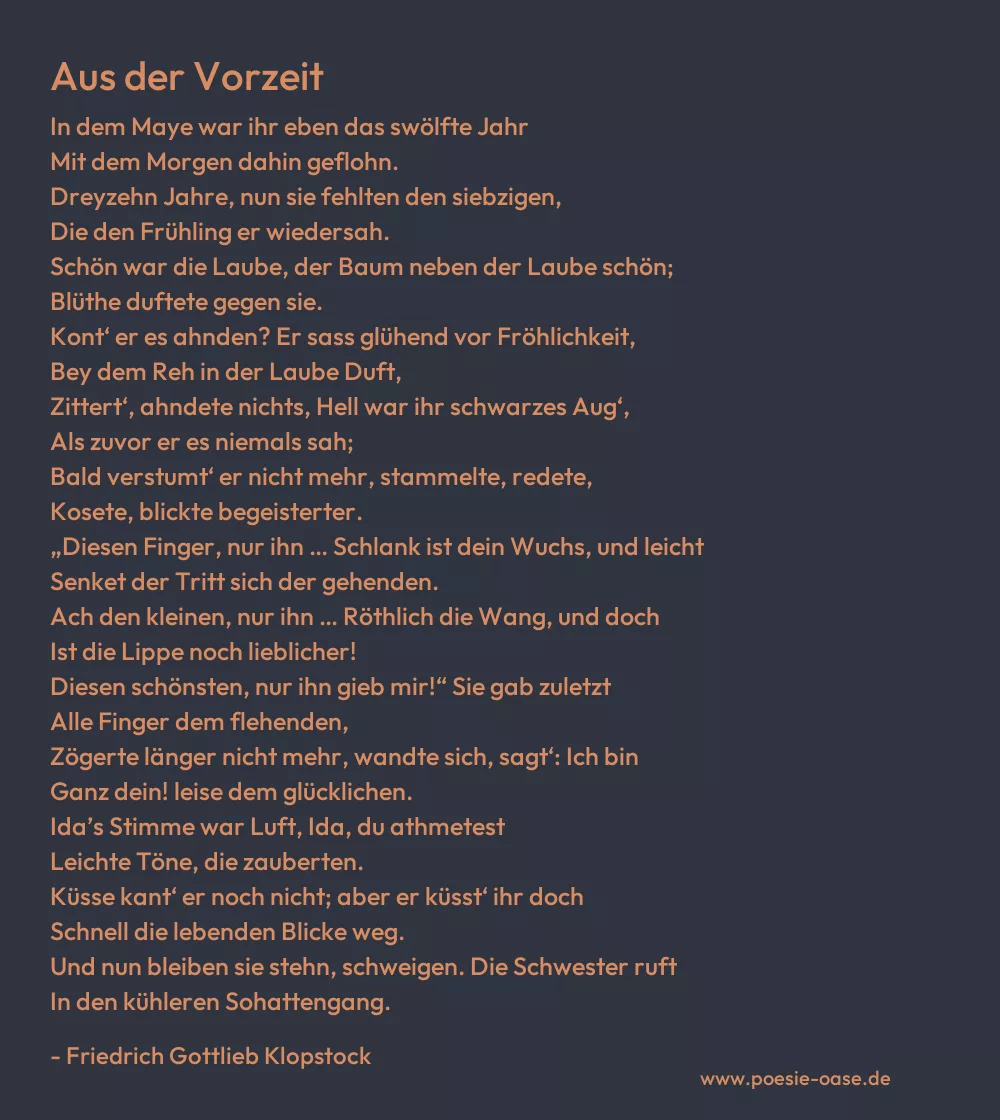Aus der Vorzeit
In dem Maye war ihr eben das swölfte Jahr
Mit dem Morgen dahin geflohn.
Dreyzehn Jahre, nun sie fehlten den siebzigen,
Die den Frühling er wiedersah.
Schön war die Laube, der Baum neben der Laube schön;
Blüthe duftete gegen sie.
Kont‘ er es ahnden? Er sass glühend vor Fröhlichkeit,
Bey dem Reh in der Laube Duft,
Zittert‘, ahndete nichts, Hell war ihr schwarzes Aug‘,
Als zuvor er es niemals sah;
Bald verstumt‘ er nicht mehr, stammelte, redete,
Kosete, blickte begeisterter.
„Diesen Finger, nur ihn … Schlank ist dein Wuchs, und leicht
Senket der Tritt sich der gehenden.
Ach den kleinen, nur ihn … Röthlich die Wang, und doch
Ist die Lippe noch lieblicher!
Diesen schönsten, nur ihn gieb mir!“ Sie gab zuletzt
Alle Finger dem flehenden,
Zögerte länger nicht mehr, wandte sich, sagt‘: Ich bin
Ganz dein! leise dem glücklichen.
Ida’s Stimme war Luft, Ida, du athmetest
Leichte Töne, die zauberten.
Küsse kant‘ er noch nicht; aber er küsst‘ ihr doch
Schnell die lebenden Blicke weg.
Und nun bleiben sie stehn, schweigen. Die Schwester ruft
In den kühleren Sohattengang.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
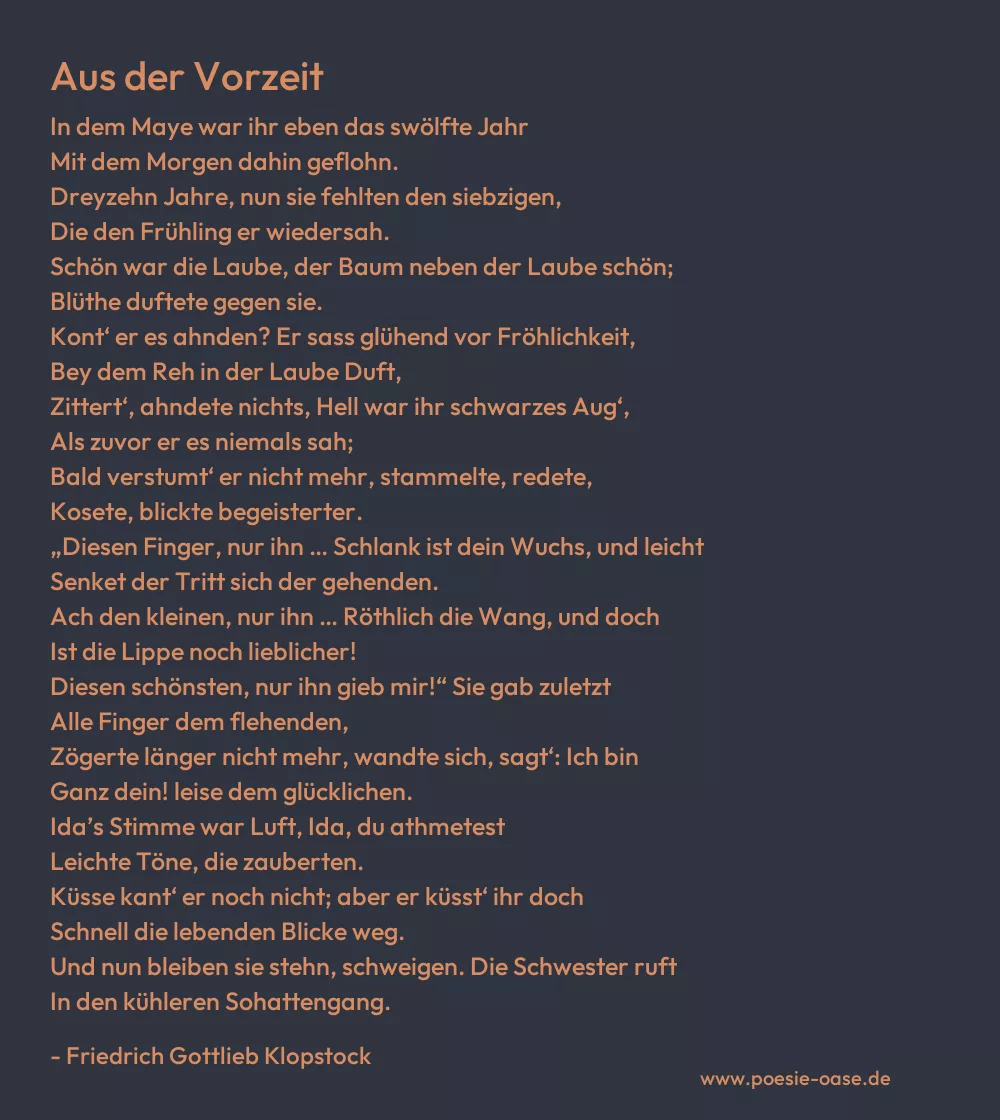
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Aus der Vorzeit“ von Friedrich Gottlieb Klopstock ist eine zarte, rückblickende Erinnerung an ein erstes, unschuldiges Liebeserlebnis in der Jugend. In kunstvoll archaisierender Sprache wird der Moment geschildert, in dem ein junger Mann, von plötzlicher Liebe ergriffen, ein Mädchen zum ersten Mal wirklich sieht – nicht mehr mit kindlichen Augen, sondern mit einer erwachenden, begeisterten Empfindung. Die Szene spielt in einer Frühlingslandschaft, die als Sinnbild für Jugend, Blüte und emotionale Erneuerung dient.
Der zeitliche Rahmen des Gedichts ist doppelt gesetzt: Die Erinnerung bezieht sich auf ein Ereignis im zwölften Lebensjahr des Mädchens, das dreiundfünfzig Jahre zurückliegt – ein weiter zeitlicher Abstand, der das Ereignis umso bedeutungsvoller erscheinen lässt. Diese Rückschau verleiht dem Gedicht einen melancholisch-nostalgischen Ton. Die Liebe, die hier aufkeimt, ist noch unschuldig, aber schon voller Kraft und leiser Körperlichkeit: Der Junge ist „glühend vor Fröhlichkeit“, zittert, redet kaum, und beginnt doch zu begehren – zunächst schüchtern, fast kindlich, indem er um den Finger bittet.
Die Steigerung in seiner Sprache – von einem einzelnen Finger hin zu allen, von der Wange zur Lippe – zeigt die zunehmende Intensität des Erlebens. Die Antwort des Mädchens ist zurückhaltend, doch am Ende ergibt sie sich leise, fast verträumt, mit den Worten: „Ich bin / Ganz dein!“ Der Ausdruck ist zart, fast flüchtig, ganz im Einklang mit der natürlichen, duftenden Frühlingswelt um sie herum. Ida, so der Name des Mädchens, wird nicht körperlich beschrieben, sondern über ihre Stimme und ihre Blicke charakterisiert – sie ist mehr Erscheinung als Figur, beinahe ein poetischer Hauch.
Der Kuss, den der Junge am Ende andeutet – er „küsst‘ ihr doch / Schnell die lebenden Blicke weg“ – ist ein Höhepunkt der Szene, aber noch weit entfernt von sinnlicher Erfüllung. Es ist ein Moment des Erwachens, ein Übergang von der Kindheit zur Jugend, von unbewusster Nähe zur bewussten Zuneigung. Die Idylle endet leise mit dem Ruf der Schwester, die zur Rückkehr in den Schatten ruft – ein subtiler Hinweis darauf, dass solche Augenblicke flüchtig sind und nicht dauerhaft festgehalten werden können.
„Aus der Vorzeit“ ist damit ein poetischer Rückblick auf einen Augenblick reiner, erster Liebe – von Klopstock mit großer Feinheit und psychologischer Tiefe gestaltet. Das Gedicht lebt von der Spannung zwischen zurückhaltender Sprache und innerer Erregung, zwischen natürlicher Umgebung und seelischem Aufbruch, und bleibt dabei ganz im Ton der empfindsamen Dichtung des 18. Jahrhunderts.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.