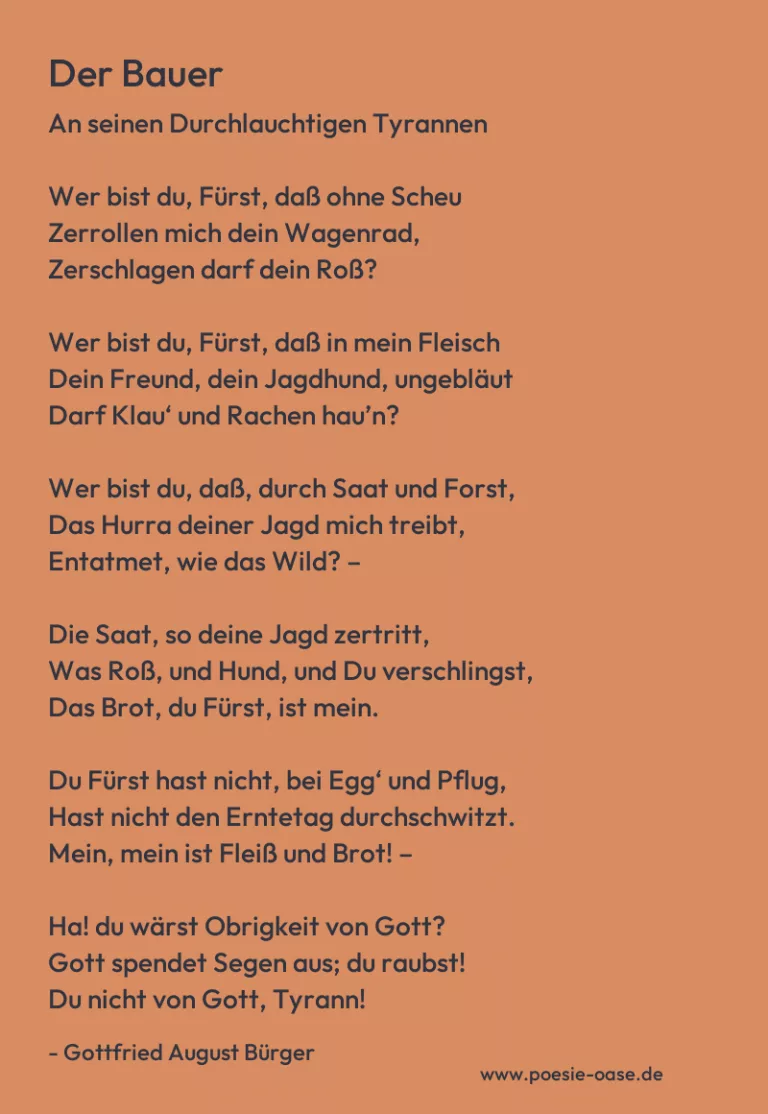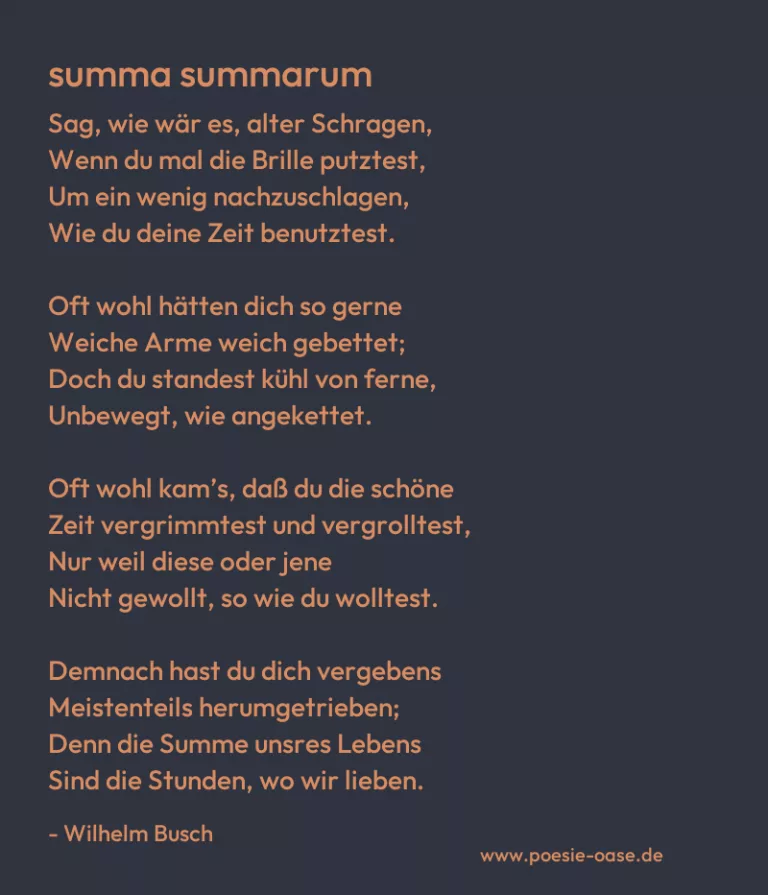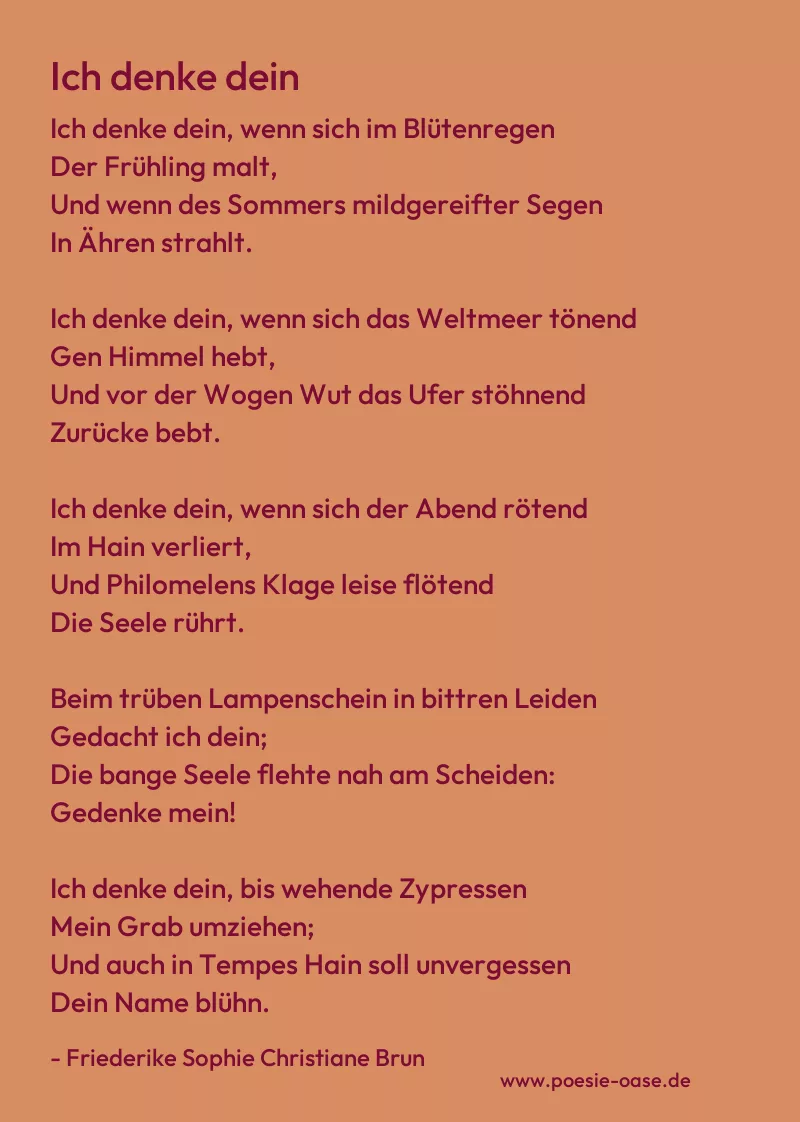Ich denke dein
Ich denke dein, wenn sich im Blütenregen
Der Frühling malt,
Und wenn des Sommers mildgereifter Segen
In Ähren strahlt.
Ich denke dein, wenn sich das Weltmeer tönend
Gen Himmel hebt,
Und vor der Wogen Wut das Ufer stöhnend
Zurücke bebt.
Ich denke dein, wenn sich der Abend rötend
Im Hain verliert,
Und Philomelens Klage leise flötend
Die Seele rührt.
Beim trüben Lampenschein in bittren Leiden
Gedacht ich dein;
Die bange Seele flehte nah am Scheiden:
Gedenke mein!
Ich denke dein, bis wehende Zypressen
Mein Grab umziehen;
Und auch in Tempes Hain soll unvergessen
Dein Name blühn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
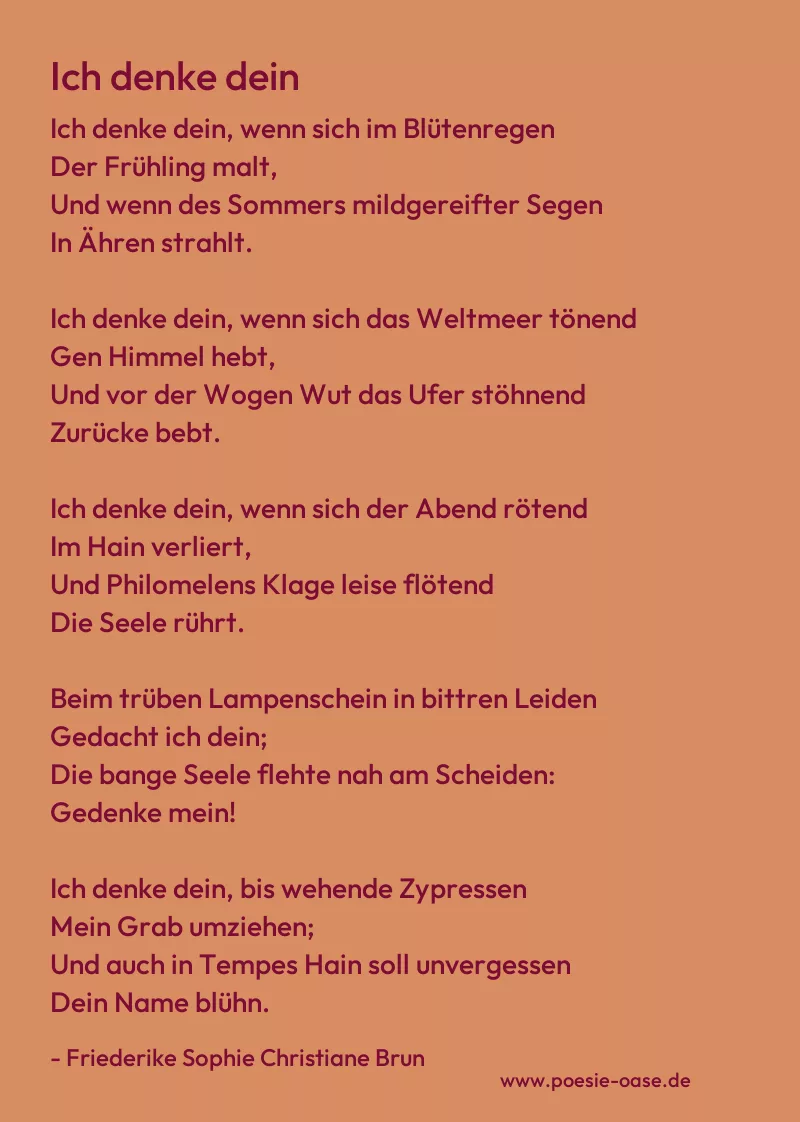
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich denke dein“ von Friederike Sophie Christiane Brun ist eine zarte und zugleich leidenschaftliche Liebeserklärung, die in einer Vielzahl symbolischer Naturbilder die Tiefe und Beständigkeit der Liebe zum Ausdruck bringt. Die Wiederholung der Zeile „Ich denke dein“ zu Beginn fast jeder Strophe unterstreicht die Konstanz des Gefühls – unabhängig von Jahreszeit, Tageszeit oder Lebenslage.
In den ersten drei Strophen wird die Verbundenheit zwischen dem lyrischen Ich und der geliebten Person durch Naturbeobachtungen verdeutlicht. Frühling, Sommer, Meer, Abendröte und Vogelgesang – all diese Elemente sind nicht nur stimmungsvolle Kulisse, sondern Ausdruck innerer Regungen. Der Wechsel von Blütenregen zu reifen Ähren spiegelt etwa den Übergang von aufkeimender zu erfüllter Liebe. Das tönende Weltmeer mit seiner Wucht steht im Kontrast zur zarten Abendstimmung, doch auch hier bleibt der Gedanke an den geliebten Menschen konstant.
Besonders eindrucksvoll ist der emotionale Wandel in der vierten Strophe: In „bittren Leiden“ denkt das lyrische Ich ebenfalls an die geliebte Person, wobei das Bild der „trüben Lampe“ und die Nähe zum Tod („nah am Scheiden“) eine düstere, fast verzweifelte Stimmung erzeugen. Die Liebe wird hier nicht nur als Quelle der Freude, sondern auch als Trost in schwerer Stunde gezeigt.
Die letzte Strophe erweitert die Dimension der Liebe bis über den Tod hinaus. Selbst wenn das Grab mit „wehenden Zypressen“ umstanden ist – einem klassischen Symbol der Trauer –, wird das Denken an den Anderen nicht aufhören. Der Verweis auf „Tempes Hain“, eine Anspielung auf das griechische Idealbild eines friedlichen Jenseits, bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass auch dort die Erinnerung und Liebe weiterbestehen.
Insgesamt zeichnet das Gedicht ein tief romantisches Bild ewiger Liebe, die in allen Phasen des Lebens und selbst über den Tod hinaus Bestand hat. Die Naturbilder verleihen den Gefühlen eine universelle Dimension, während der Wechsel zwischen zarten und mächtigen Eindrücken die emotionale Bandbreite der Zuneigung spiegelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.