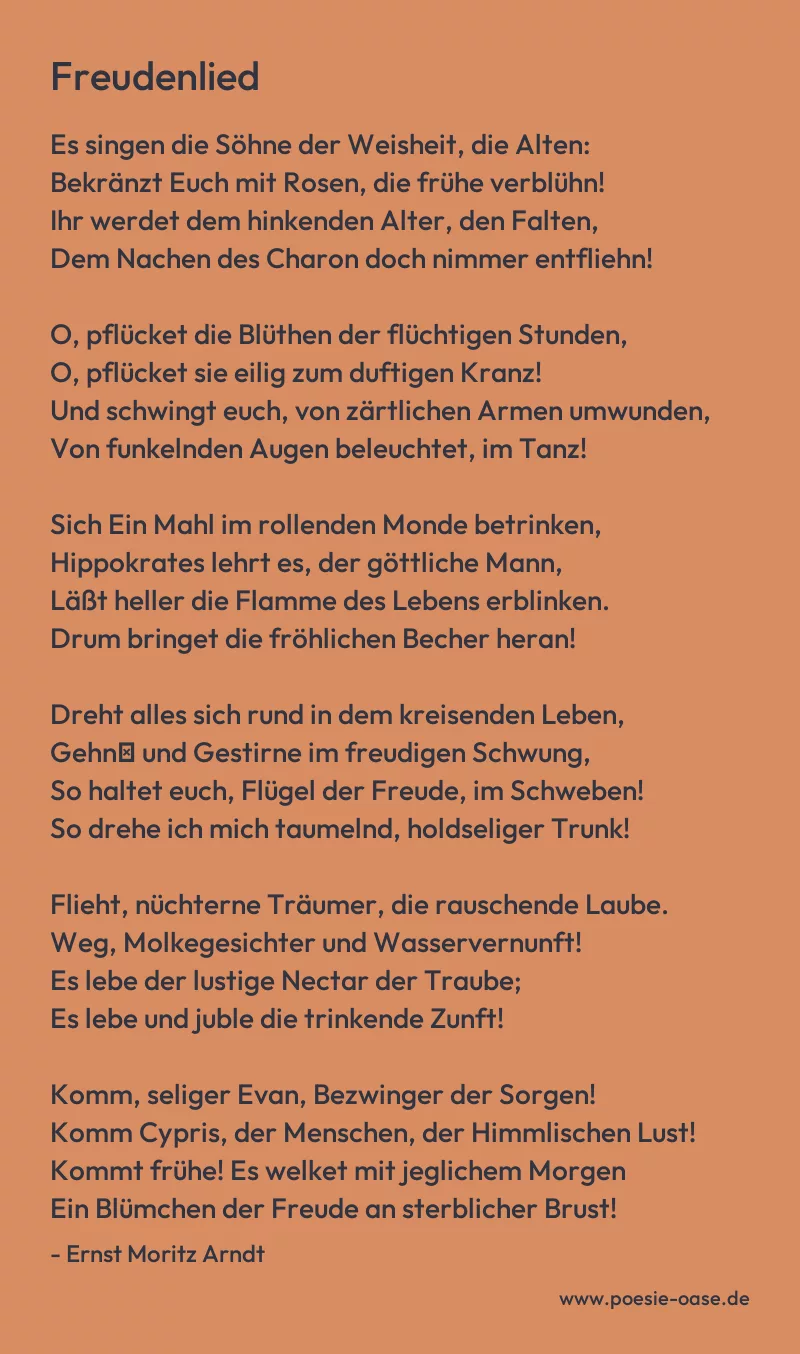Es singen die Söhne der Weisheit, die Alten:
Bekränzt Euch mit Rosen, die frühe verblühn!
Ihr werdet dem hinkenden Alter, den Falten,
Dem Nachen des Charon doch nimmer entfliehn!
O, pflücket die Blüthen der flüchtigen Stunden,
O, pflücket sie eilig zum duftigen Kranz!
Und schwingt euch, von zärtlichen Armen umwunden,
Von funkelnden Augen beleuchtet, im Tanz!
Sich Ein Mahl im rollenden Monde betrinken,
Hippokrates lehrt es, der göttliche Mann,
Läßt heller die Flamme des Lebens erblinken.
Drum bringet die fröhlichen Becher heran!
Dreht alles sich rund in dem kreisenden Leben,
Gehn′ und Gestirne im freudigen Schwung,
So haltet euch, Flügel der Freude, im Schweben!
So drehe ich mich taumelnd, holdseliger Trunk!
Flieht, nüchterne Träumer, die rauschende Laube.
Weg, Molkegesichter und Wasservernunft!
Es lebe der lustige Nectar der Traube;
Es lebe und juble die trinkende Zunft!
Komm, seliger Evan, Bezwinger der Sorgen!
Komm Cypris, der Menschen, der Himmlischen Lust!
Kommt frühe! Es welket mit jeglichem Morgen
Ein Blümchen der Freude an sterblicher Brust!