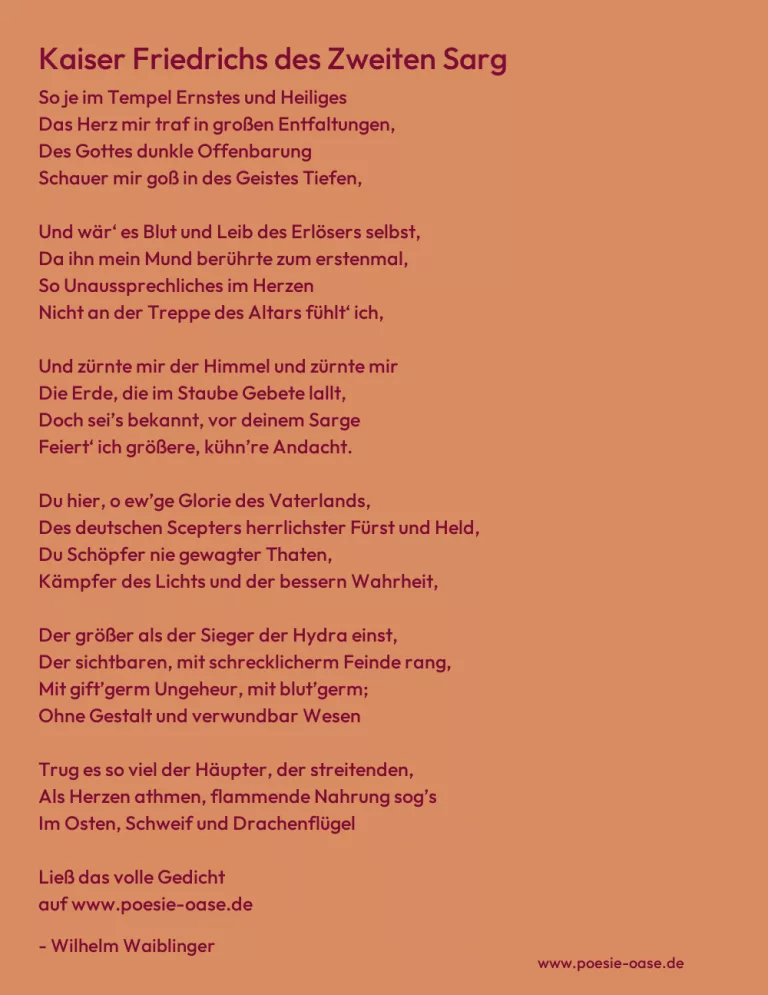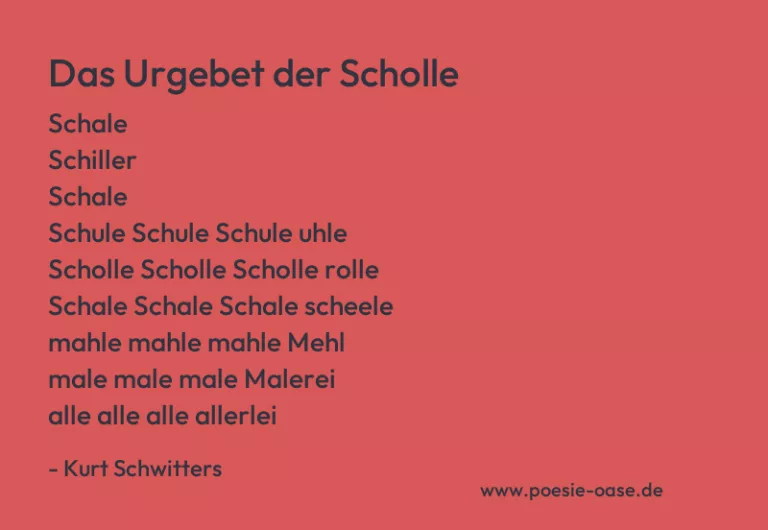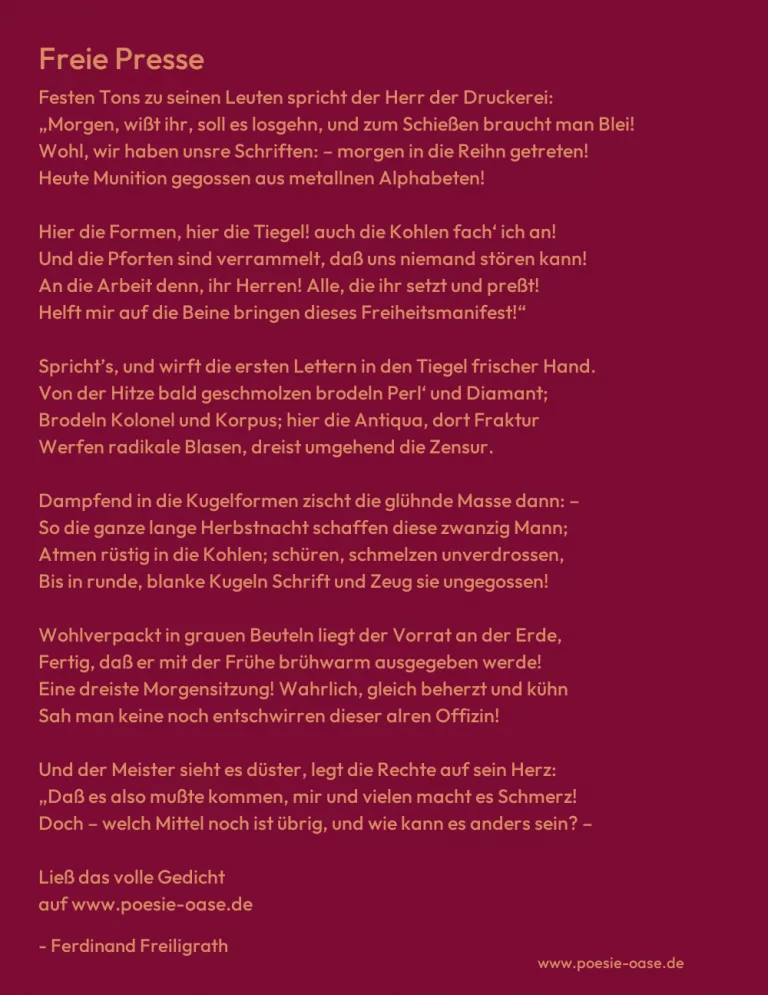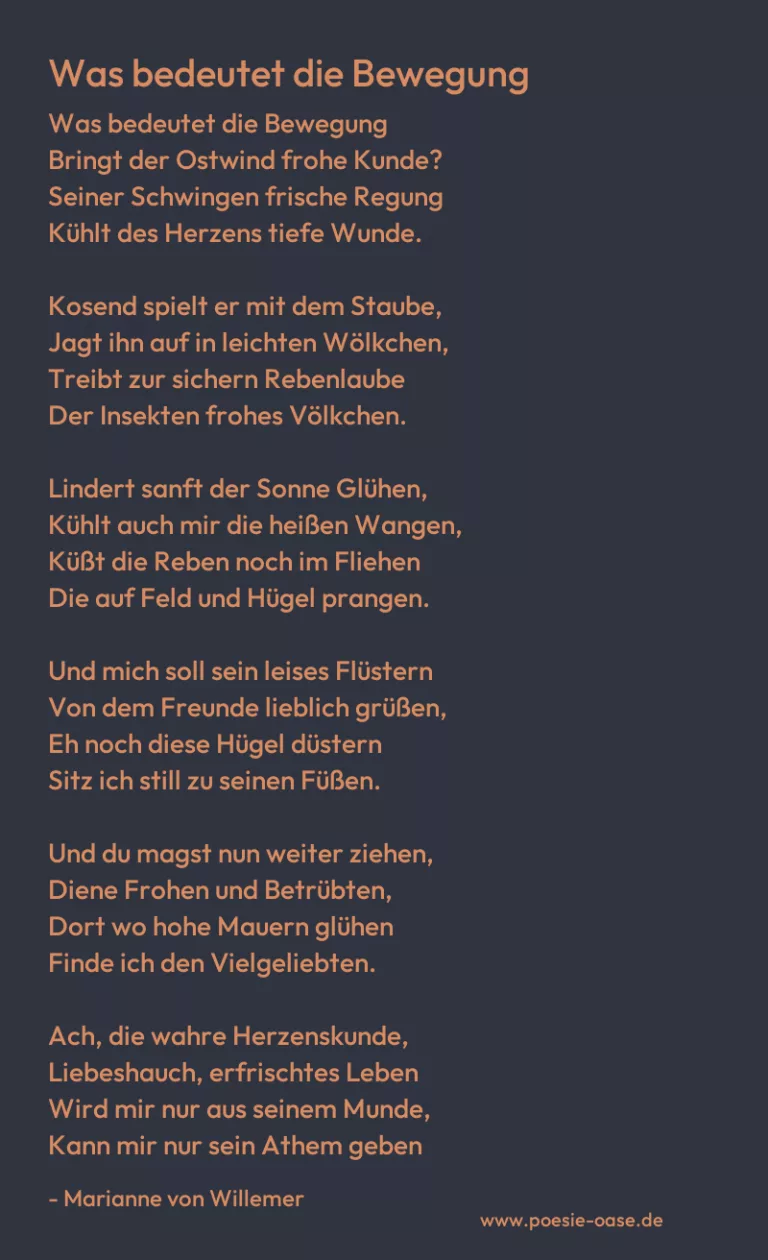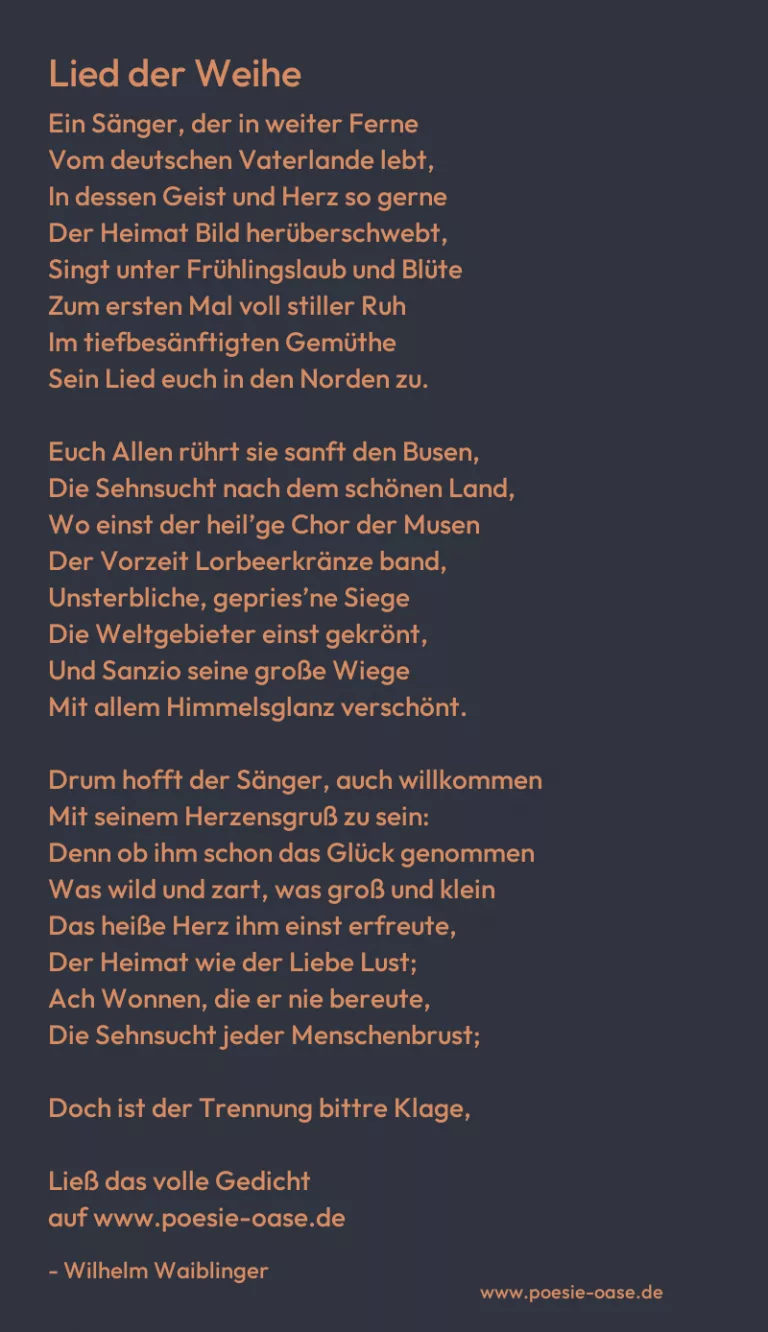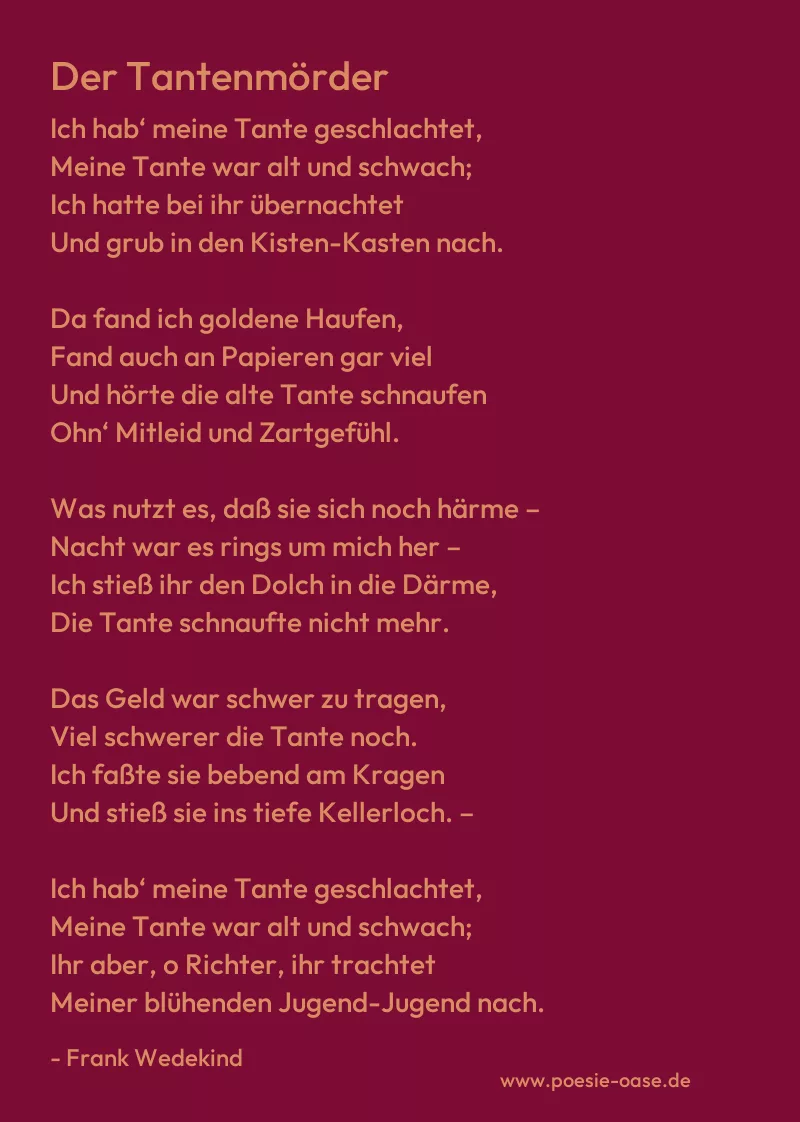Der Tantenmörder
Ich hab‘ meine Tante geschlachtet,
Meine Tante war alt und schwach;
Ich hatte bei ihr übernachtet
Und grub in den Kisten-Kasten nach.
Da fand ich goldene Haufen,
Fand auch an Papieren gar viel
Und hörte die alte Tante schnaufen
Ohn‘ Mitleid und Zartgefühl.
Was nutzt es, daß sie sich noch härme –
Nacht war es rings um mich her –
Ich stieß ihr den Dolch in die Därme,
Die Tante schnaufte nicht mehr.
Das Geld war schwer zu tragen,
Viel schwerer die Tante noch.
Ich faßte sie bebend am Kragen
Und stieß sie ins tiefe Kellerloch. –
Ich hab‘ meine Tante geschlachtet,
Meine Tante war alt und schwach;
Ihr aber, o Richter, ihr trachtet
Meiner blühenden Jugend-Jugend nach.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
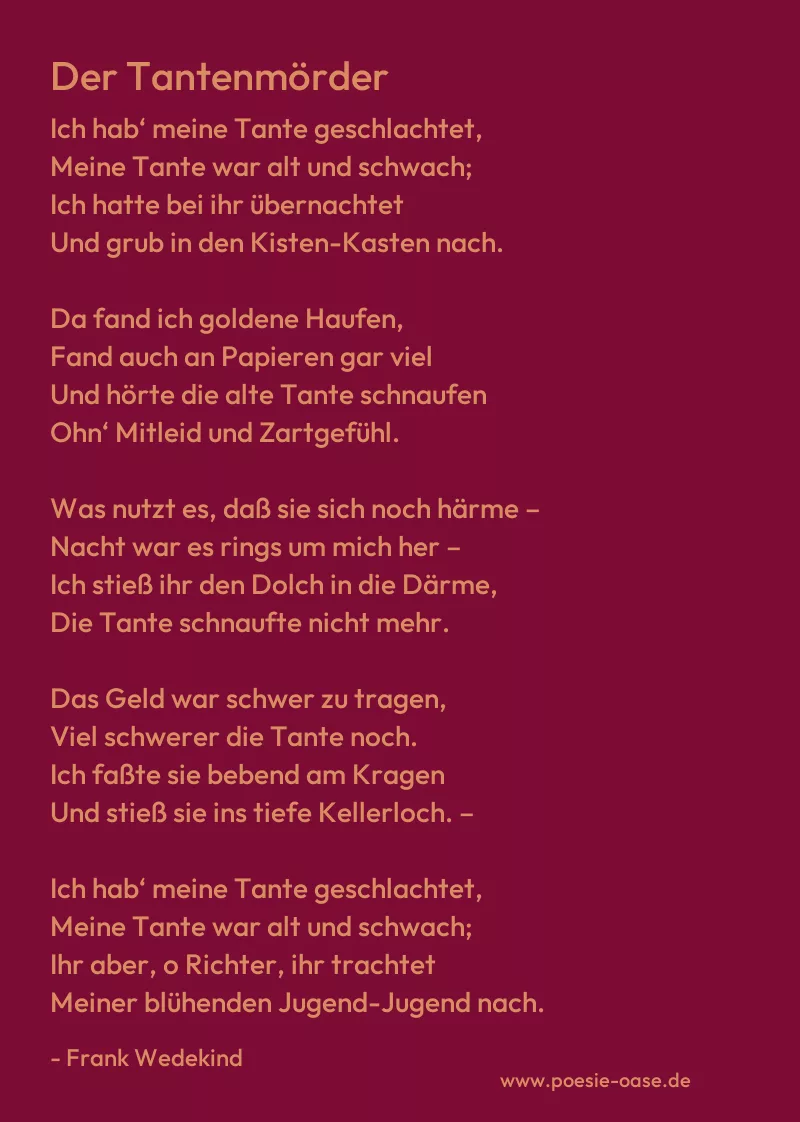
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Tantenmörder“ von Frank Wedekind ist ein düsteres, fast groteskes Werk, das den Mord an einer alten und schwachen Tante beschreibt. Der Sprecher schildert die Tat in einer scheinbar sachlichen und ungerührten Weise, was eine verstörende Wirkung auf den Leser hat. Die Tante wird zunächst als „alt und schwach“ dargestellt, was ihre Vulnerabilität betont und ihre Opferrolle in diesem Szenario unmissverständlich macht. Der Sprecher, der bei ihr übernachtet hat, beginnt, in ihren „Kisten-Kasten“ nach Wertgegenständen zu suchen, was den eigentlichen Grund für die grausame Tat andeutet: Habgier.
Der Mord wird dann in einem nüchternen, fast mechanischen Ton geschildert. Der Sprecher stellt fest, dass die Tante „schnaufte“, ohne Mitleid oder Zartgefühl, was die Härte seiner Handlungen und die Abwesenheit jeglicher Empathie unterstreicht. Es ist eine perfide Darstellung der Tat als eine rationale Entscheidung, bei der der Mörder den Dolch „in die Därme“ stieß, als würde er ein alltägliches, wenn auch brutales, Geschäft erledigen. Die Zeilen „Was nutzt es, dass sie sich noch härme“ und „die Tante schnaufte nicht mehr“ verstärken den Eindruck von Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben und dem Leid der anderen.
In der nächsten Strophe zeigt sich eine weitere grausame Dimension der Tat: Der Sprecher beschreibt, wie er das „schwere“ Geld trägt, das er gefunden hat, und dann die „noch viel schwerere Tante“ in ein „tiefer Kellerloch“ stößt. Dies kann als symbolische Darstellung der Last der alten Generation und ihrer „Unbrauchbarkeit“ interpretiert werden, die durch den Mord endgültig beseitigt wird. Die Kälte, mit der der Sprecher diese Taten beschreibt, erzeugt einen widerlichen Eindruck von innerer Leere und Amoralität.
Das Gedicht endet mit einer überraschenden Wendung, in der der Sprecher sich an den „Richter“ wendet und seine Tat mit seiner „blühenden Jugend“ rechtfertigt. Der Mord wird hier als ein Opfer dargestellt, das der Sprecher im Namen seiner eigenen Lebensgestaltung und „blühenden“ Zukunft gebracht hat. Der „Richter“ und die rechtliche Konsequenz bleiben aus, was den Eindruck erweckt, dass der Sprecher das Verbrechen nicht als solches erkennt oder sich dessen überhaupt nicht bewusst ist. Die letzte Zeile, die das Verbrechen als ein „Trachten nach blühender Jugend“ darstellt, ist eine zynische und perverse Rechtfertigung der Tat, die das Gedicht mit einer erschreckenden, fast surrealen Note abschließt.
Weckherlin verwendet in „Der Tantenmörder“ eine Mischung aus groteskem Humor und düsterer Satire, um Themen wie Habgier, Gewalt und die Entfremdung von moralischen Werten zu behandeln. Der Sprecher zeigt keinerlei Reue oder menschliche Wärme und behandelt den Mord an seiner Tante wie eine alltägliche und logische Entscheidung. Das Gedicht ist ein schockierendes Beispiel für die Entmenschlichung und die moralische Verrohung des Individuums im Angesicht von Gier und Selbstsucht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.