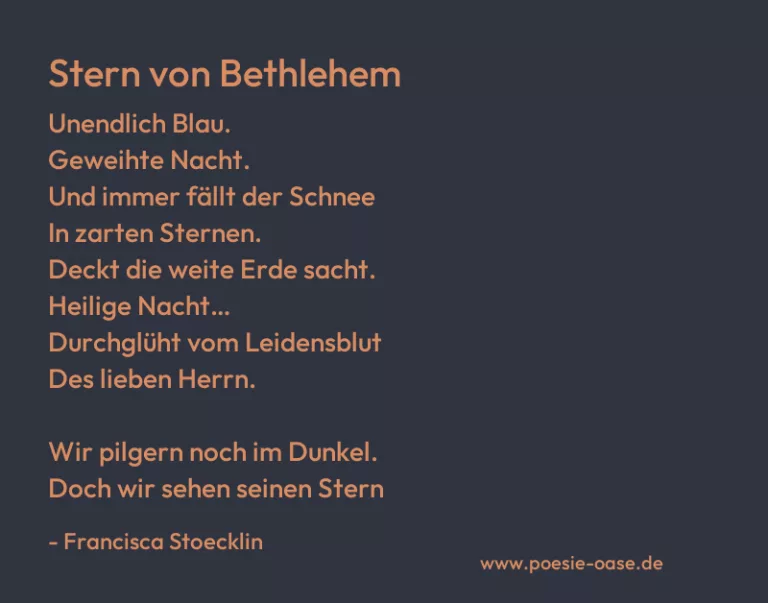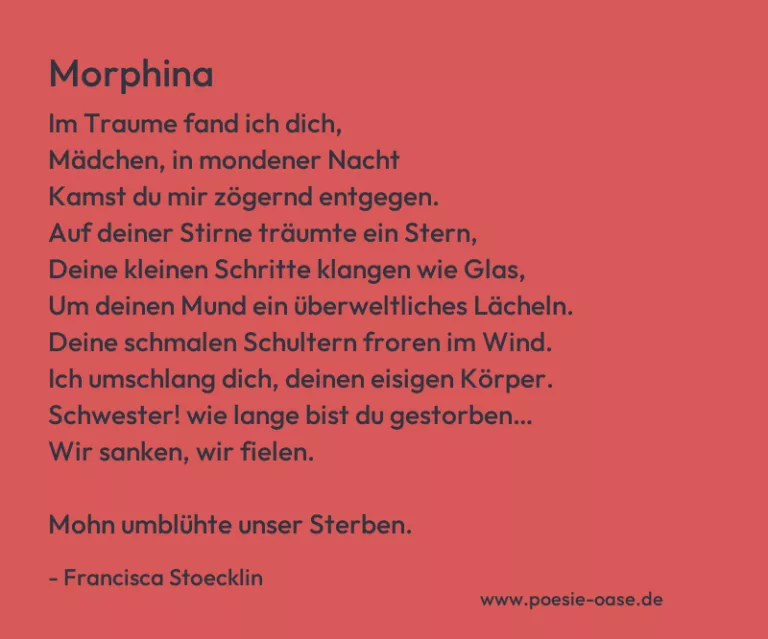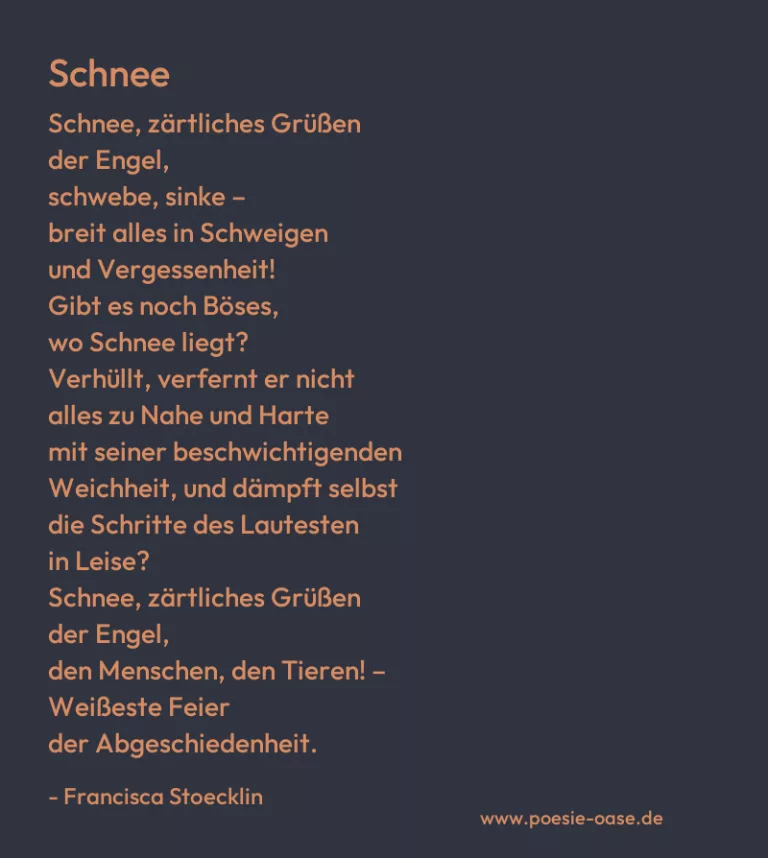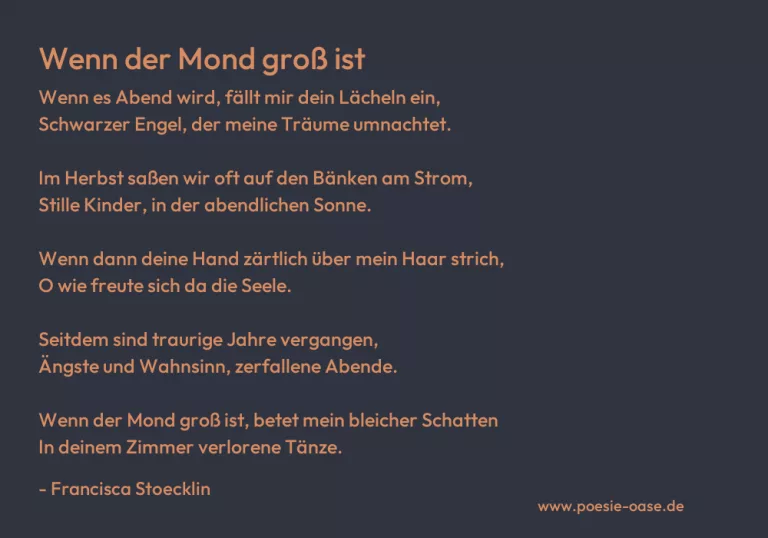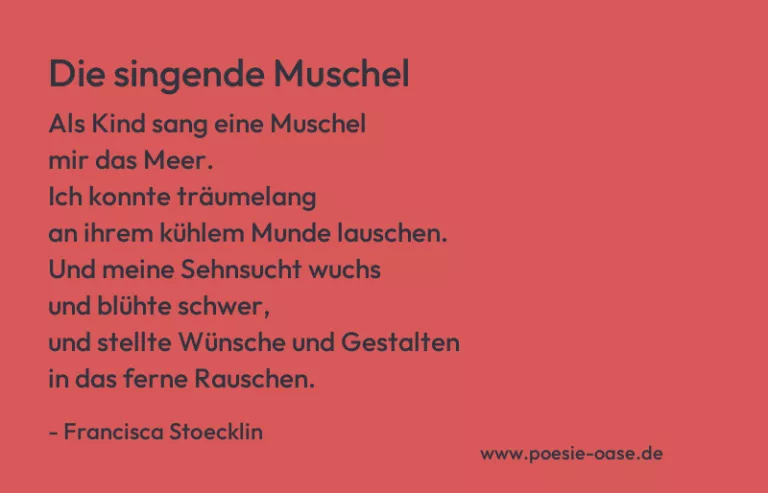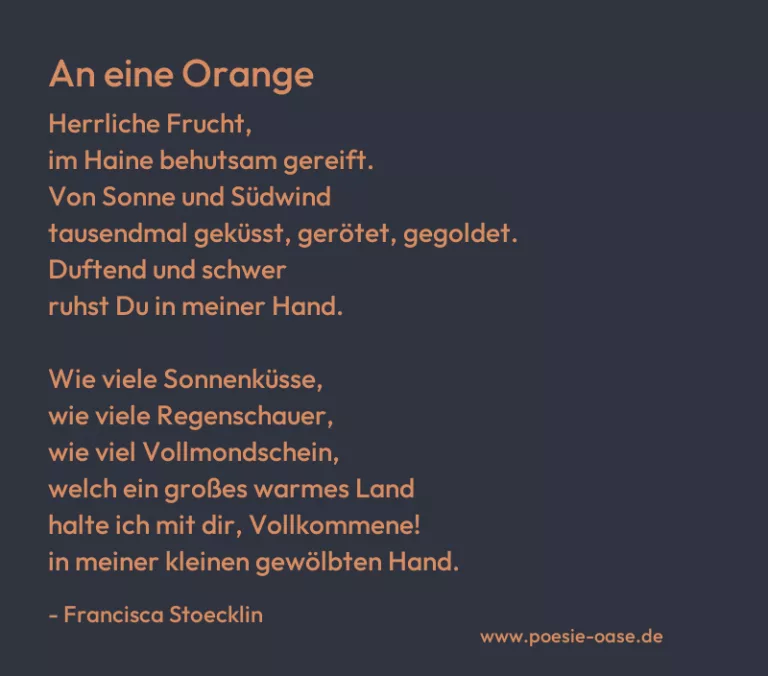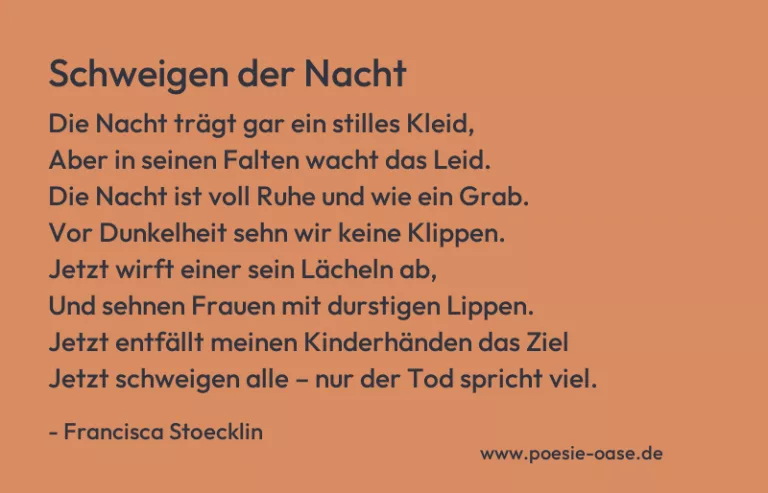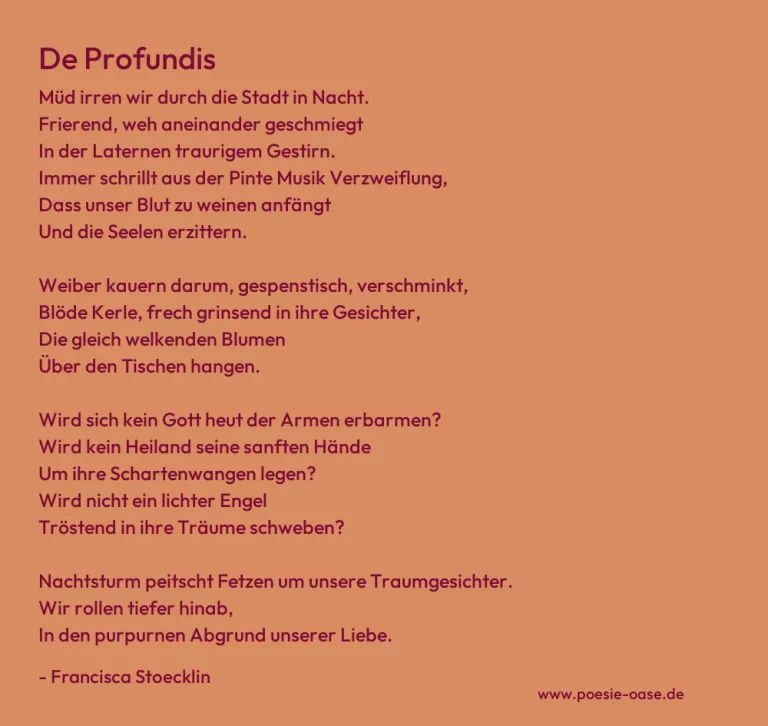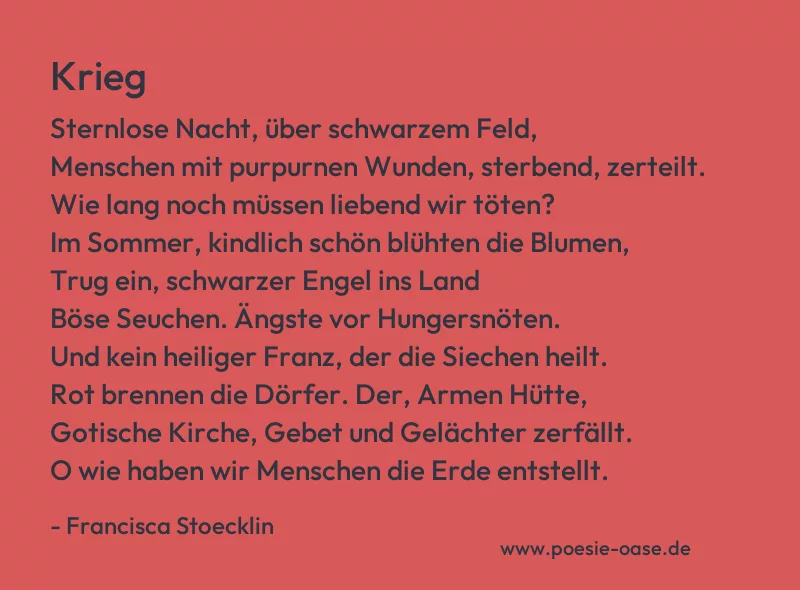Krieg
Sternlose Nacht, über schwarzem Feld,
Menschen mit purpurnen Wunden, sterbend, zerteilt.
Wie lang noch müssen liebend wir töten?
Im Sommer, kindlich schön blühten die Blumen,
Trug ein, schwarzer Engel ins Land
Böse Seuchen. Ängste vor Hungersnöten.
Und kein heiliger Franz, der die Siechen heilt.
Rot brennen die Dörfer. Der, Armen Hütte,
Gotische Kirche, Gebet und Gelächter zerfällt.
O wie haben wir Menschen die Erde entstellt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
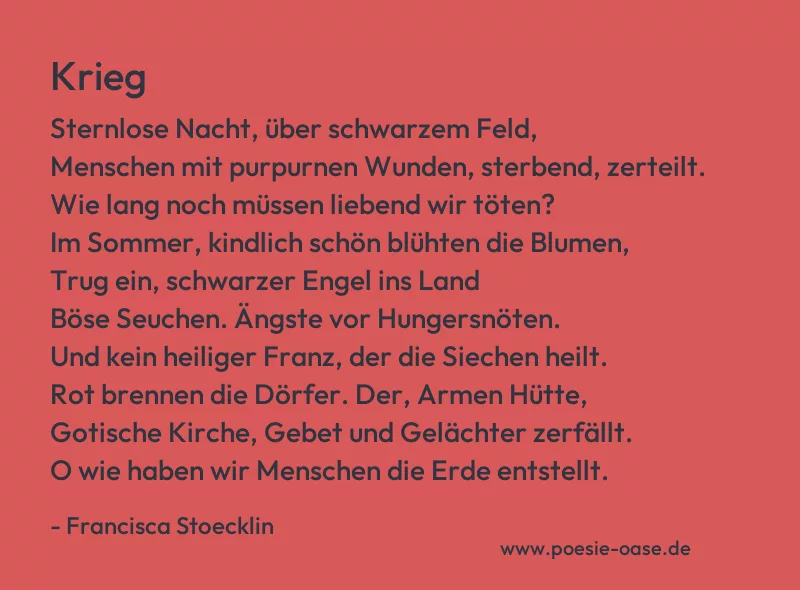
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Krieg“ von Francisca Stoecklin beschreibt auf eindrucksvolle Weise die Zerstörung und das Leid, das der Krieg mit sich bringt. Die erste Strophe beginnt mit der „sternlosen Nacht“ und einem „schwarzen Feld“, was eine düstere und hoffnungslose Atmosphäre schafft. Der „sternlose“ Himmel verweist auf das Fehlen von Führung und Licht, während das „schwarze Feld“ das Bild einer zerstörten und verwüsteten Landschaft zeichnet. Die „purpurnen Wunden“ und das Bild von sterbenden, „zertailten“ Menschen bringen die Grausamkeit und das körperliche Leid des Krieges unmittelbar zum Ausdruck. Die Frage „Wie lang noch müssen liebend wir töten?“ drückt die Sinnlosigkeit und den Schmerz des Krieges aus und verweist auf das moralische Dilemma, das Kriege und Gewalt aufwerfen.
In der zweiten Strophe wird der Kontrast zwischen der „kindlich schönen“ Blüte im Sommer und der darauffolgenden Zerstörung durch den Krieg hervorgehoben. Die „schwarzen Engel“ symbolisieren möglicherweise die Mächte des Krieges oder des Bösen, die „Böse Seuchen“ und „Ängste vor Hungersnöten“ ins Land tragen. Hier wird der Krieg nicht nur als körperliche, sondern auch als soziale und seelische Zerstörung dargestellt, die Ängste und Not über die Menschen bringt. Der Hinweis auf den „heiligen Franz“, der für seine Hilfe zu den Siechen bekannt war, zeigt den Mangel an Hilfe in der Kriegszeit und stellt die Frage nach einer höheren Gerechtigkeit oder Erlösung.
Die dritte Strophe beschreibt die Zerstörung von Heimat und Kultur. Die brennenden „Dörfer“ und das Zerfallen der „gotischen Kirche“ stehen als Symbole für die Zerstörung von sowohl spirituellen als auch sozialen Werten im Krieg. Das „Gebet“ und „Gelächter“ werden hier zu Opfern des Krieges, was den Verlust von Hoffnung und Freude im Angesicht der Gewalt betont. Das Bild der „armen Hütte“ verstärkt das Gefühl der Verzweiflung, da auch die ärmsten und einfachsten Orte von der Zerstörung betroffen sind.
Am Ende des Gedichts wird die Verantwortung des Menschen für diese Zerstörung in der abschließenden Frage „O wie haben wir Menschen die Erde entstellt“ thematisiert. Die Frage richtet sich an die Menschheit selbst und konfrontiert sie mit der Verantwortung für die Kriege und die Umweltzerstörung, die durch das menschliche Handeln verursacht wurden. Der Krieg wird als eine tragische Entstellung der Erde und der menschlichen Natur dargestellt, als eine Folge der menschlichen Fehler und der Unfähigkeit, Frieden und Harmonie zu wahren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.