Gläubt ihr, so bin ich euch, was ihr nur wollt; recht nach der Lust Gottes,
Schrecklich und lustig und weich: Zweiflern versink ich zu nichts.
Forderung
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
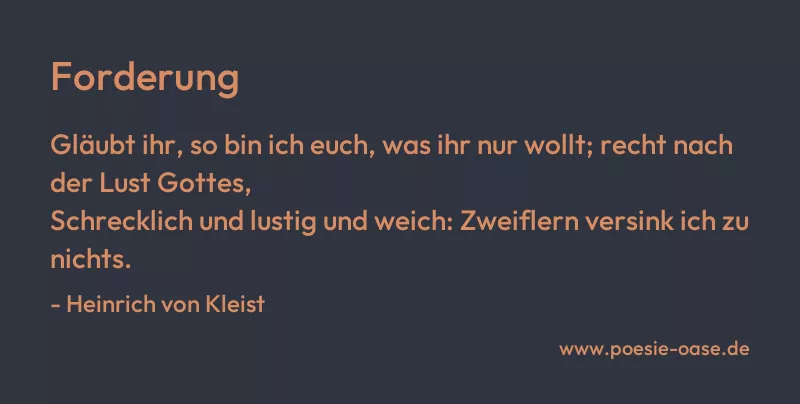
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Forderung“ von Heinrich von Kleist ist eine kurze, aber kraftvolle Aussage über die Natur des Glaubens und seine Auswirkungen. Kleist präsentiert hier eine existentielle Position, die eine klare Wahl zwischen Glaube und Zweifel erfordert. Die ersten Zeilen legen den Fokus auf die bedingungslose Hingabe an den Glauben, wobei der Sprecher sich dem Glaubenden so zeigt, wie er es sich wünscht.
Die zentrale Idee des Gedichts ist die Dichotomie zwischen Glauben und Zweifel. Der Sprecher scheint zu betonen, dass er für die Gläubigen alles ist, was sie sich vorstellen – sei es „recht nach der Lust Gottes“, also freudig, oder „schrecklich und lustig und weich“. Diese Flexibilität zeigt die vielschichtige Natur des Glaubens und seine Fähigkeit, sich an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Gläubigen anzupassen. Doch im Gegensatz dazu wartet das Nichts für die Zweifler.
Der zweite Teil des Gedichts verstärkt die unerbittliche Natur dieser Wahl. Die klare Botschaft ist: Wer zweifelt, der verliert alles – „versink ich zu nichts“. Dieser Satz ist von entscheidender Bedeutung, da er die Konsequenzen des Zweifels radikal darstellt. Es geht nicht nur um das Fehlen von Trost oder Orientierung, sondern um das vollständige Verschwinden. Kleists Sprache ist prägnant und direkt, was die Intensität des Gedichts verstärkt.
Die „Forderung“ des Gedichts besteht darin, sich für eine Seite zu entscheiden: entweder für den Glauben mit all seinen Facetten oder für das Nichts des Zweifels. Es ist eine Aufforderung zur radikalen Entscheidung, die impliziert, dass es keine Grauzone gibt. Kleist bietet keine Nuancen, sondern eine klare Alternative, die sowohl die Bedeutung als auch die Konsequenzen des Glaubens und des Zweifels verdeutlicht.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
