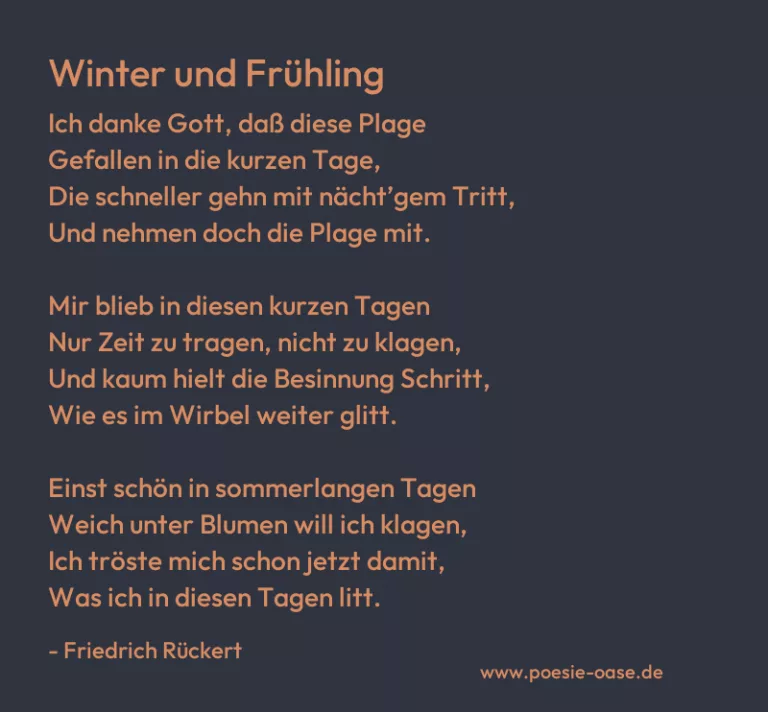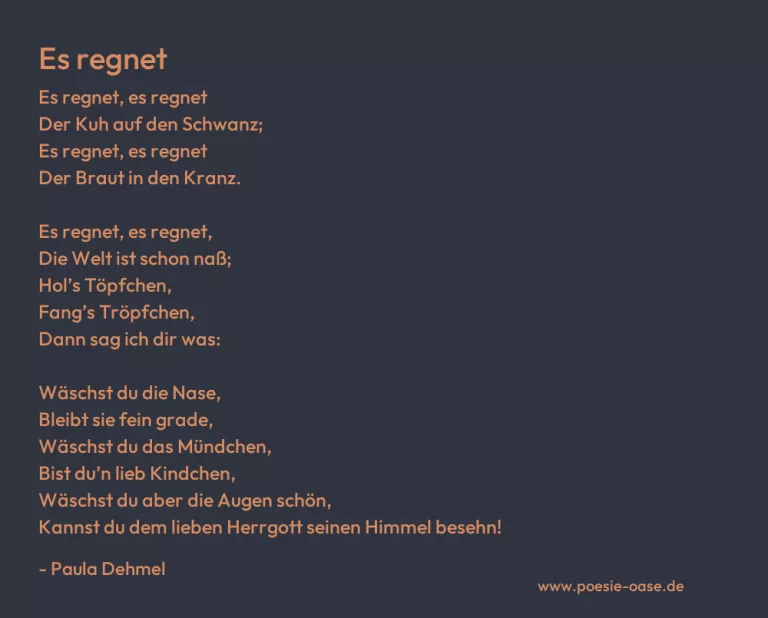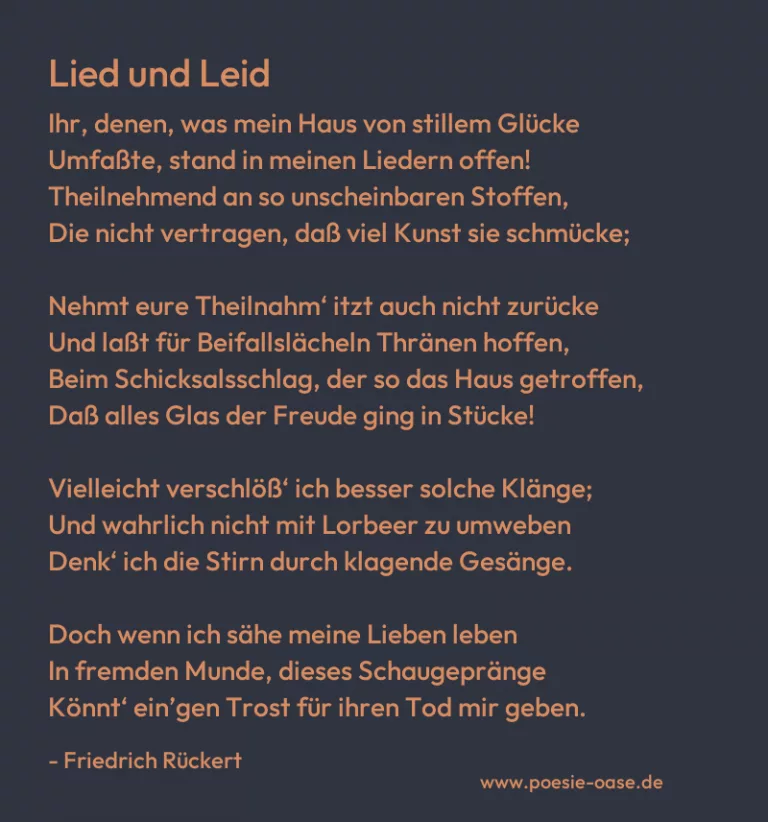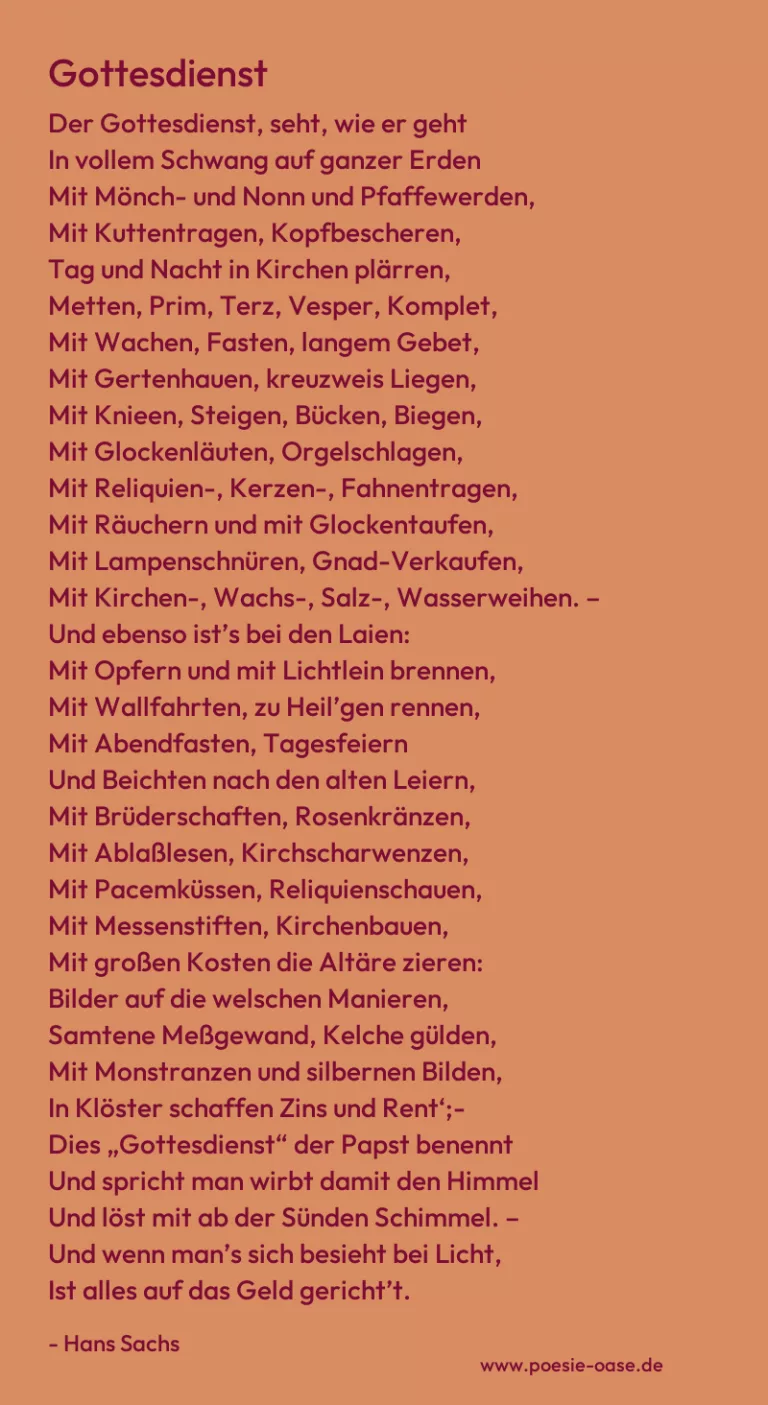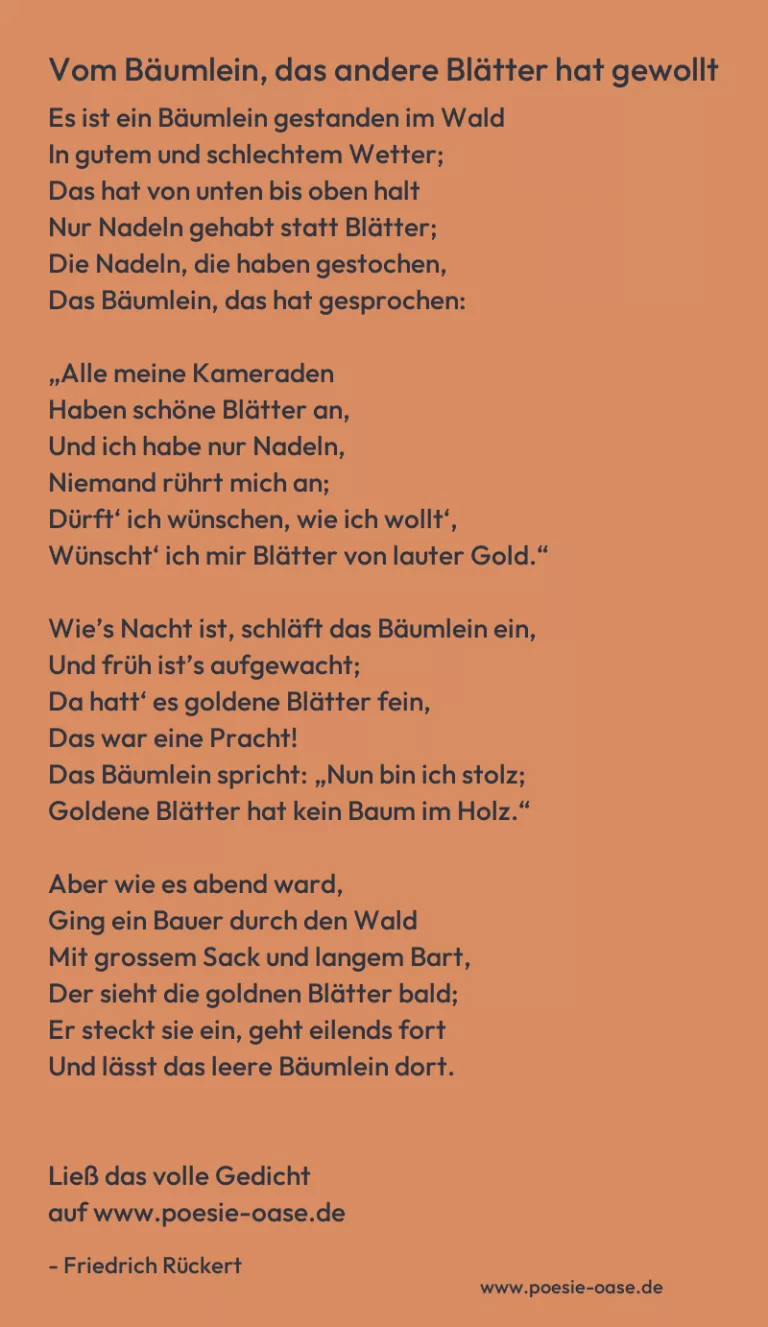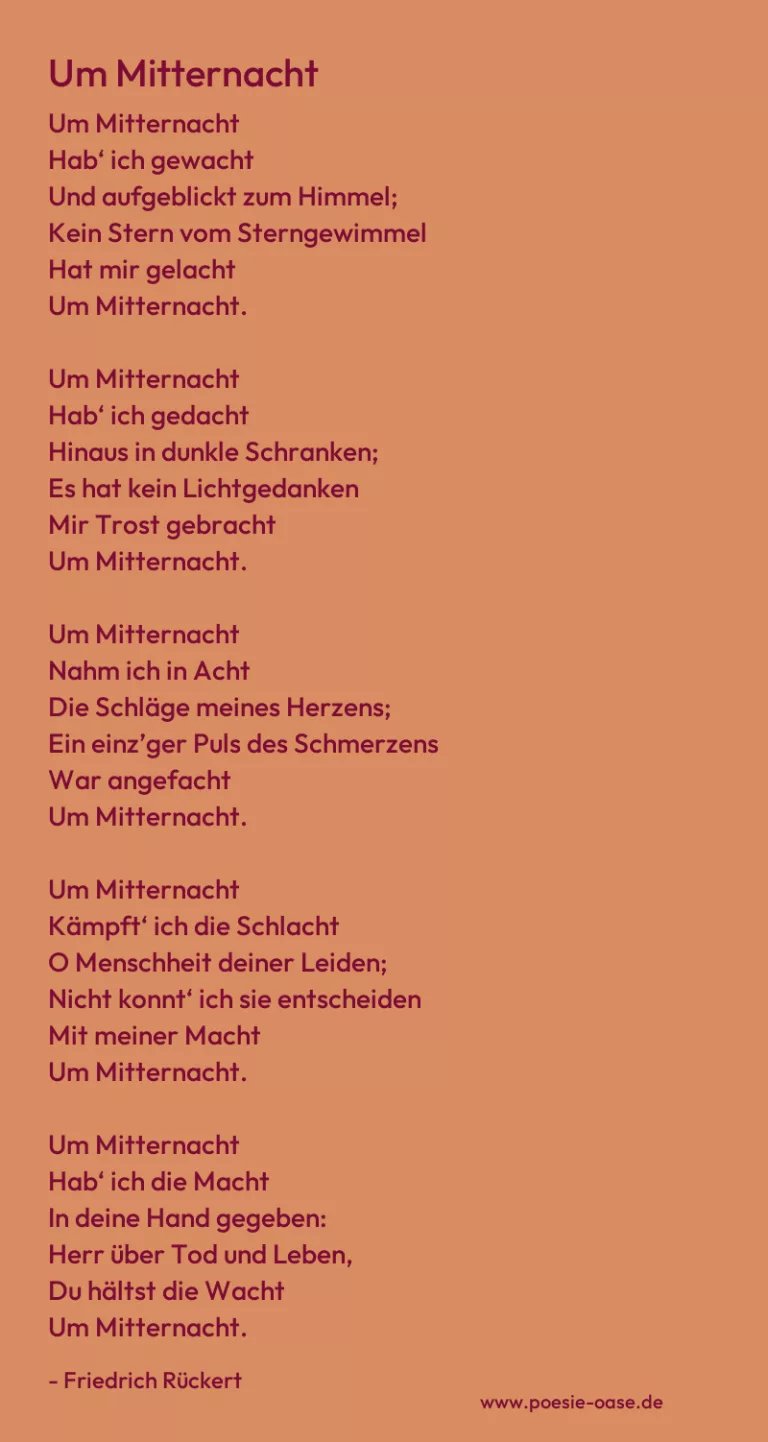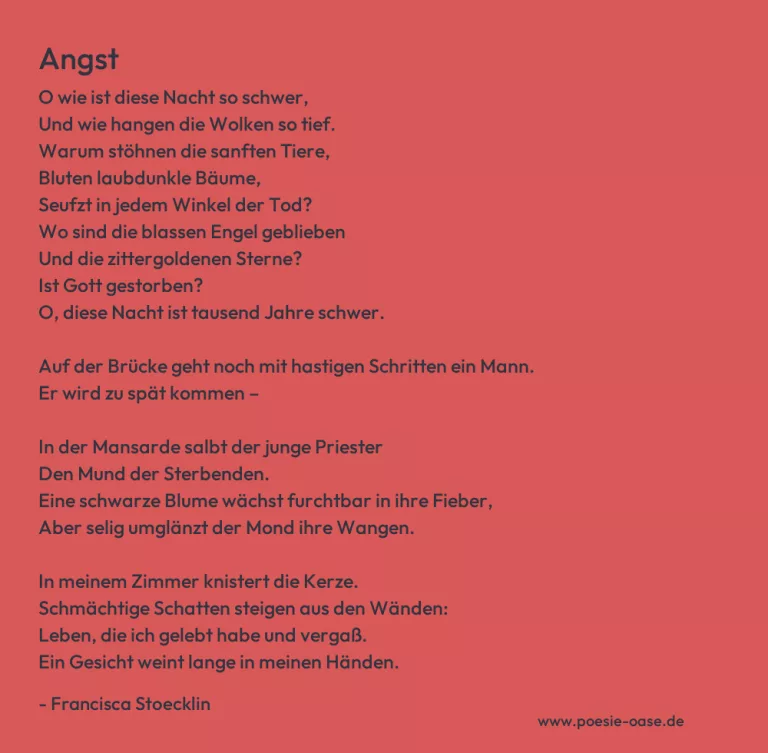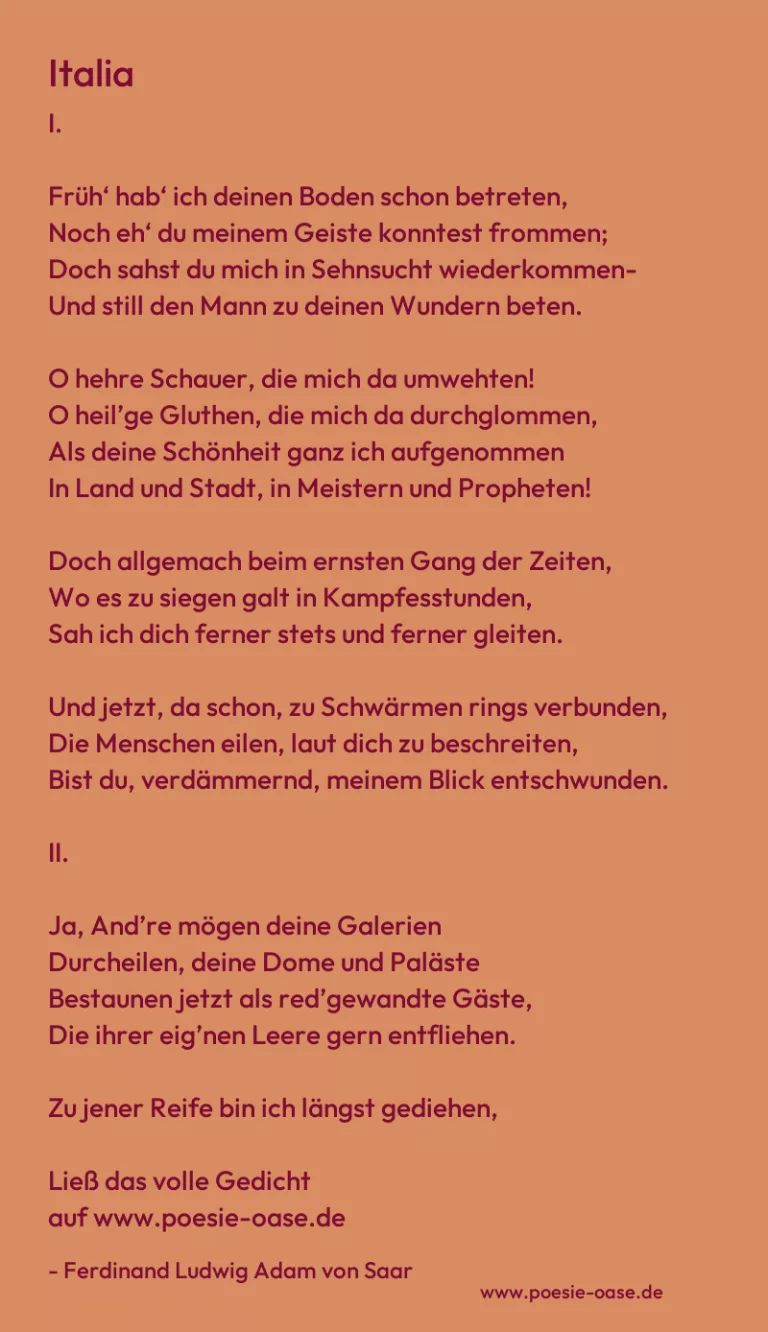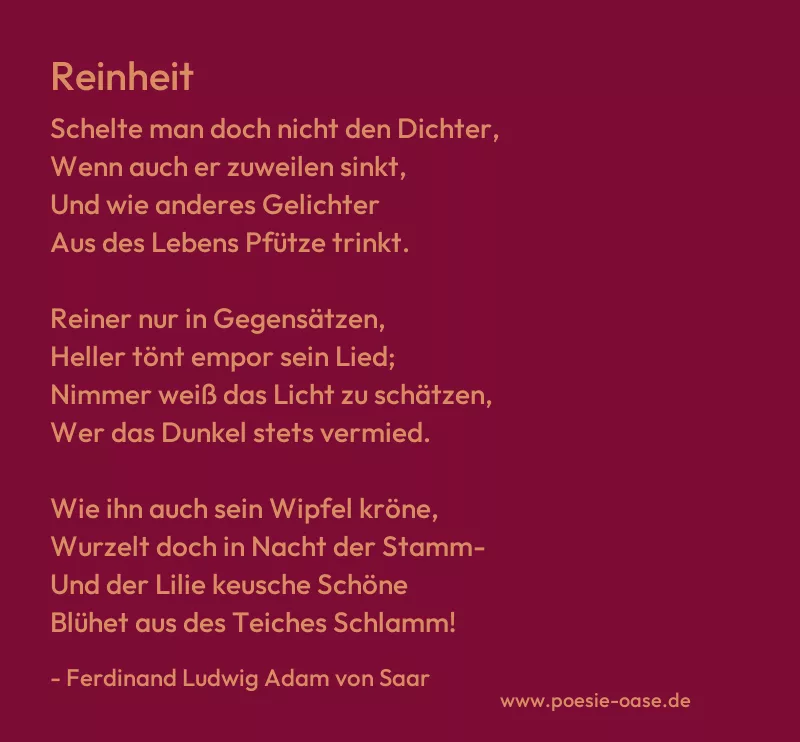Reinheit
Schelte man doch nicht den Dichter,
Wenn auch er zuweilen sinkt,
Und wie anderes Gelichter
Aus des Lebens Pfütze trinkt.
Reiner nur in Gegensätzen,
Heller tönt empor sein Lied;
Nimmer weiß das Licht zu schätzen,
Wer das Dunkel stets vermied.
Wie ihn auch sein Wipfel kröne,
Wurzelt doch in Nacht der Stamm-
Und der Lilie keusche Schöne
Blühet aus des Teiches Schlamm!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
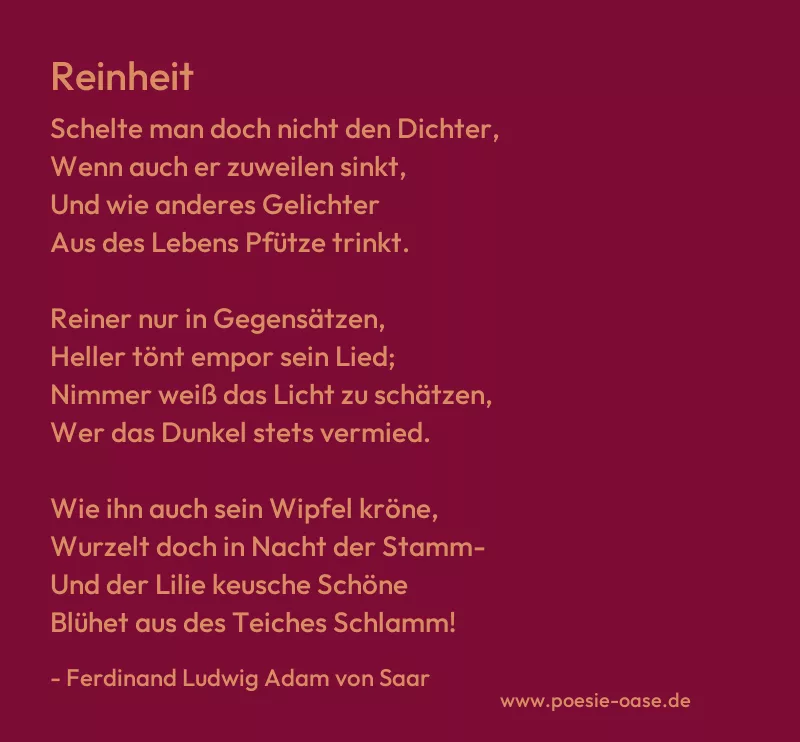
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Reinheit“ von Ferdinand Ludwig Adam von Saar setzt sich mit dem Spannungsfeld zwischen Ideal und menschlicher Schwäche auseinander. Der Dichter wird verteidigt gegen den Vorwurf, sich gelegentlich wie „anderes Gelichter“ in die niederen Gefilde des Lebens zu begeben. Diese Erfahrungen in den „Pfützen“ des Lebens erscheinen nicht als Makel, sondern als notwendige Voraussetzung für die Tiefe und Echtheit seiner Kunst.
Saar betont, dass wahre Reinheit und Helligkeit erst durch den Kontrast zum Dunkel erkennbar werden. Ein Dichter, der nie das Dunkel erfahren hat, könnte auch das Licht nicht wirklich würdigen. Diese Gegensätze – Licht und Dunkel, Reinheit und Befleckung – sind essenziell für ein echtes und bedeutungsvolles dichterisches Schaffen.
Besonders anschaulich wird diese Idee in den beiden eindrucksvollen Bildern der dritten Strophe: Auch ein mächtiger Baum, dessen Wipfel sich der Sonne entgegenstreckt, wurzelt tief in der Dunkelheit der Erde. Ebenso entspringt die „keusche Schöne“ der Lilie aus dem schlammigen Teichgrund. Diese Naturbilder unterstreichen die Notwendigkeit und Würde der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten des Lebens.
Mit klarer Sprache und eingängigen Bildern verteidigt Saar das menschliche Ringen und Scheitern als Teil eines größeren, letztlich schöpferischen Prozesses. Das Gedicht wirbt für eine versöhnliche Sicht auf menschliche Fehlbarkeit und zeigt, dass wahre Reinheit und Schönheit gerade durch das Durchleben und Überwinden von Schwäche entstehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.