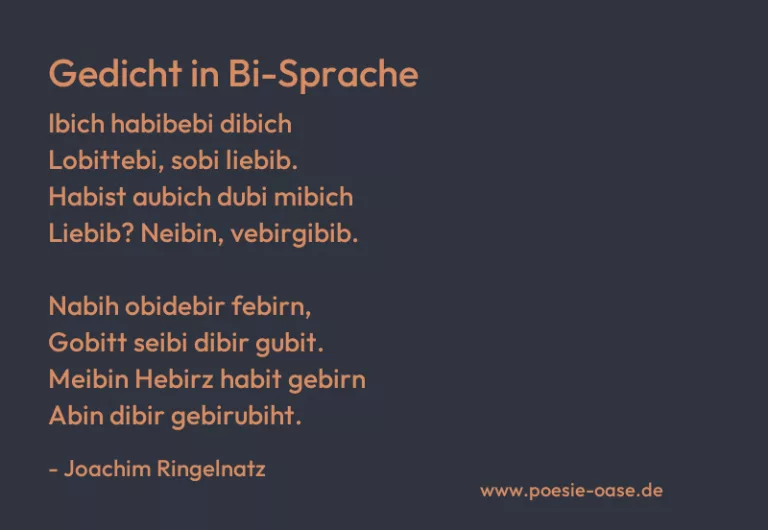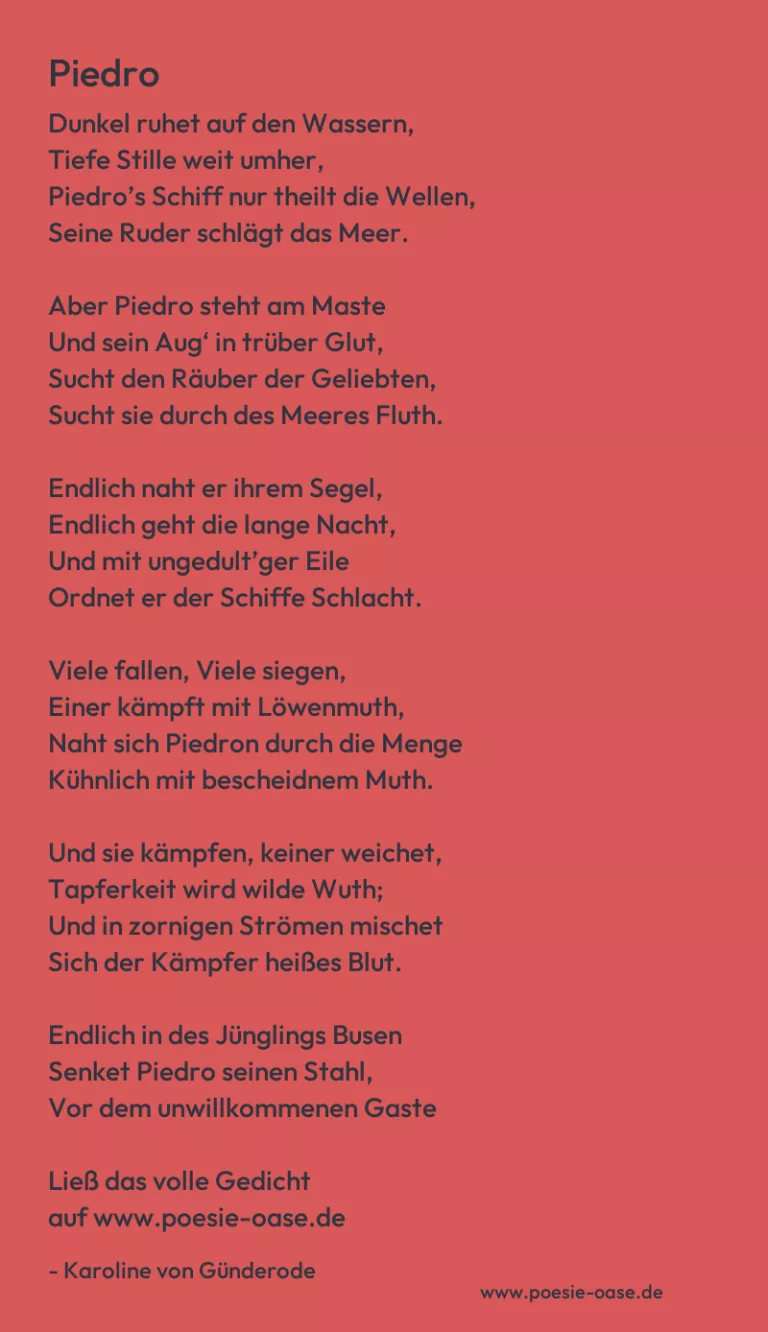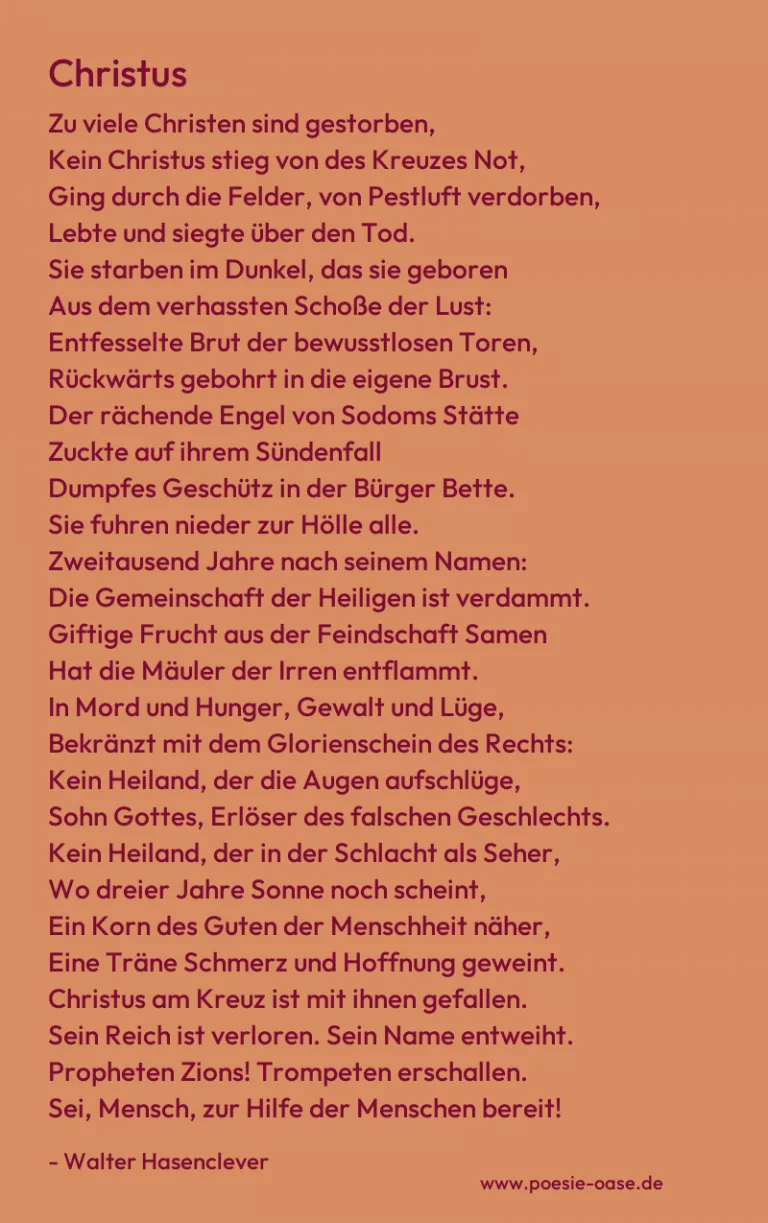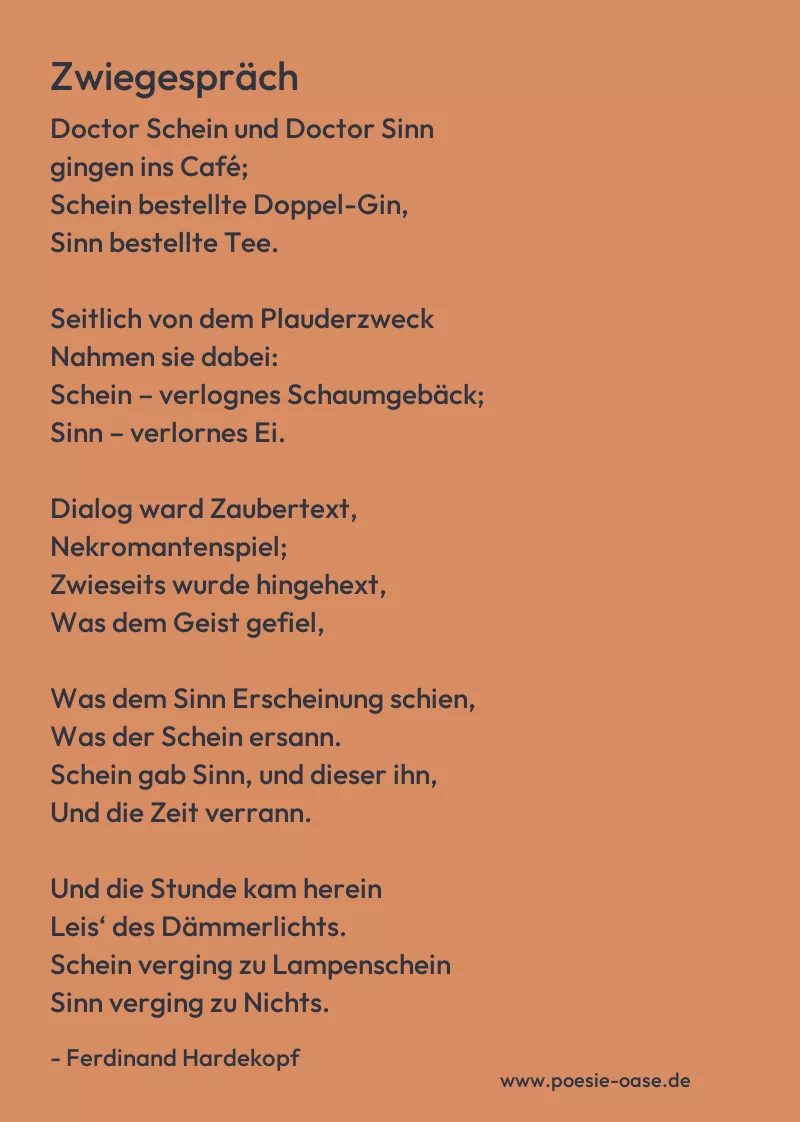Zwiegespräch
Doctor Schein und Doctor Sinn
gingen ins Café;
Schein bestellte Doppel-Gin,
Sinn bestellte Tee.
Seitlich von dem Plauderzweck
Nahmen sie dabei:
Schein – verlognes Schaumgebäck;
Sinn – verlornes Ei.
Dialog ward Zaubertext,
Nekromantenspiel;
Zwieseits wurde hingehext,
Was dem Geist gefiel,
Was dem Sinn Erscheinung schien,
Was der Schein ersann.
Schein gab Sinn, und dieser ihn,
Und die Zeit verrann.
Und die Stunde kam herein
Leis‘ des Dämmerlichts.
Schein verging zu Lampenschein
Sinn verging zu Nichts.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
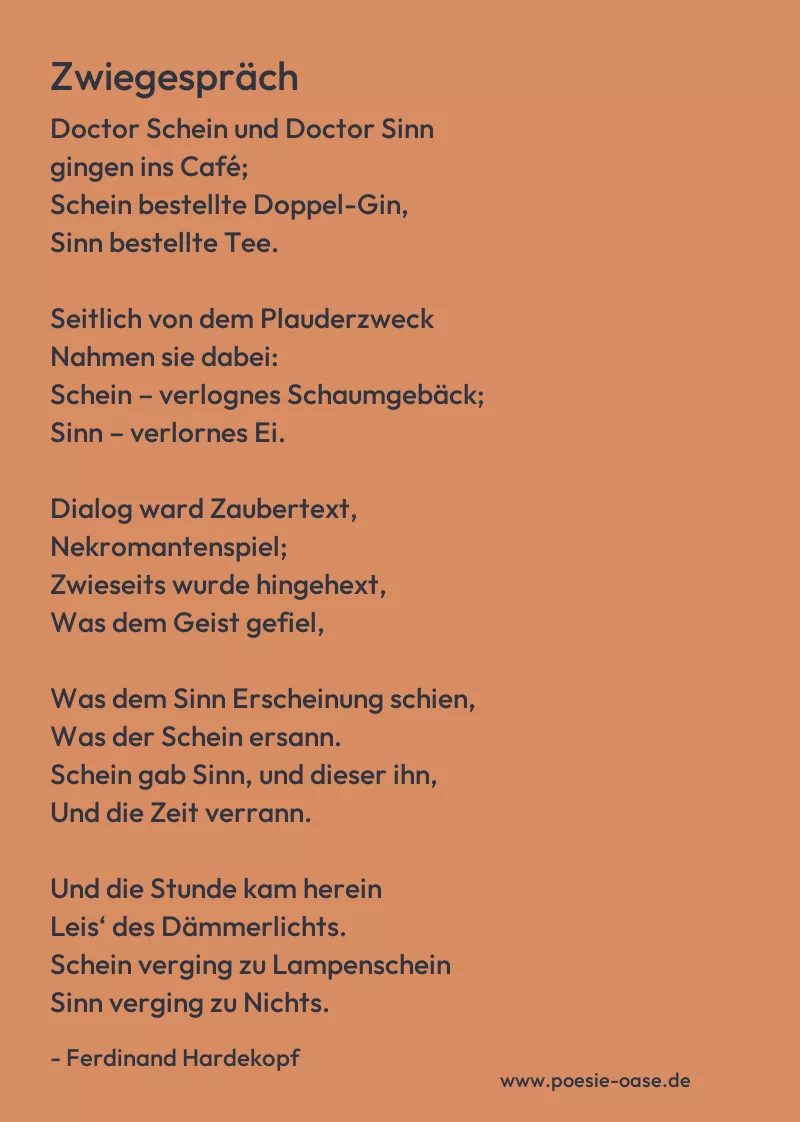
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zwiegespräch“ von Ferdinand Hardekopf ist eine pointierte Allegorie auf das Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sinn, zwei Prinzipien, die im Café – einem typischen Ort der intellektuellen Bohème – aufeinandertreffen. Bereits die Wahl der Getränke – „Doppel-Gin“ für den Schein und „Tee“ für den Sinn – spielt ironisch auf den Gegensatz zwischen dem trügerisch Rauschhaften und dem nüchtern Kontemplativen an. Auch die symbolischen Speisen – „verlognes Schaumgebäck“ und „verlornes Ei“ – unterstreichen die Gegensätzlichkeit und die leicht absurde, ins Groteske gesteigerte Atmosphäre.
Der Dialog zwischen den beiden entwickelt sich zu einem „Zaubertext“ und einem „Nekromantenspiel“. Hier zeigt sich, wie Schein und Sinn in der Sprache und im Denken miteinander verwoben werden, bis die Grenzen verschwimmen. Beide „hexen“ sich gegenseitig Bedeutungen zu, spielen mit Wahrnehmung und Täuschung, bis unklar wird, was real und was illusionär ist.
Hardekopf deutet an, dass die Begriffe sich gegenseitig bedingen: „Schein gab Sinn, und dieser ihn“ – Sinn und Schein sind hier keine Gegensätze mehr, sondern ein sich gegenseitig befruchtendes, aber auch sich auflösendes Spiel der Bedeutungen. Die Zeit verrinnt in dieser endlosen Dialektik, die ins Leere zu laufen scheint.
Im Schlussbild wird diese Auflösung vollendet: Mit dem Einbruch der Dämmerung verliert sich der Schein im „Lampenschein“ und der Sinn im „Nichts“. Der letzte Vers verweist auf die Flüchtigkeit und die Vergeblichkeit solcher intellektuellen Zwiegespräche, die im Unbestimmten enden. Hardekopf verbindet in diesem Gedicht Sprachwitz mit einer ironisch-melancholischen Reflexion über die ewige Dialektik von Oberfläche und Gehalt, von Illusion und Wahrheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.