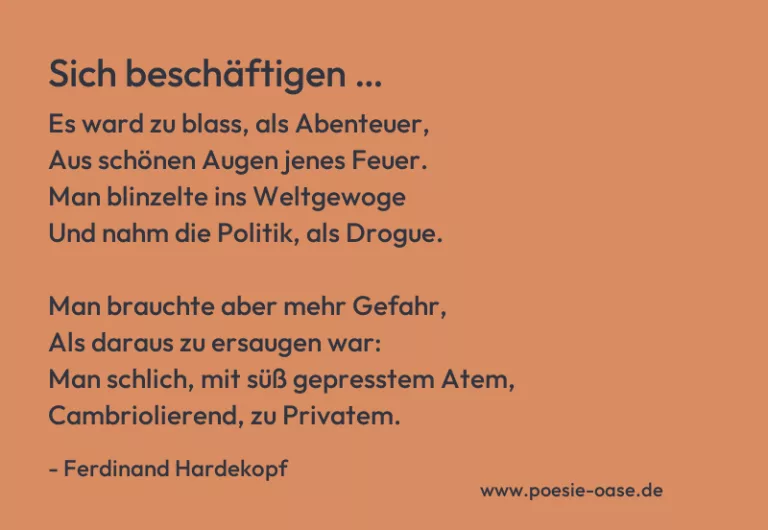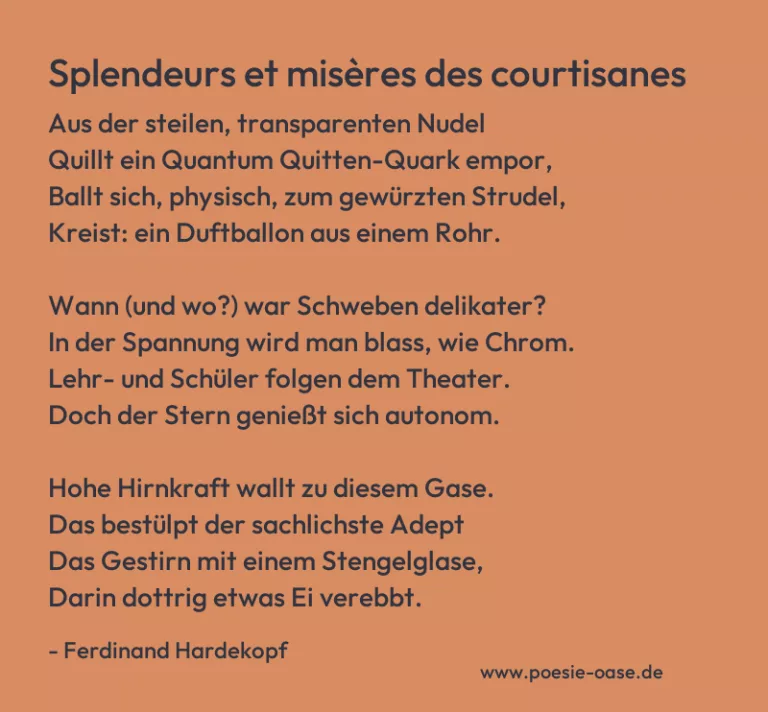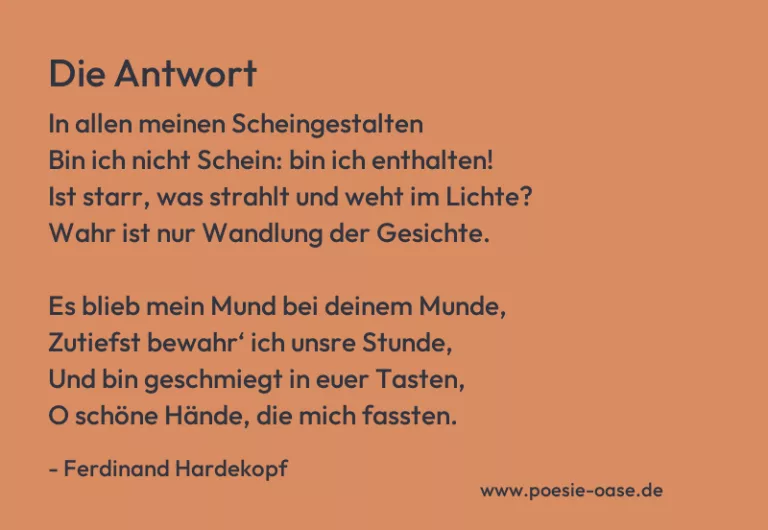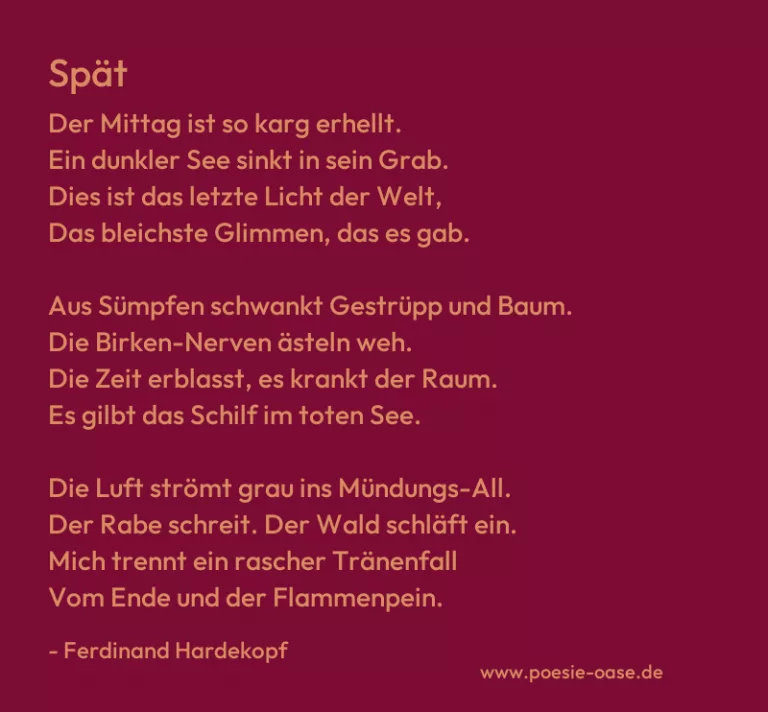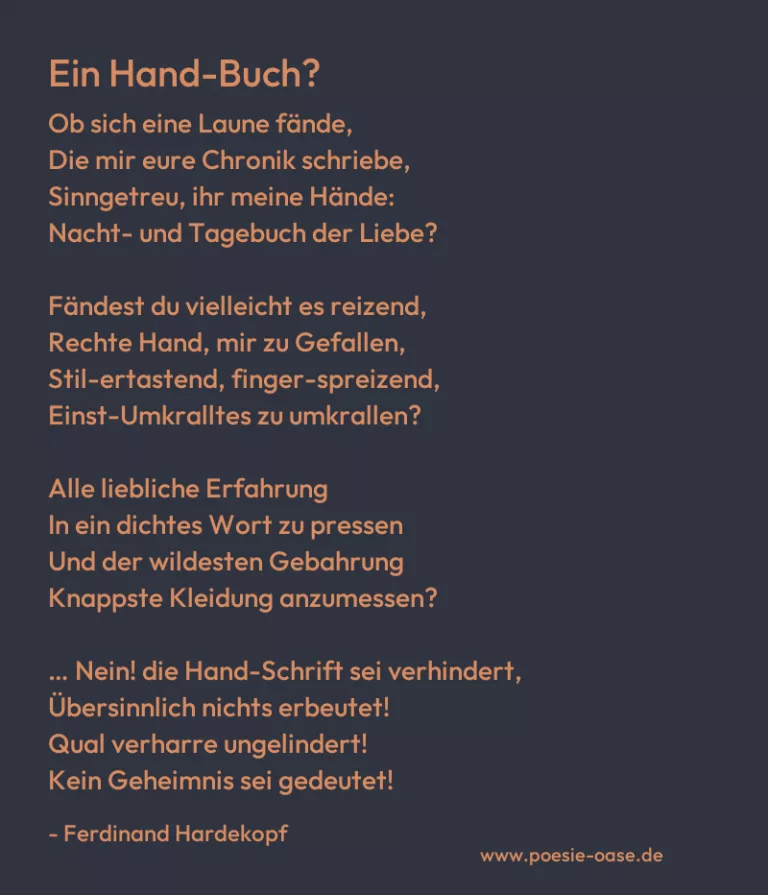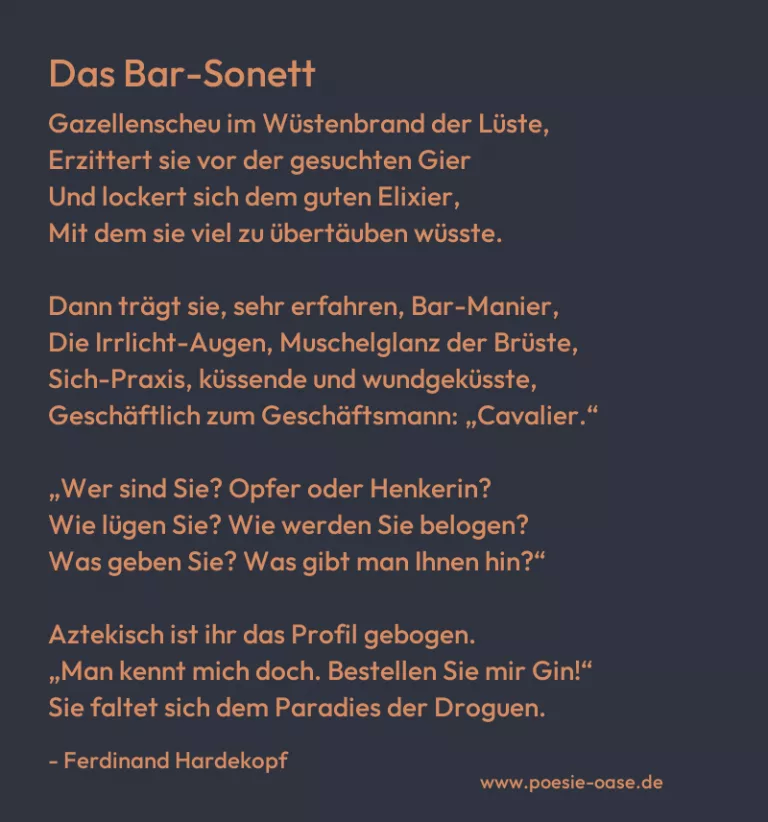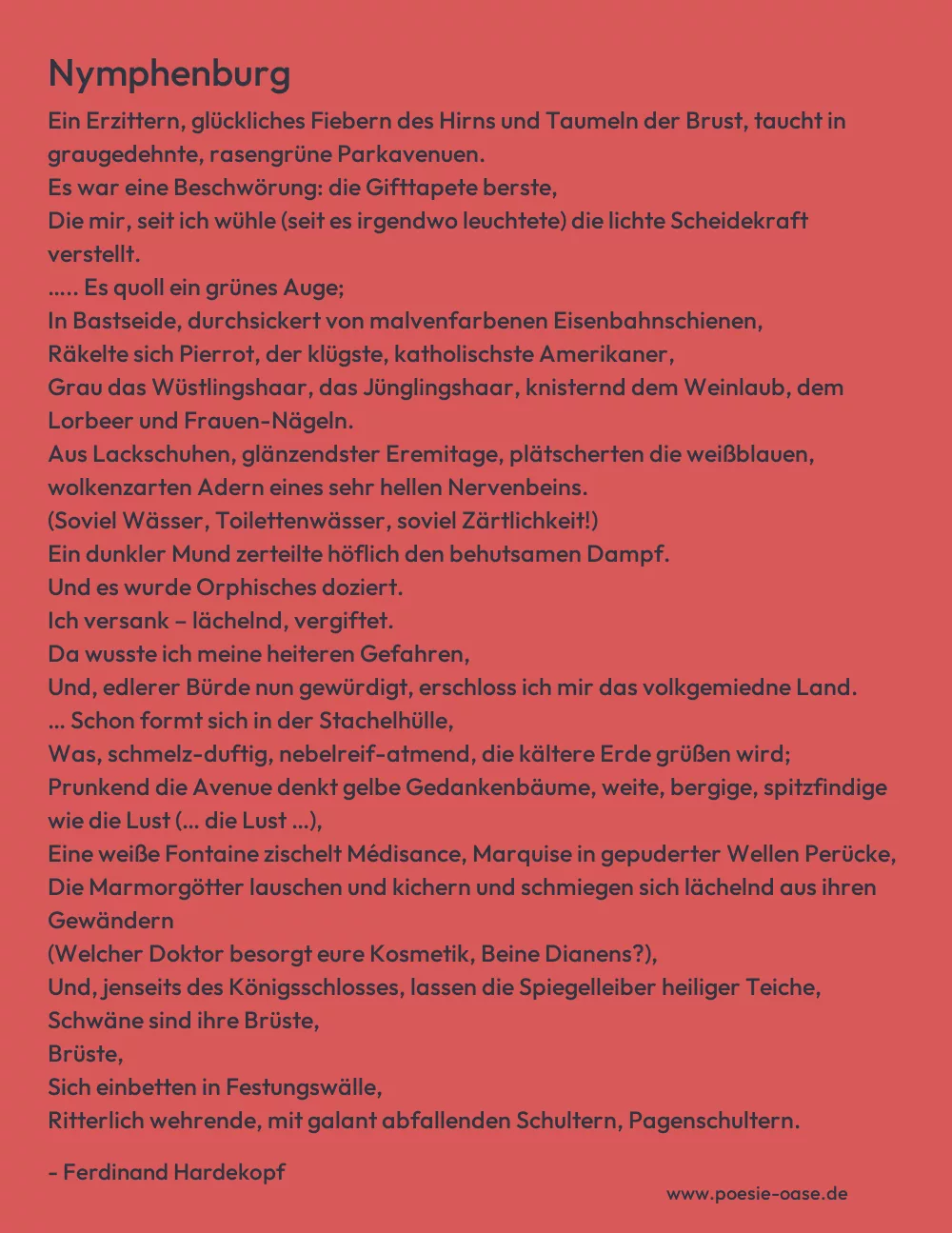Ein Erzittern, glückliches Fiebern des Hirns und Taumeln der Brust, taucht in graugedehnte, rasengrüne Parkavenuen.
Es war eine Beschwörung: die Gifttapete berste,
Die mir, seit ich wühle (seit es irgendwo leuchtete) die lichte Scheidekraft verstellt.
….. Es quoll ein grünes Auge;
In Bastseide, durchsickert von malvenfarbenen Eisenbahnschienen,
Räkelte sich Pierrot, der klügste, katholischste Amerikaner,
Grau das Wüstlingshaar, das Jünglingshaar, knisternd dem Weinlaub, dem Lorbeer und Frauen-Nägeln.
Aus Lackschuhen, glänzendster Eremitage, plätscherten die weißblauen, wolkenzarten Adern eines sehr hellen Nervenbeins.
(Soviel Wässer, Toilettenwässer, soviel Zärtlichkeit!)
Ein dunkler Mund zerteilte höflich den behutsamen Dampf.
Und es wurde Orphisches doziert.
Ich versank – lächelnd, vergiftet.
Da wusste ich meine heiteren Gefahren,
Und, edlerer Bürde nun gewürdigt, erschloss ich mir das volkgemiedne Land.
… Schon formt sich in der Stachelhülle,
Was, schmelz-duftig, nebelreif-atmend, die kältere Erde grüßen wird;
Prunkend die Avenue denkt gelbe Gedankenbäume, weite, bergige, spitzfindige wie die Lust (… die Lust …),
Eine weiße Fontaine zischelt Médisance, Marquise in gepuderter Wellen Perücke,
Die Marmorgötter lauschen und kichern und schmiegen sich lächelnd aus ihren Gewändern
(Welcher Doktor besorgt eure Kosmetik, Beine Dianens?),
Und, jenseits des Königsschlosses, lassen die Spiegelleiber heiliger Teiche,
Schwäne sind ihre Brüste,
Brüste,
Sich einbetten in Festungswälle,
Ritterlich wehrende, mit galant abfallenden Schultern, Pagenschultern.
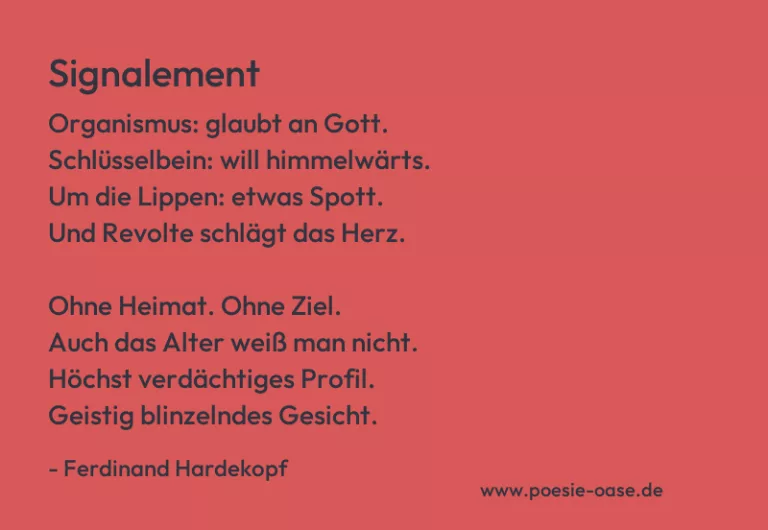
Signalement
- Fortschritt
- Gemeinfrei
- Helden & Prinzessinnen