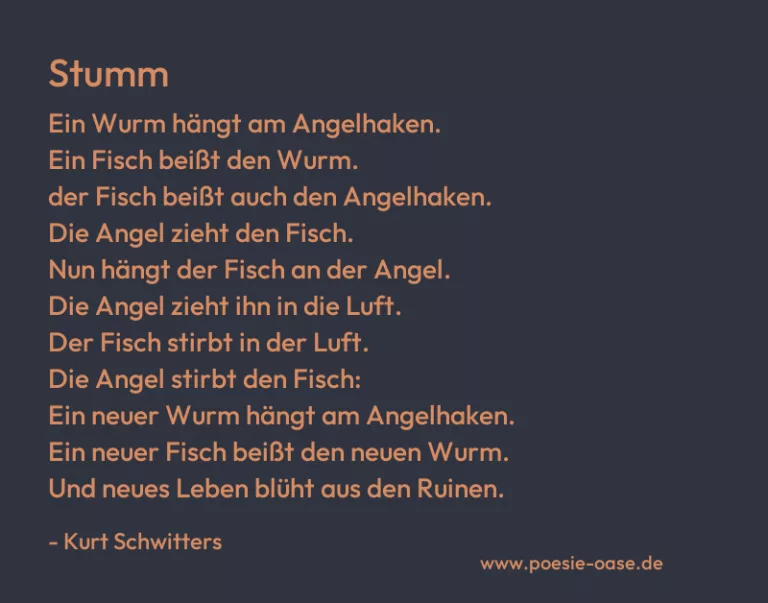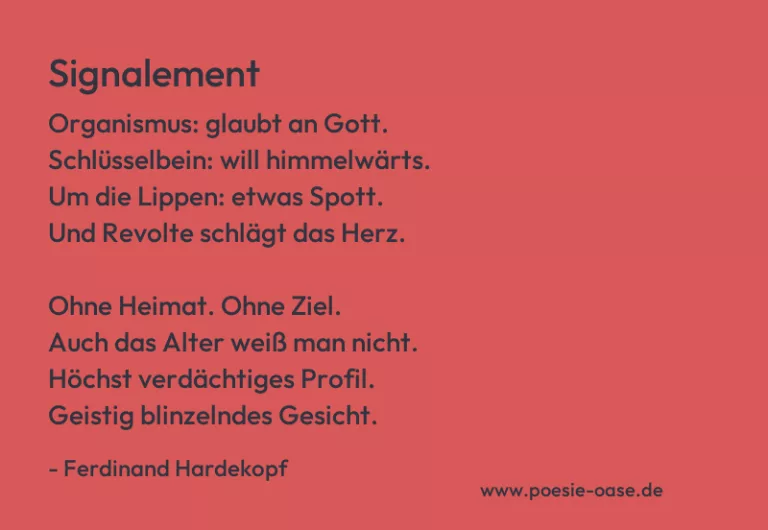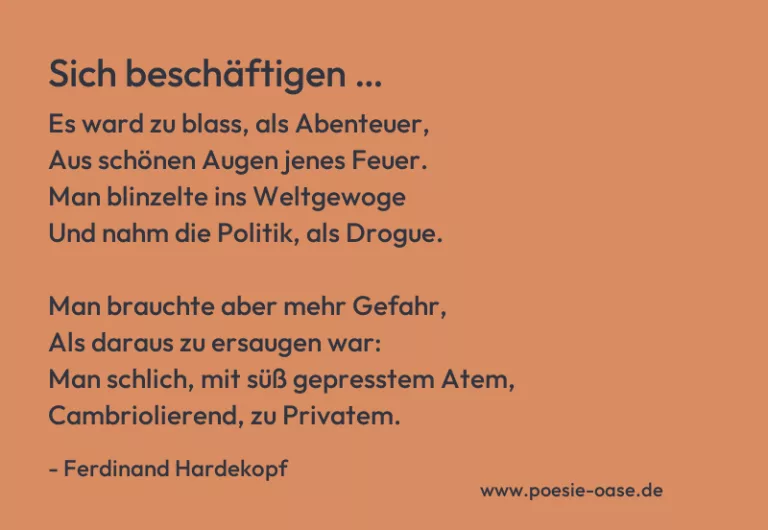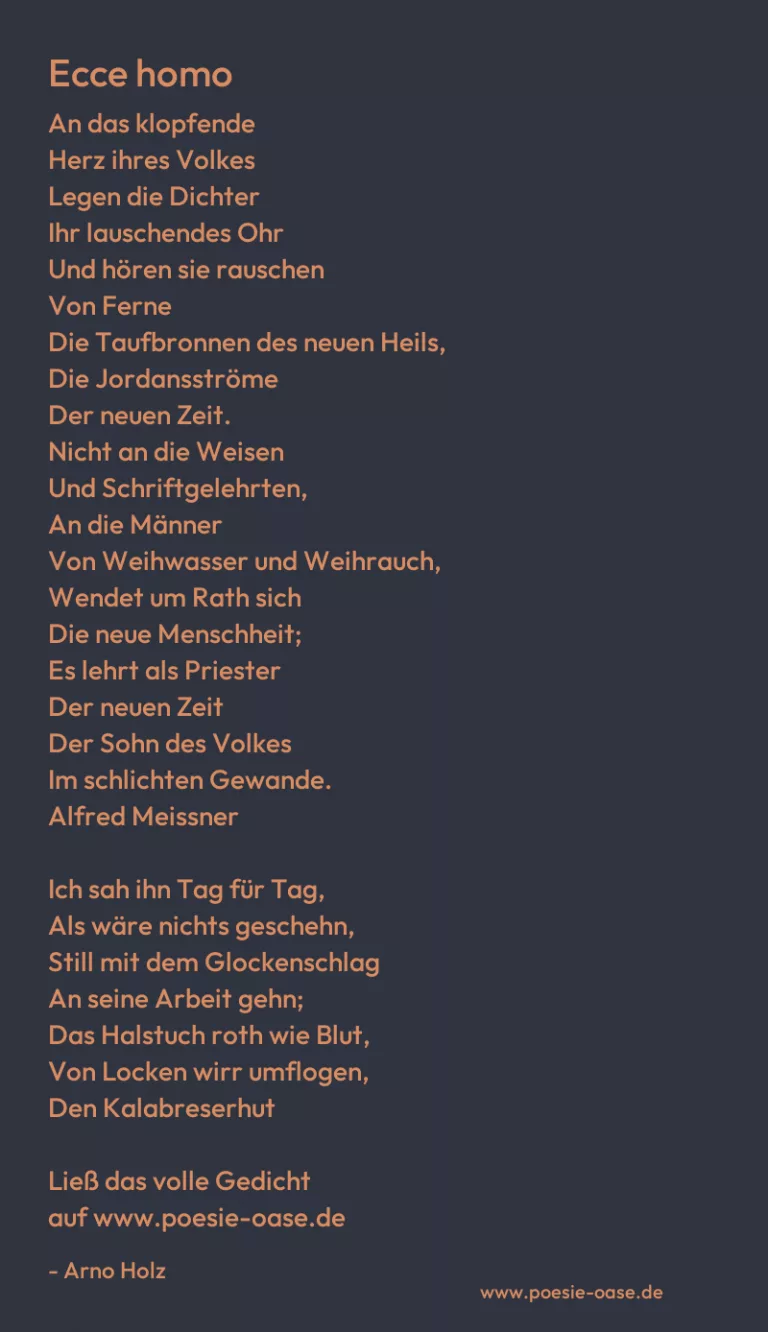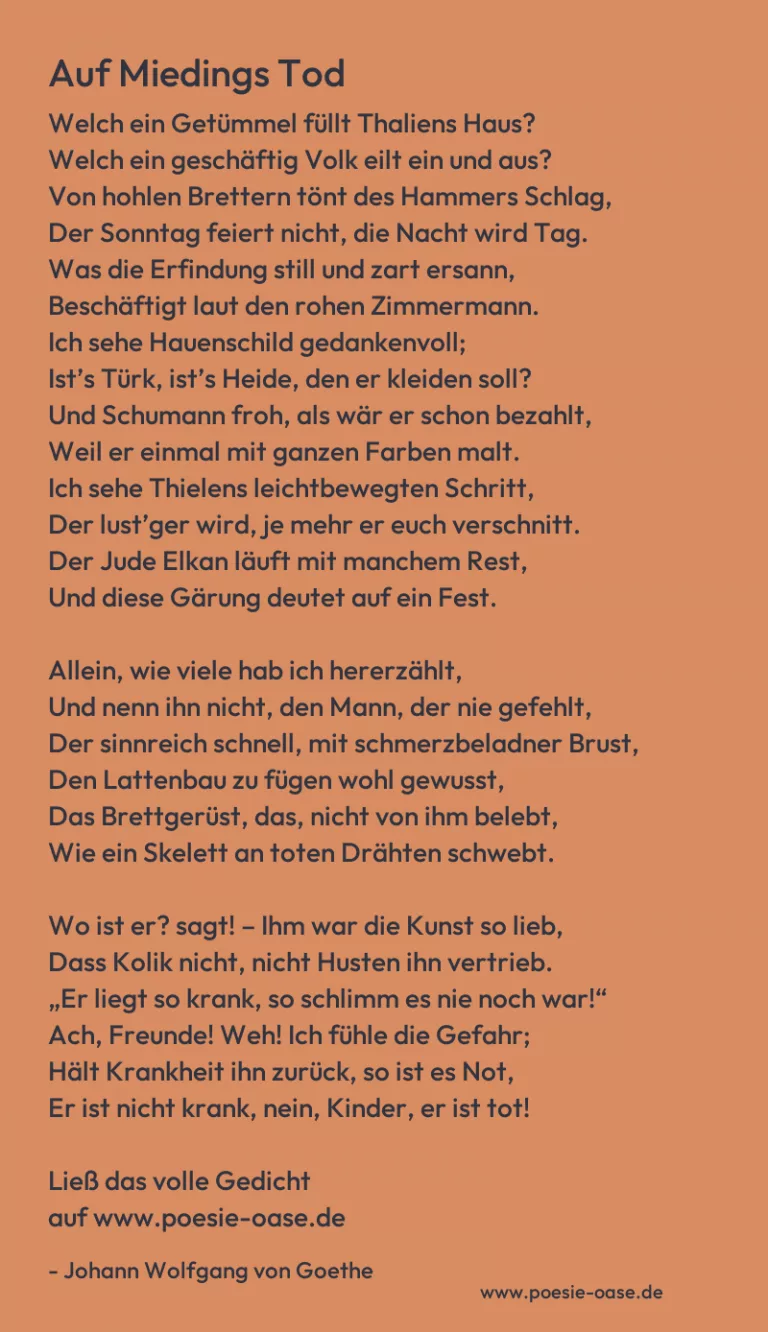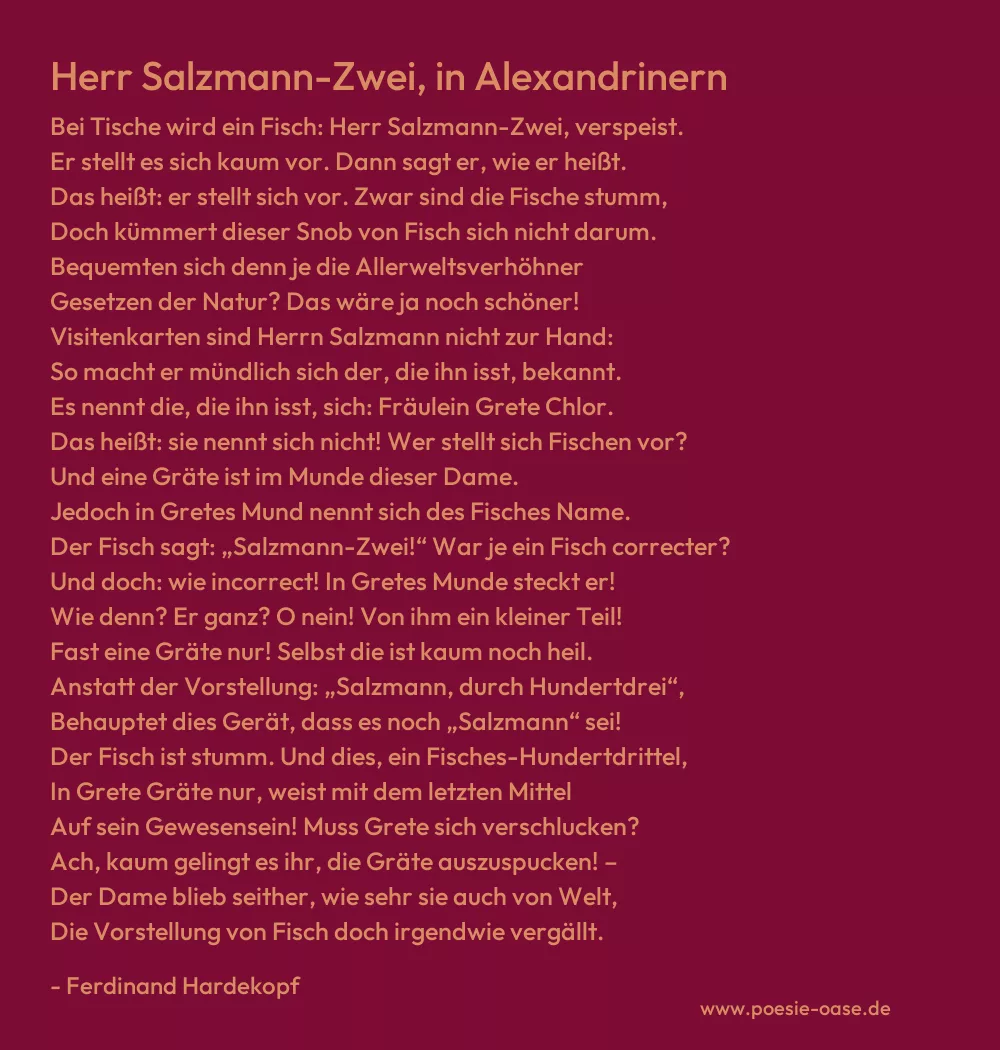Herr Salzmann-Zwei, in Alexandrinern
Bei Tische wird ein Fisch: Herr Salzmann-Zwei, verspeist.
Er stellt es sich kaum vor. Dann sagt er, wie er heißt.
Das heißt: er stellt sich vor. Zwar sind die Fische stumm,
Doch kümmert dieser Snob von Fisch sich nicht darum.
Bequemten sich denn je die Allerweltsverhöhner
Gesetzen der Natur? Das wäre ja noch schöner!
Visitenkarten sind Herrn Salzmann nicht zur Hand:
So macht er mündlich sich der, die ihn isst, bekannt.
Es nennt die, die ihn isst, sich: Fräulein Grete Chlor.
Das heißt: sie nennt sich nicht! Wer stellt sich Fischen vor?
Und eine Gräte ist im Munde dieser Dame.
Jedoch in Gretes Mund nennt sich des Fisches Name.
Der Fisch sagt: „Salzmann-Zwei!“ War je ein Fisch correcter?
Und doch: wie incorrect! In Gretes Munde steckt er!
Wie denn? Er ganz? O nein! Von ihm ein kleiner Teil!
Fast eine Gräte nur! Selbst die ist kaum noch heil.
Anstatt der Vorstellung: „Salzmann, durch Hundertdrei“,
Behauptet dies Gerät, dass es noch „Salzmann“ sei!
Der Fisch ist stumm. Und dies, ein Fisches-Hundertdrittel,
In Grete Gräte nur, weist mit dem letzten Mittel
Auf sein Gewesensein! Muss Grete sich verschlucken?
Ach, kaum gelingt es ihr, die Gräte auszuspucken! –
Der Dame blieb seither, wie sehr sie auch von Welt,
Die Vorstellung von Fisch doch irgendwie vergällt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
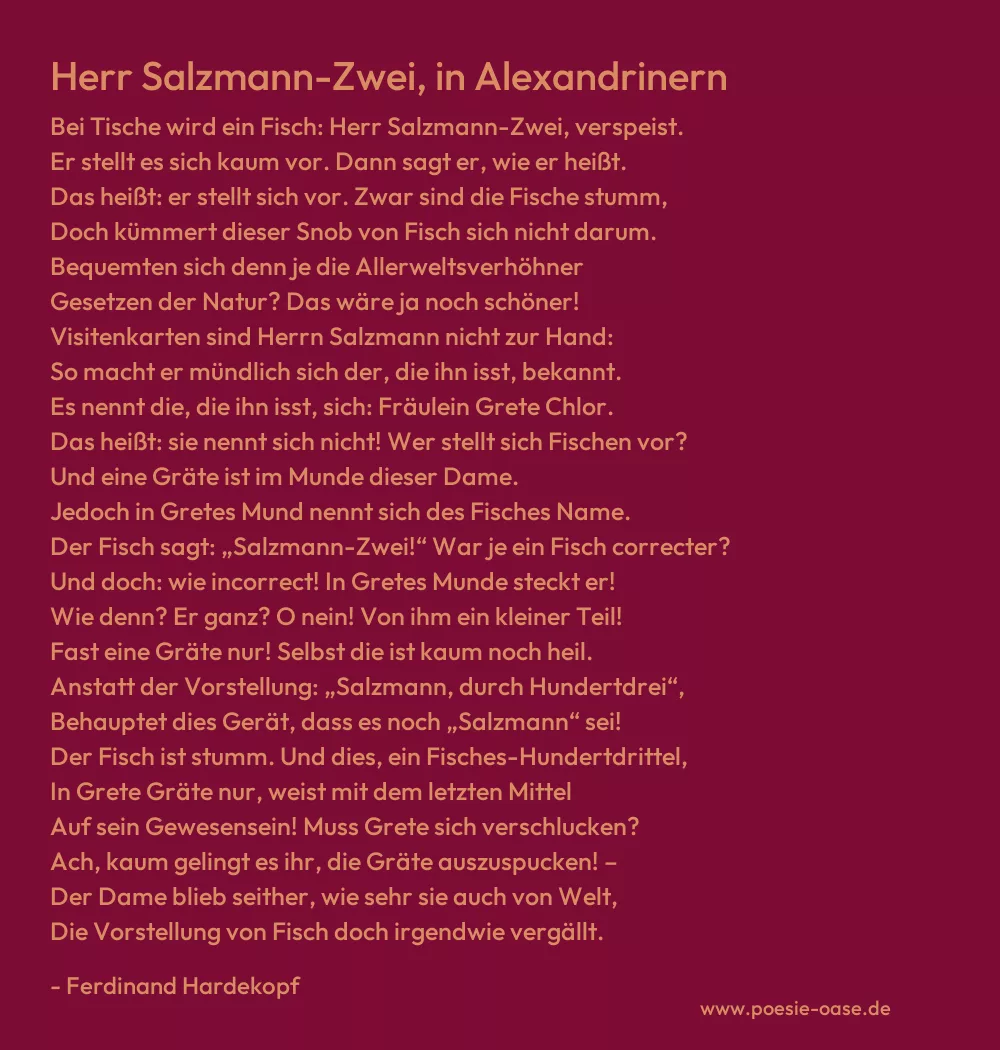
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Herr Salzmann-Zwei, in Alexandrinern“ von Ferdinand Hardekopf ist eine humorvolle und zugleich absurde Parodie auf bürgerliche Konventionen und sprachliche Förmlichkeit. Im Zentrum steht ein Fisch, der entgegen aller Naturgesetze die Fähigkeit zur Vorstellung besitzt. Bereits der Name „Herr Salzmann-Zwei“ wirkt skurril und verweist auf eine übertriebene Höflichkeit, die in grotesker Weise in die Welt der Tiere übertragen wird. Die ironische Brechung beginnt mit der Tatsache, dass sich der Fisch – „der Snob von Fisch“ – bei Tisch selbst vorstellt, obwohl Fische bekanntermaßen stumm sind.
Die Figur des Fisches wird zur Karikatur eines überkorrekten, bürgerlichen Gentlemen, der selbst noch im Moment seines Verzehrtwerdens Wert auf Etikette legt. Die Wortspiele und Verdrehungen („stellt es sich kaum vor“, „stellt sich vor“) erzeugen eine komische Wirkung und spielen mit der Doppeldeutigkeit von Alltagsfloskeln. Der Fisch ignoriert die Naturgesetze ebenso wie die absurde Situation, dass er sich der ihn verzehrenden Person, Fräulein Grete Chlor, bekannt macht – eine höfliche Geste, die hier ins Groteske kippt.
Die Pointe des Gedichts liegt in der Gräte, die im Mund der Dame stecken bleibt und symbolisch für das unpassende und aufdringliche Verhalten des Fisches steht. Obwohl der Fisch physisch fast gänzlich verspeist ist, bleibt ein „Fisches-Hundertdrittel“ zurück, das weiterhin auf sein „Gewesensein“ verweist. Die Komik entsteht aus der Überhöhung des Banalen: Ein alltäglicher Vorfall wie das Verschlucken einer Gräte wird als dramatisches Ereignis dargestellt, das sogar Gretes zukünftige Beziehung zu Fischgerichten nachhaltig beeinträchtigt.
Hardekopf parodiert mit dem Gedicht die steife bürgerliche Gesellschaft, die selbst in absurden Situationen nicht von Förmlichkeit und Konvention lassen kann. Die Reimstruktur und der klassische Alexandriner-Versmaß wirken dabei zusätzlich wie eine bewusste Übertreibung und verstärken den ironischen Tonfall der gesamten Szene. Das Gedicht changiert geschickt zwischen Sprachwitz, Gesellschaftssatire und surrealem Humor.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.