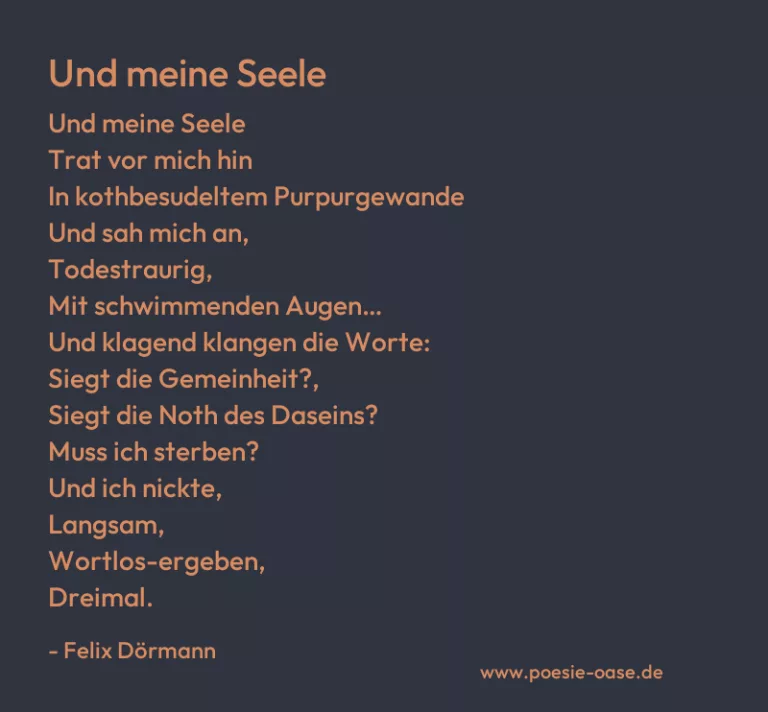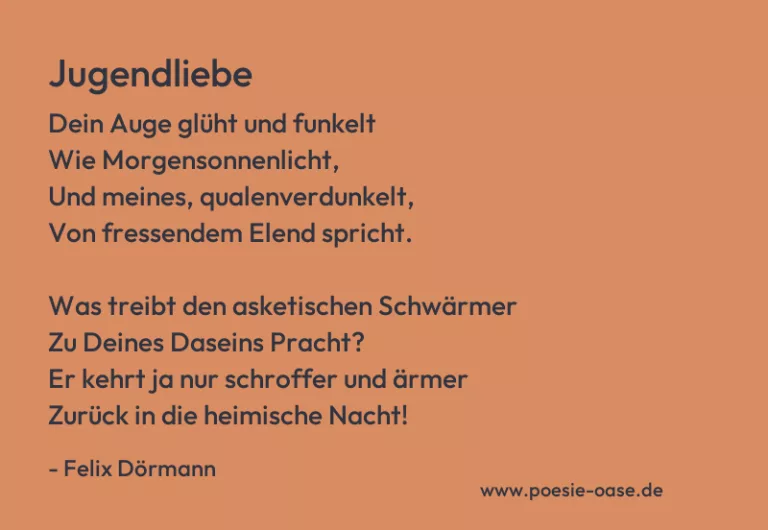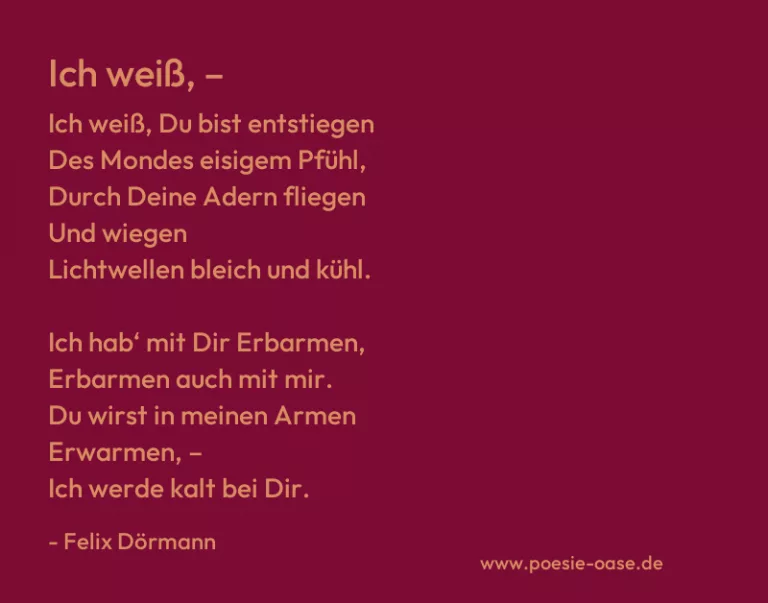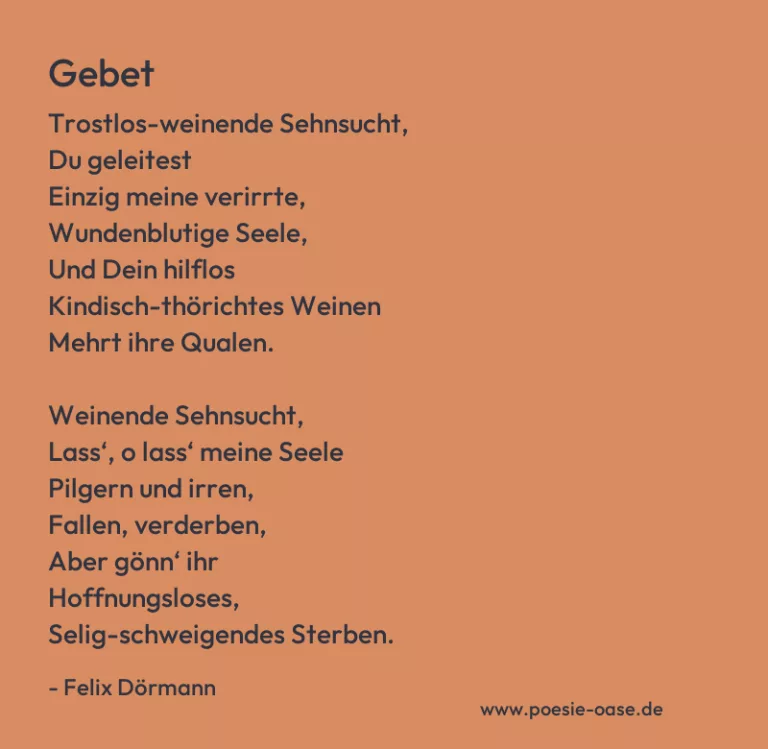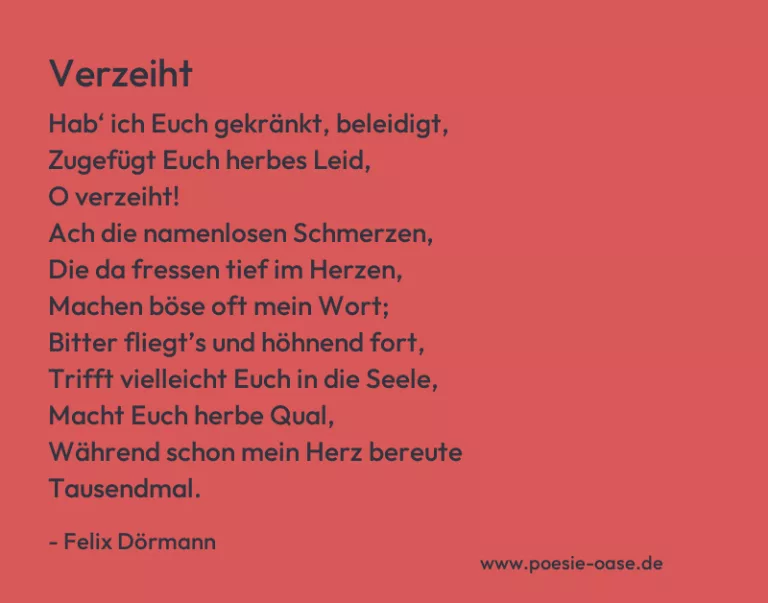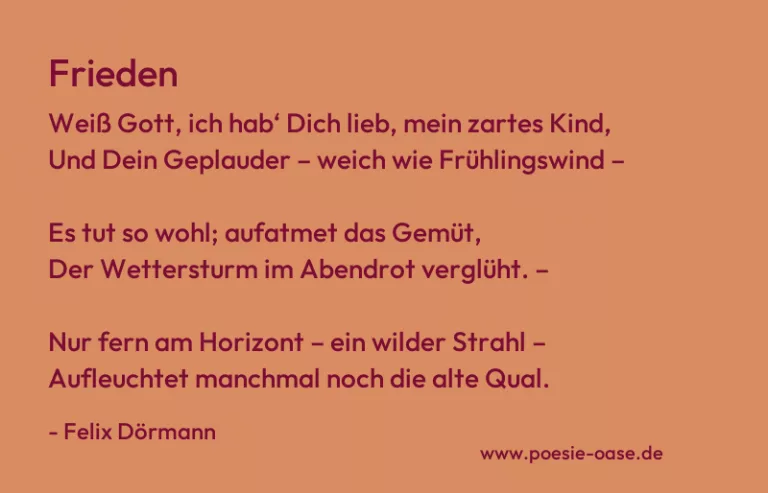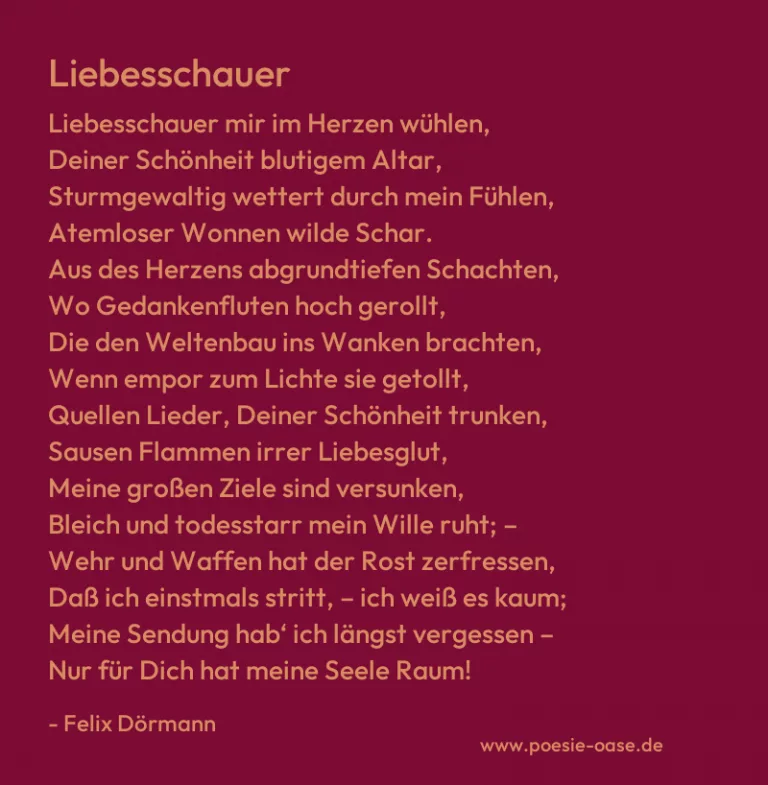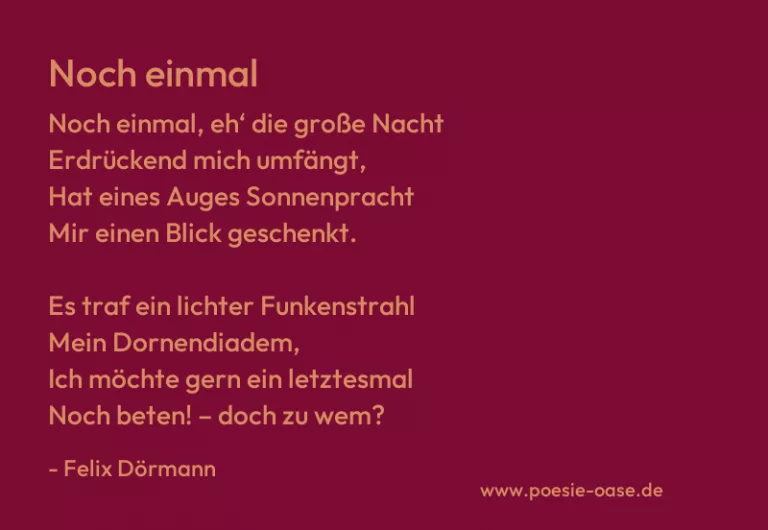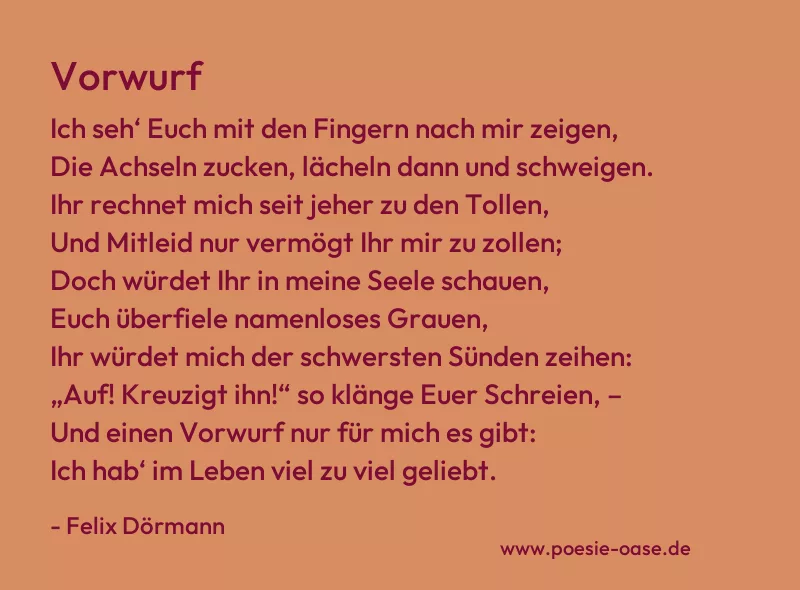Vorwurf
Ich seh‘ Euch mit den Fingern nach mir zeigen,
Die Achseln zucken, lächeln dann und schweigen.
Ihr rechnet mich seit jeher zu den Tollen,
Und Mitleid nur vermögt Ihr mir zu zollen;
Doch würdet Ihr in meine Seele schauen,
Euch überfiele namenloses Grauen,
Ihr würdet mich der schwersten Sünden zeihen:
„Auf! Kreuzigt ihn!“ so klänge Euer Schreien, –
Und einen Vorwurf nur für mich es gibt:
Ich hab‘ im Leben viel zu viel geliebt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
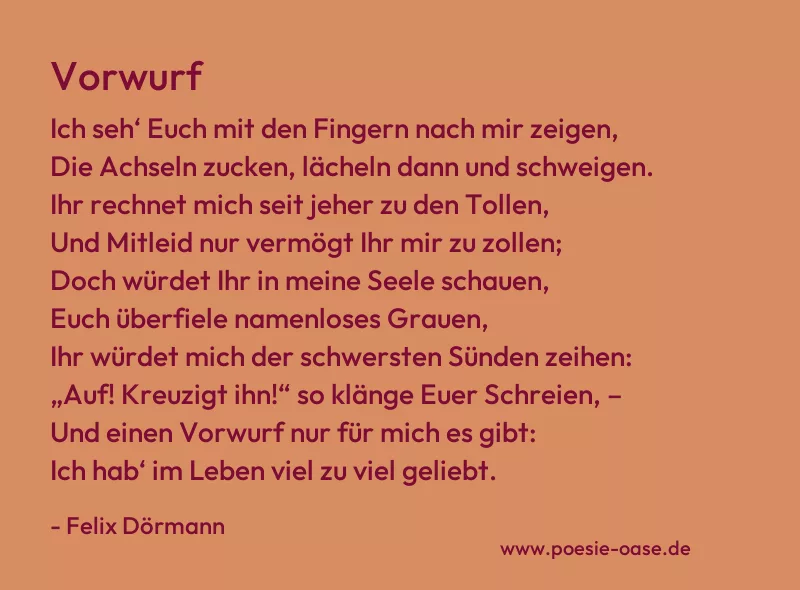
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vorwurf“ von Felix Dörmann thematisiert die Ausgrenzung und das Unverständnis, das dem lyrischen Ich von seiner Umwelt entgegenschlägt. Im Zentrum steht die Kluft zwischen der äußeren Wahrnehmung und der inneren Wirklichkeit des lyrischen Ichs. Während die Außenwelt das lyrische Ich als „toll“ und mitleidserregend betrachtet, offenbart sich in dessen Innerem eine tiefere, dunklere Wahrheit, die Angst und Abscheu hervorrufen würde.
Das lyrische Ich fühlt sich missverstanden und als Außenseiter abgestempelt, was sich in der Beschreibung von Gesten wie „Fingern nach mir zeigen“ und „Achseln zucken“ ausdrückt. Doch diese gesellschaftliche Verurteilung wirkt oberflächlich, da die Betrachter nur die äußere Erscheinung werten. Im Kontrast dazu steht die Aussage, dass der Blick in die „Seele“ des lyrischen Ichs ein „namenloses Grauen“ auslösen würde. Damit wird eine innere Zerrissenheit und eine dunkle Komplexität angedeutet, die für die Außenstehenden unsichtbar bleibt.
Besonders eindrücklich ist die Wendung, dass die vermeintlich Mitleidigen bei echter Erkenntnis zum Ruf „Kreuzigt ihn!“ übergehen würden. Hier bedient sich Dörmann einer Anspielung auf das biblische Motiv der Verurteilung und Ausstoßung. Das lyrische Ich stilisiert sich als eine Art tragische Figur, die – wie ein Sündenbock – verurteilt würde, wenn seine wahre Tiefe sichtbar wäre.
Die abschließende Selbsterkenntnis gibt dem Gedicht eine bitter-ironische Note: Der einzige „Vorwurf“ bestehe darin, „viel zu viel geliebt“ zu haben. Diese Schlusszeile setzt einen Kontrapunkt zur vorher angedeuteten Schwere und lässt die Liebe als Ursache der inneren Konflikte und des Andersseins erscheinen. Damit wird das Gedicht zu einer kritischen Reflexion über gesellschaftliche Vorurteile und die Tragik eines Menschen, der an seiner übergroßen Emotionalität scheitert oder daran von der Welt gescheitert wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.