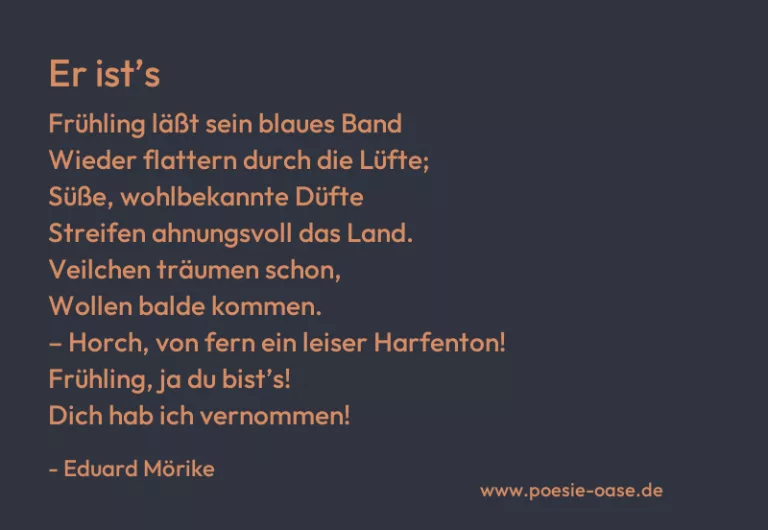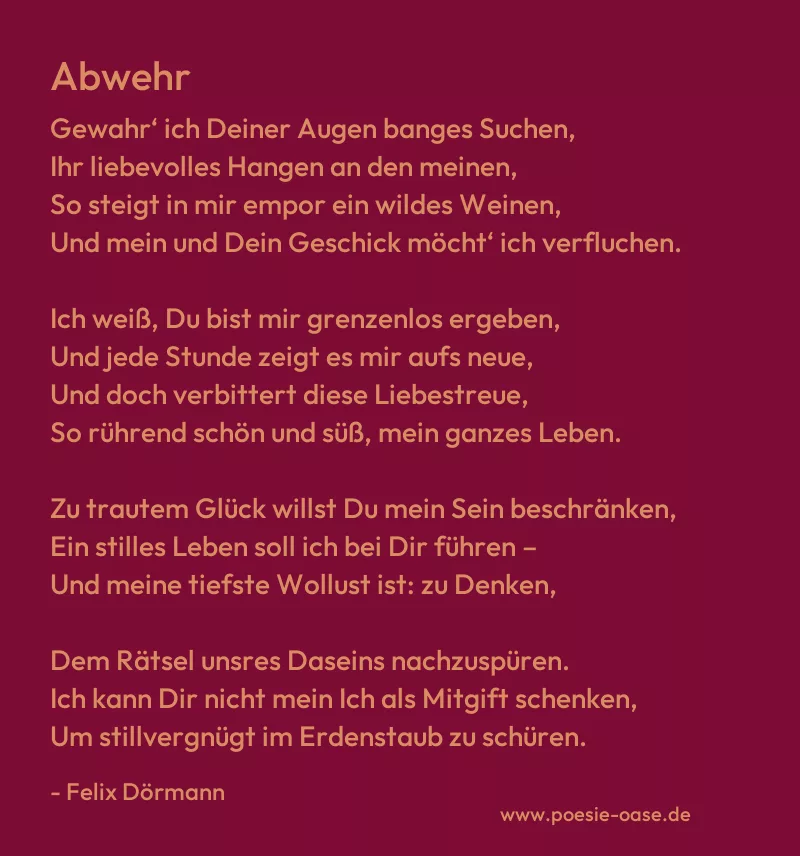Abwehr
Gewahr‘ ich Deiner Augen banges Suchen,
Ihr liebevolles Hangen an den meinen,
So steigt in mir empor ein wildes Weinen,
Und mein und Dein Geschick möcht‘ ich verfluchen.
Ich weiß, Du bist mir grenzenlos ergeben,
Und jede Stunde zeigt es mir aufs neue,
Und doch verbittert diese Liebestreue,
So rührend schön und süß, mein ganzes Leben.
Zu trautem Glück willst Du mein Sein beschränken,
Ein stilles Leben soll ich bei Dir führen –
Und meine tiefste Wollust ist: zu Denken,
Dem Rätsel unsres Daseins nachzuspüren.
Ich kann Dir nicht mein Ich als Mitgift schenken,
Um stillvergnügt im Erdenstaub zu schüren.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
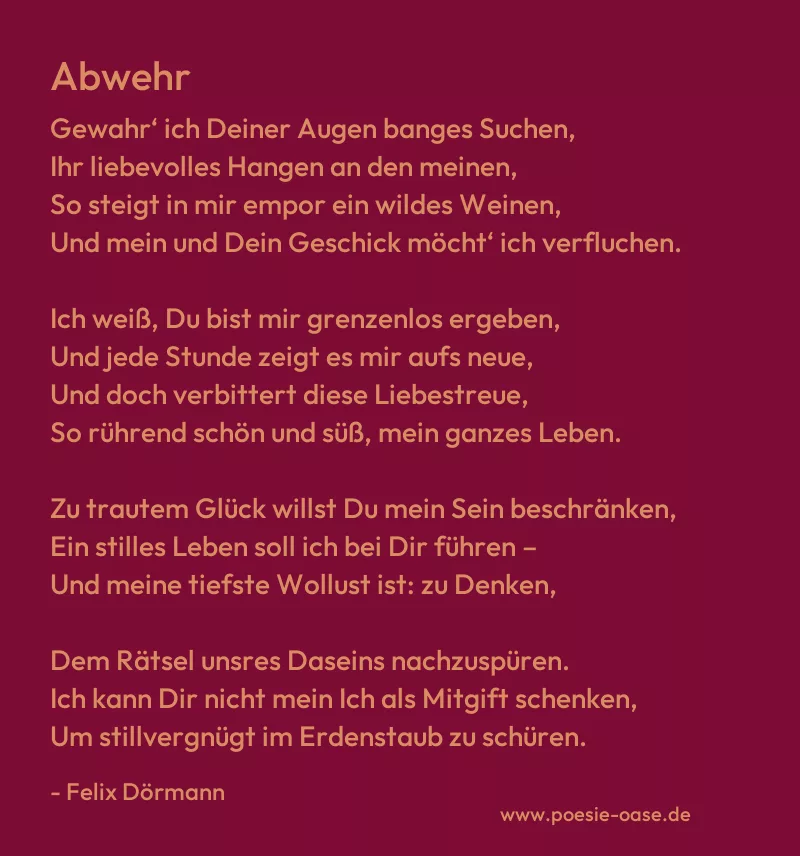
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abwehr“ von Felix Dörmann beschreibt die innere Zerrissenheit eines Menschen, der zwischen der Liebe zu einer anderen Person und seinem eigenen Wunsch nach Unabhängigkeit und geistiger Freiheit hin- und hergerissen ist. Der Sprecher erkennt die „liebevolle Hingabe“ des anderen, die in den „bangenden Augen“ und dem „Hangen an den meinen“ deutlich wird. Diese Zuneigung weckt in ihm jedoch ein „wildes Weinen“, das nicht nur aus Freude, sondern auch aus Schmerz und Frustration resultiert, da er sich in dieser Bindung eingeengt fühlt.
Der Konflikt zwischen den Gefühlen für den anderen und dem Drang nach Freiheit wird im Gedicht durch die widersprüchliche Wahrnehmung der „Liebestreue“ verdeutlicht. Obwohl er die „grenzenlose“ Hingabe des anderen zu schätzen weiß, empfindet der Sprecher diese Zuneigung als „verbittert“, da sie sein Leben einengt. Die Schönheit und Rührung, die in der Liebe des anderen liegen, erscheinen ihm gleichzeitig als eine Last, die ihn in seiner Entfaltung hemmt.
Im dritten Vers des Gedichts wird der Wunsch nach „zu trautem Glück“ und einem „stillen Leben“ geäußert, das der Sprecher jedoch nicht teilen kann. Die Idee, mit dem anderen in einer Art harmonischer Ruhe zu leben, erscheint ihm als einengt und unsinnig, weil es den Drang seines eigenen Geistes nach Erkenntnis und Freiheit unterdrücken würde. Er sehnt sich danach, „dem Rätsel unsres Daseins nachzuspüren“ und verweigert sich einer Beziehung, die ihn auf die Rolle eines ruhigen, geselliger Lebensabschnitts reduziert.
Das Gedicht endet mit einer klaren Ablehnung dieser Lebensweise. Der Sprecher kann „sein Ich“ nicht als „Mitgift schenken“, weil dies für ihn einen Verlust seiner Identität und seines geistigen Horizonts bedeuten würde. Die Vorstellung, „im Erdenstaub zu schüren“, verweist auf die Trivialität und die Selbstaufgabe, die er in einem beschaulichen, von äußeren Erwartungen geprägten Leben sieht. Dörmann drückt hier eine tiefe Sehnsucht nach geistiger Freiheit aus, die ihn von den Bindungen der Liebe und der Konventionen der Gesellschaft befreit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.