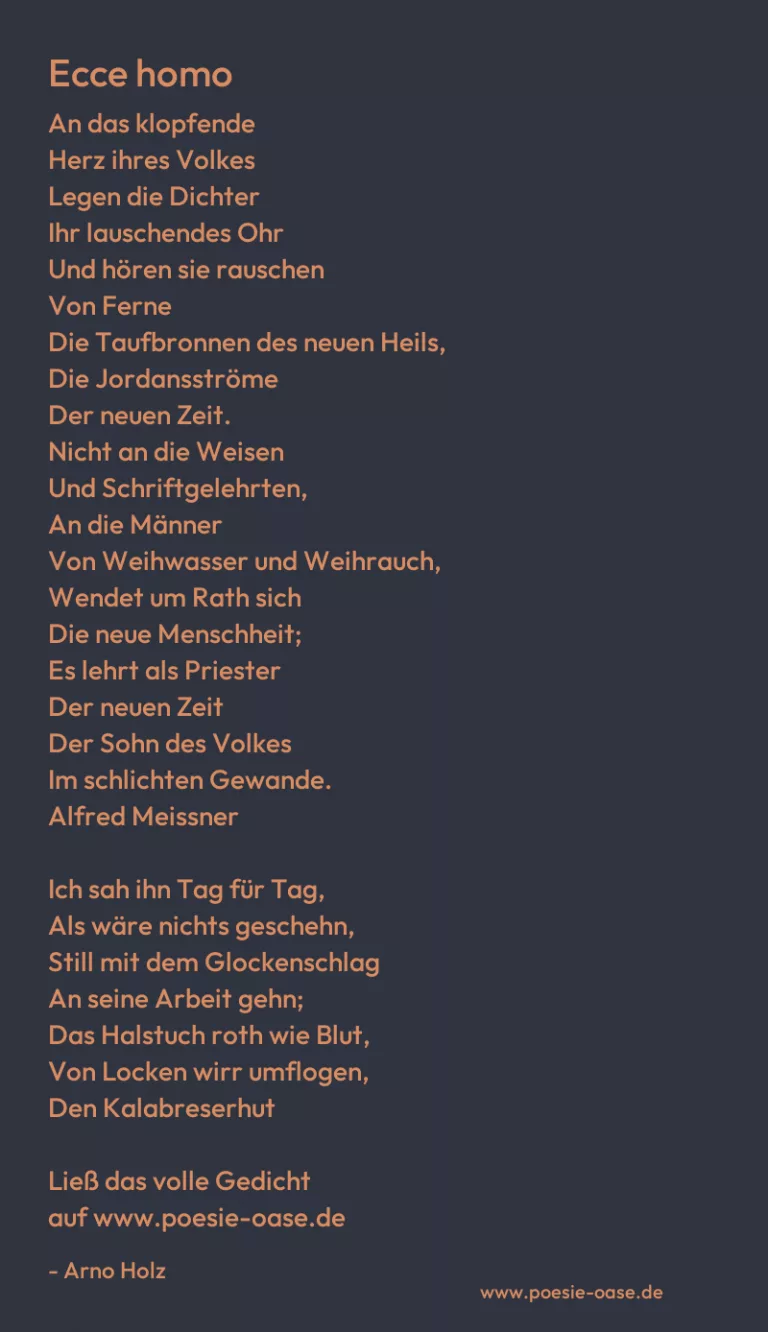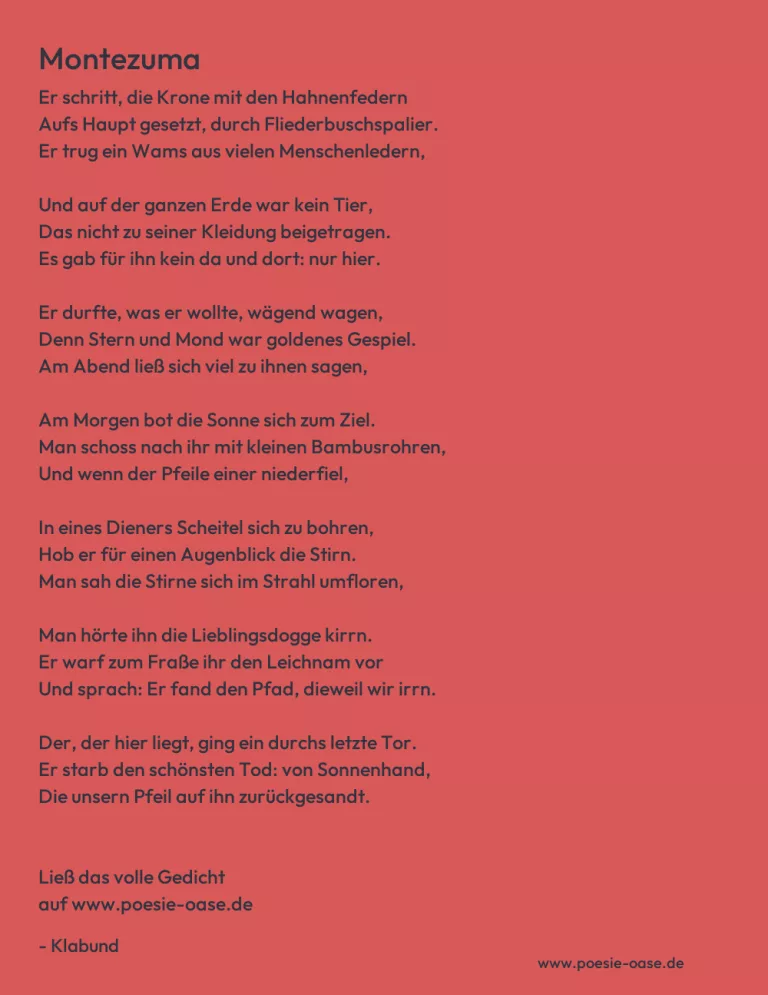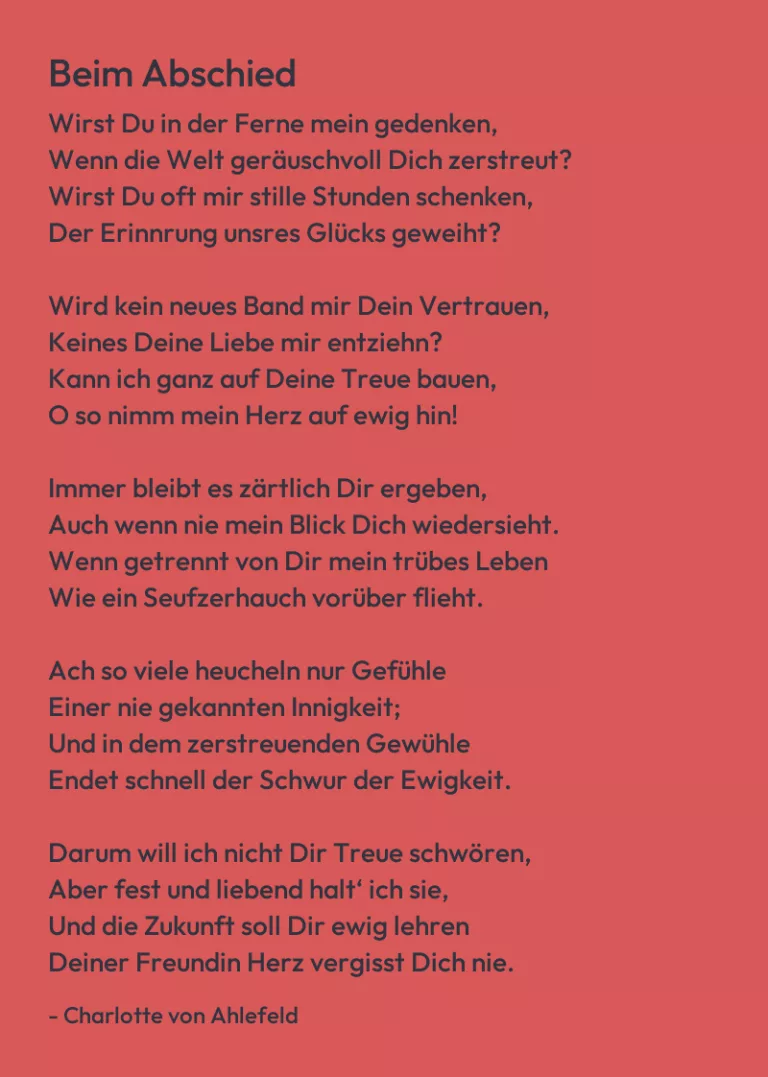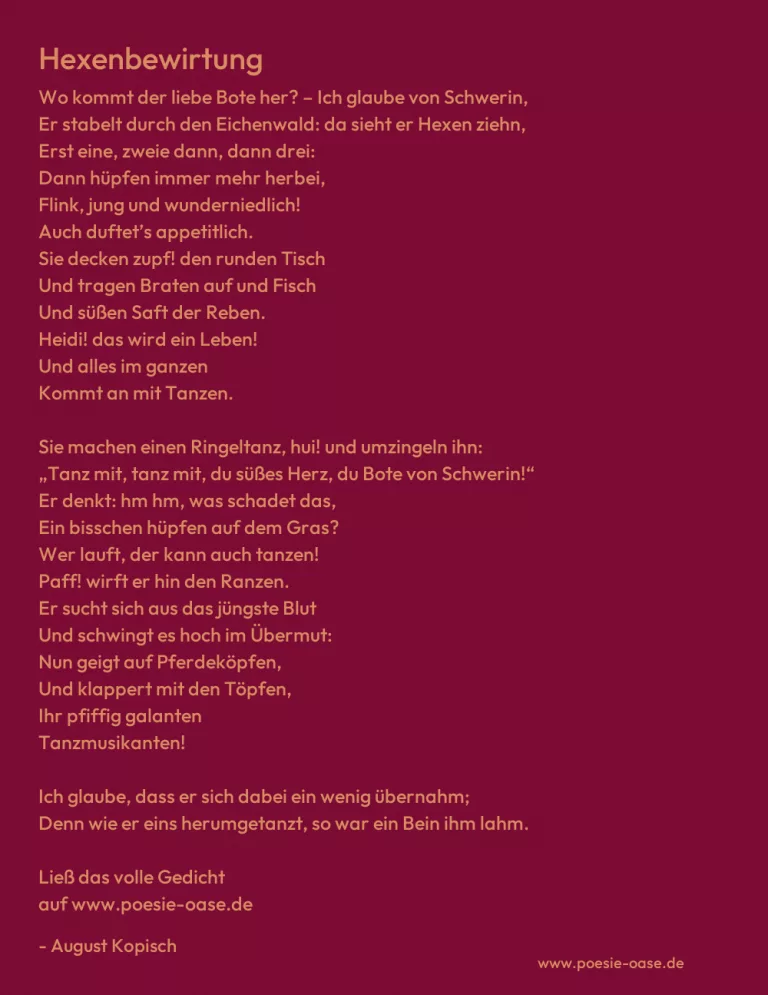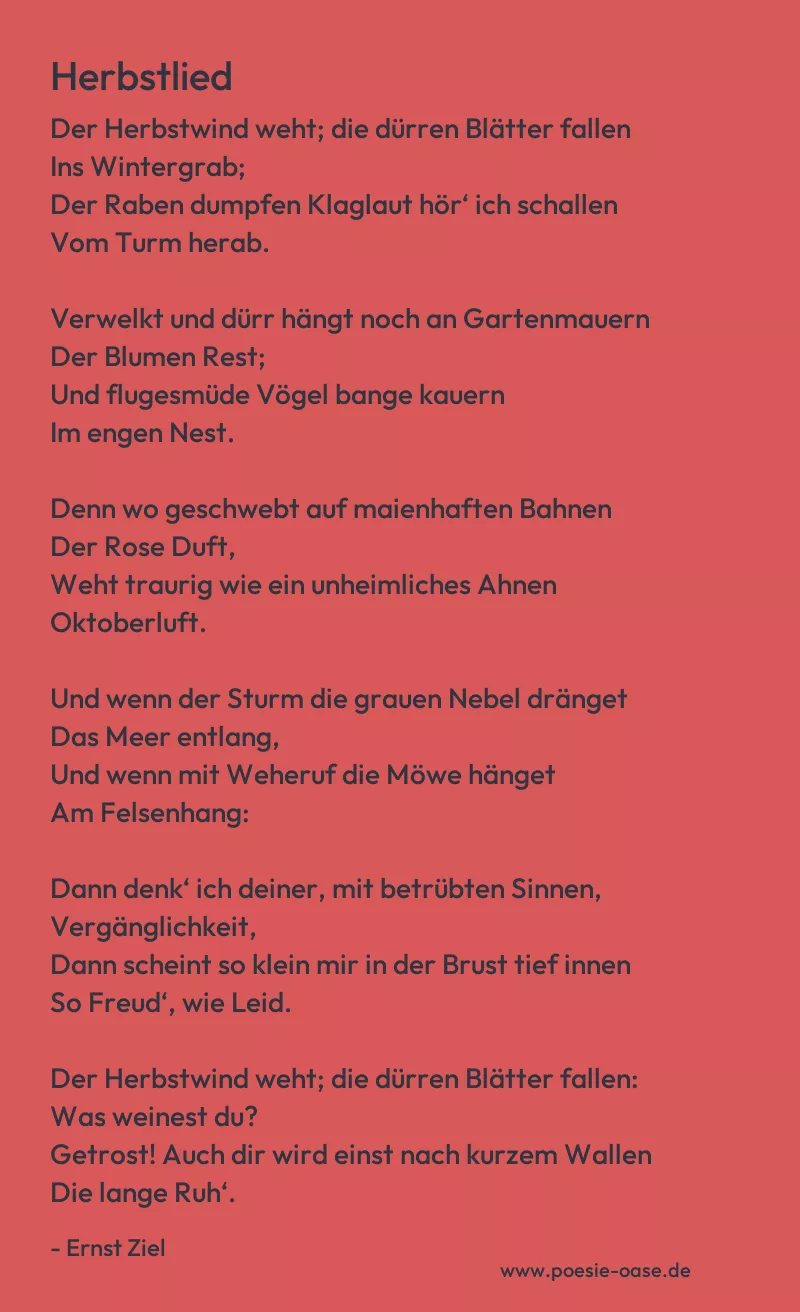Herbstlied
Der Herbstwind weht; die dürren Blätter fallen
Ins Wintergrab;
Der Raben dumpfen Klaglaut hör‘ ich schallen
Vom Turm herab.
Verwelkt und dürr hängt noch an Gartenmauern
Der Blumen Rest;
Und flugesmüde Vögel bange kauern
Im engen Nest.
Denn wo geschwebt auf maienhaften Bahnen
Der Rose Duft,
Weht traurig wie ein unheimliches Ahnen
Oktoberluft.
Und wenn der Sturm die grauen Nebel dränget
Das Meer entlang,
Und wenn mit Weheruf die Möwe hänget
Am Felsenhang:
Dann denk‘ ich deiner, mit betrübten Sinnen,
Vergänglichkeit,
Dann scheint so klein mir in der Brust tief innen
So Freud‘, wie Leid.
Der Herbstwind weht; die dürren Blätter fallen:
Was weinest du?
Getrost! Auch dir wird einst nach kurzem Wallen
Die lange Ruh‘.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
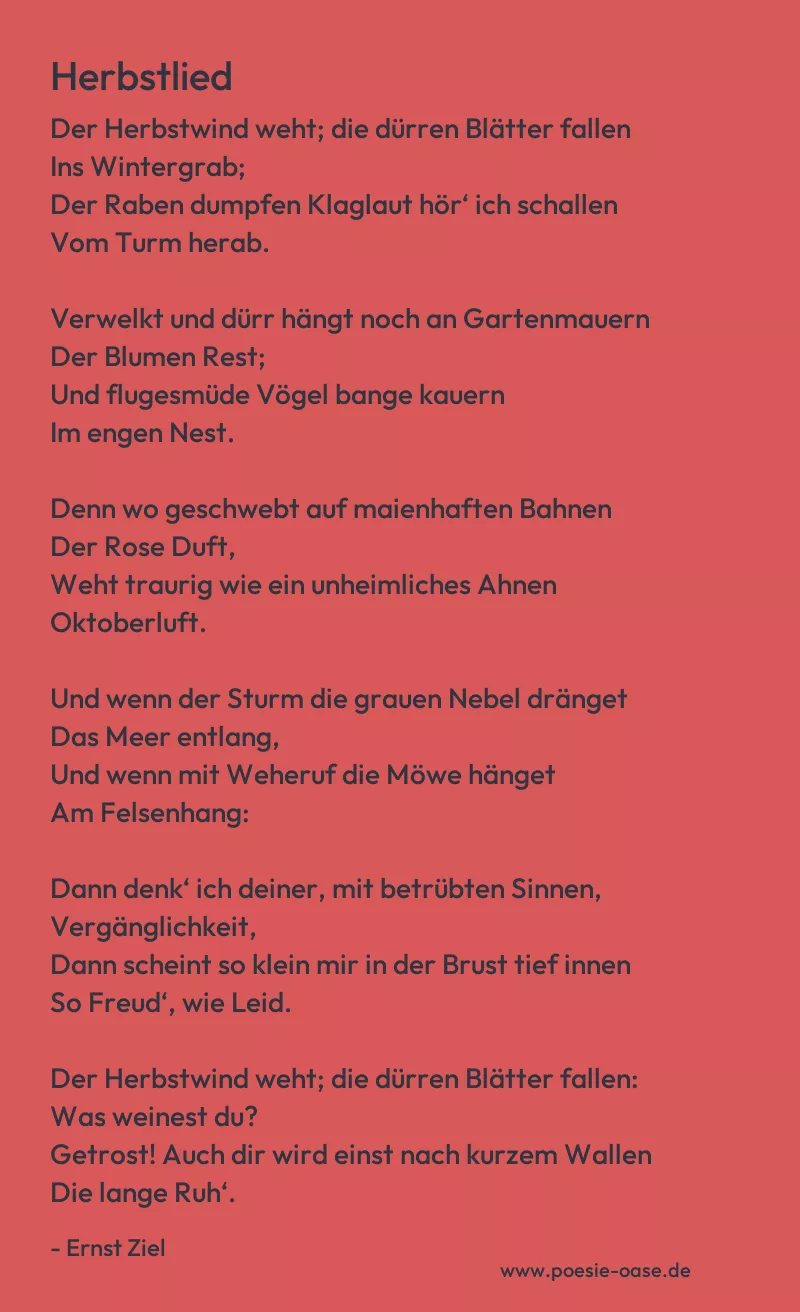
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Herbstlied“ von Ernst Ziel vermittelt die melancholische Stimmung des Herbstes und reflektiert über Vergänglichkeit und den Lauf des Lebens. Die erste Strophe beschreibt den Herbst mit seinen charakteristischen Bildern: der Wind, der die „dürren Blätter“ in das „Wintergrab“ trägt, und der Klang der Raben, die ein düsteres Bild der Jahreszeit zeichnen. Der Herbst, als Symbol für das Vergehen und den bevorstehenden Winter, wird hier als eine Zeit des Rückzugs und der Traurigkeit dargestellt.
In der zweiten Strophe wird die Bildsprache weiter intensiviert. Die „verwelkten“ Blumen an den „Gartenmauern“ und die „flugesmüden Vögel“, die „bange kauern“, verdeutlichen das Ende der Lebenszyklen. Diese Naturbilder vermitteln eine tiefe Traurigkeit und den Niedergang der Lebenskräfte. Die Tiere und Pflanzen sind erschöpft und die fröhliche Lebendigkeit des Frühlings ist längst verweht. Das Bild der Vögel im „engen Nest“ lässt eine Einsamkeit und ein Gefühl der Begrenztheit erahnen.
Der Übergang zur dritten Strophe verstärkt das Gefühl der Trauer, indem der Herbst mit der Vorstellung von „unheimlichem Ahnen“ und der „Oktoberluft“ beschrieben wird, die anstelle des früheren, blühenden Lebensweges nun eine düstere, ungewisse Zukunft in den Raum stellt. Das Bild des Herbstes als Zeit des Wandels und der Trauer wird durch die unheimliche Atmosphäre der „Oktoberluft“ und die Erinnerung an den „Rosenduft“ verstärkt, der nun von der „traurigen“ Herbstluft verdrängt wird.
In der vierten Strophe wechselt der Sprecher zu einer introspektiven Reflexion, die sich mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinandersetzt. Die Naturbilder des Herbstes, der Sturm und die Möwe, die „mit Weheruf“ am Felsen hängt, erzeugen ein Bild der Trauer und des Verlusts. Der Sprecher denkt an die eigene Vergänglichkeit und sieht in der „Freud‘, wie Leid“ eine tiefe Verbindung zum menschlichen Leben. Es wird ein Gefühl der Unvermeidlichkeit und der kleinen, vergänglichen Freuden inmitten des Leids vermittelt.
Das Gedicht endet mit einer tröstlichen, aber gleichzeitig melancholischen Bemerkung. Der Sprecher fragt, warum man weinen sollte, wenn die Natur selbst den Zyklus von Leben und Tod durchläuft. Die „lange Ruh‘“ nach dem „kurzen Wallen“ des Lebens ist unvermeidlich und gehört zur natürlichen Ordnung. Die Vorstellung, dass nach der Anstrengung des Lebens die „lange Ruh‘“ kommt, bringt sowohl Trost als auch das Bewusstsein der Vergänglichkeit des Lebens. Ziel zeigt hier die Unausweichlichkeit des Wandels und des Lebensendes und fordert den Leser auf, diesen Prozess mit einer gewissen Gelassenheit zu akzeptieren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.