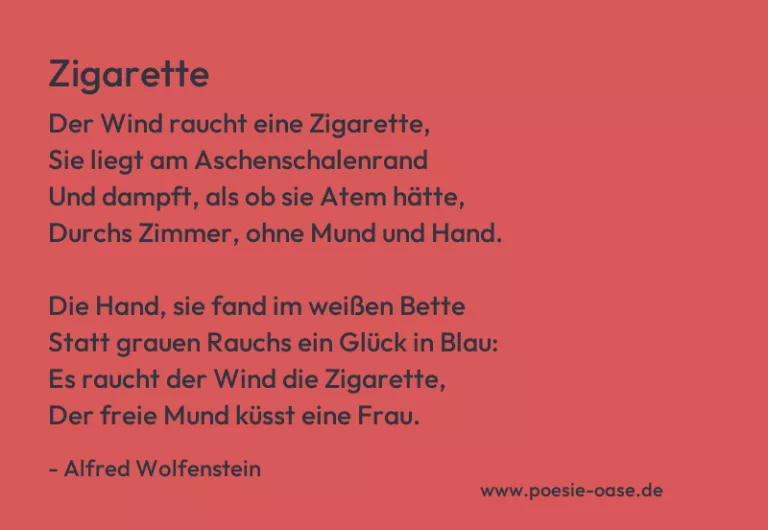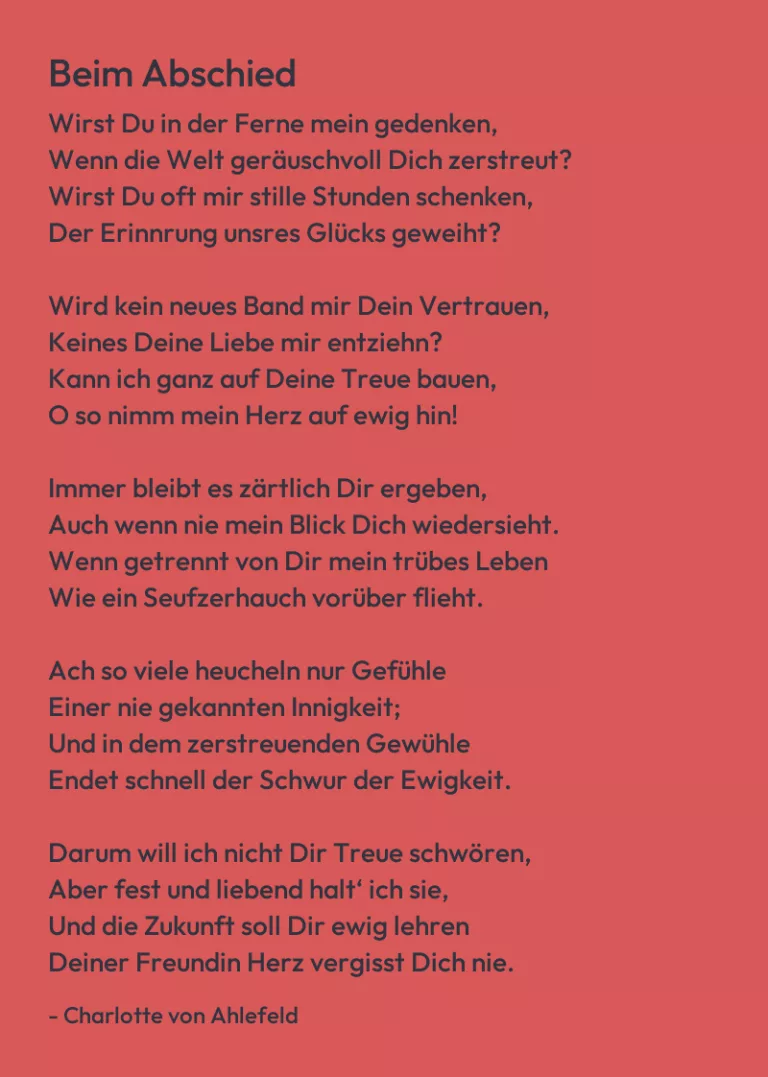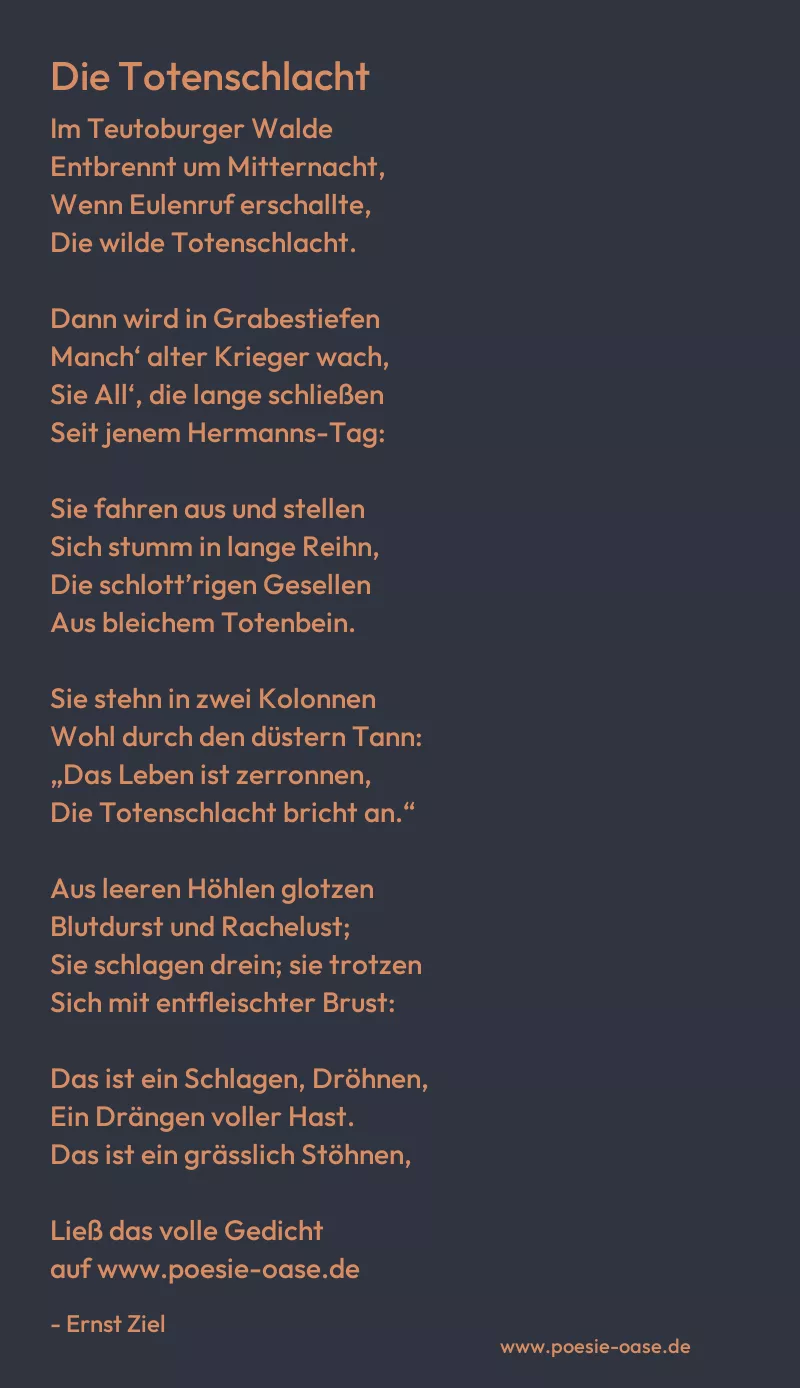Die Totenschlacht
Im Teutoburger Walde
Entbrennt um Mitternacht,
Wenn Eulenruf erschallte,
Die wilde Totenschlacht.
Dann wird in Grabestiefen
Manch‘ alter Krieger wach,
Sie All‘, die lange schließen
Seit jenem Hermanns-Tag:
Sie fahren aus und stellen
Sich stumm in lange Reihn,
Die schlott’rigen Gesellen
Aus bleichem Totenbein.
Sie stehn in zwei Kolonnen
Wohl durch den düstern Tann:
„Das Leben ist zerronnen,
Die Totenschlacht bricht an.“
Aus leeren Höhlen glotzen
Blutdurst und Rachelust;
Sie schlagen drein; sie trotzen
Sich mit entfleischter Brust:
Das ist ein Schlagen, Dröhnen,
Ein Drängen voller Hast.
Das ist ein grässlich Stöhnen,
Ein Kämpfen sonder Rast.
Die hagern Knochen-Wichte,
Sie schlagen brav und gut:
Manch‘ Schädel geht zu Nichte, –
Doch fließt kein Tropfen Blut.
Und wenn der Hahn nun krähet,
Dann ist die Schlacht vorbei;
Wann morgen Nachtwind wehet,
Entbrennet sie aufs Neu‘.
– So schlagen zwei Nationen
Die grimme Totenschlacht,
Die römischen Legionen
Und der Cherusker Macht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
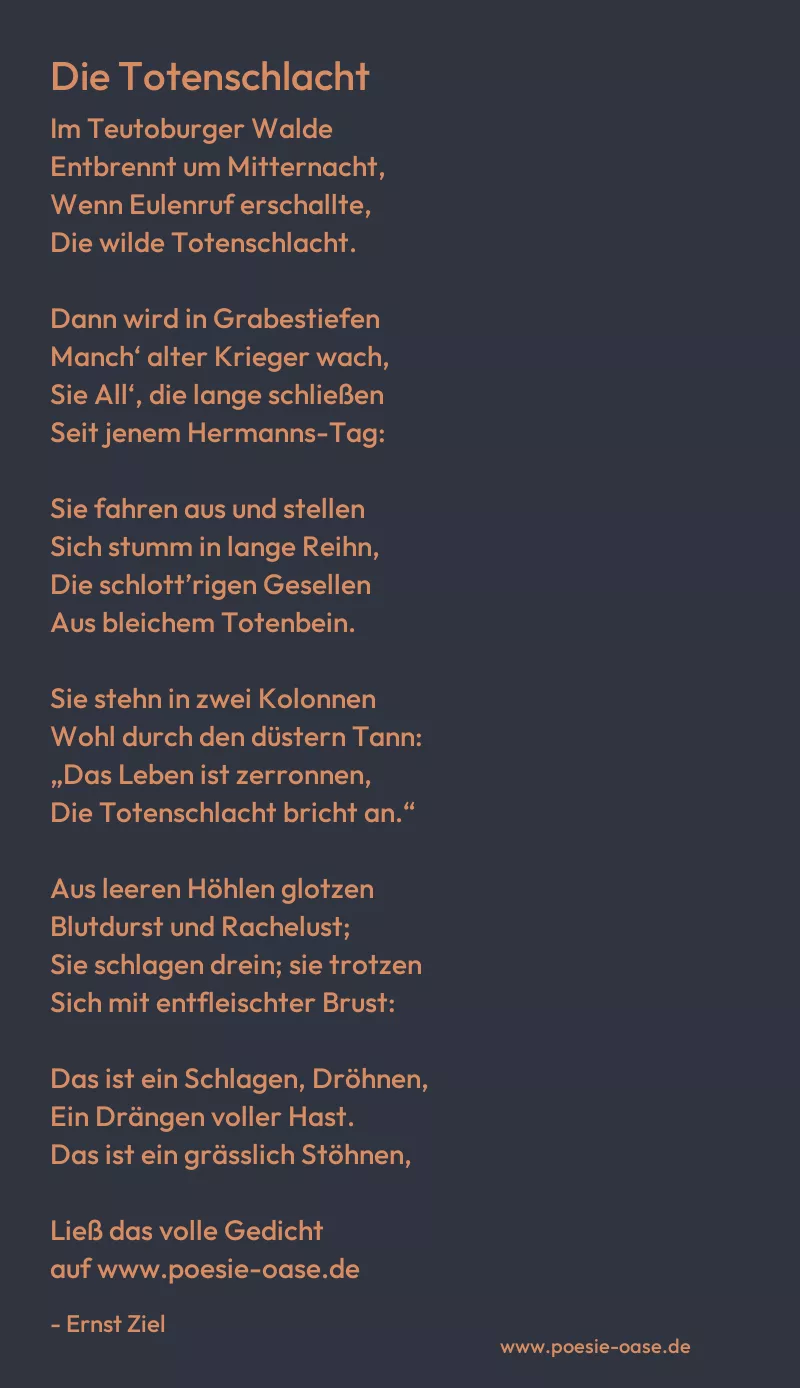
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Totenschlacht“ von Ernst Ziel entfaltet ein düster-romantisches Szenario, das die Schlacht im Teutoburger Wald als ein ewig wiederkehrendes Geisterdrama inszeniert. In der Mitternacht, wenn die Grenze zwischen Leben und Tod besonders durchlässig erscheint, erstehen die gefallenen Krieger vergangener Zeiten erneut zum Kampf – eine Vision, die das Motiv des historischen Traumas mit der Idee einer unerlösten Vergangenheit verbindet.
Ziel nutzt dabei eine dramatische, bildhafte Sprache, die stark auf Kontraste zwischen Leben und Tod, Fleisch und Knochen, Bewegung und Starre setzt. Die Krieger sind „schlott’rige Gesellen“, „aus bleichem Totenbein“ zusammengesetzt, deren „leere Höhlen“ Rachegelüste offenbaren. Diese grotesken Bildwelten erinnern an mittelalterliche Totentänze oder romantische Gespensterdichtungen und erzeugen eine Atmosphäre der Unheimlichkeit. Die Ironie: Obwohl „manch’ Schädel“ zerschlagen wird, „fließt kein Tropfen Blut“ – der Kampf ist sinnentleert, mechanisch, rituell.
Die ewige Wiederholung des Kampfes – Nacht für Nacht mit dem Hahnenschrei als Ende – betont den vergeblichen Charakter dieser „Totenschlacht“. Die Römer und Cherusker, zwei untergegangene Nationen, stehen sich unversöhnlich gegenüber, obwohl ihr Leben längst vergangen ist. Damit evoziert das Gedicht eine tiefere Frage nach der Sinnlosigkeit von Gewalt und dem Fortwirken von Kriegsnarrativen über den Tod hinaus.
Thematisch kreist das Gedicht um nationale Identität und die Erinnerung an einen mythisch überhöhten historischen Sieg (der Cherusker unter Arminius/Hermann). Doch statt Glorifizierung setzt Ziel auf makabre Inszenierung: Der Sieg ist nicht triumphal, sondern wird zu einem nie endenden Fluch. Das verweist möglicherweise auf die Ambivalenz von Nationalstolz und den dunklen Schatten, den geschichtliche Gewalt wirft.
„Die Totenschlacht“ ist somit mehr als ein historisches Gedicht – es ist ein poetischer Kommentar auf das Fortleben kriegerischer Geisteshaltungen und eine Allegorie auf den ewigen Kreislauf von Hass und Rache. Möchtest du, dass ich das Gedicht auch historisch einordne oder mit ähnlichen Werken vergleiche?
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.