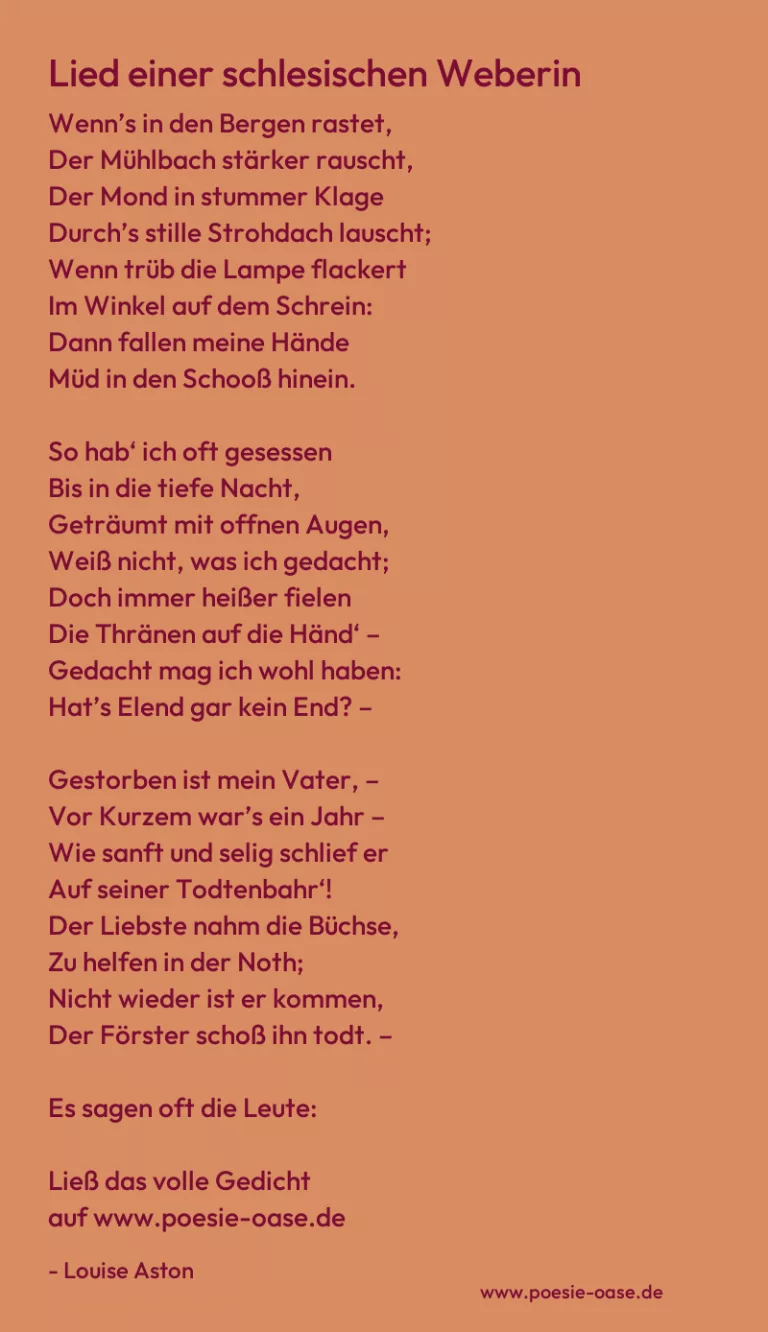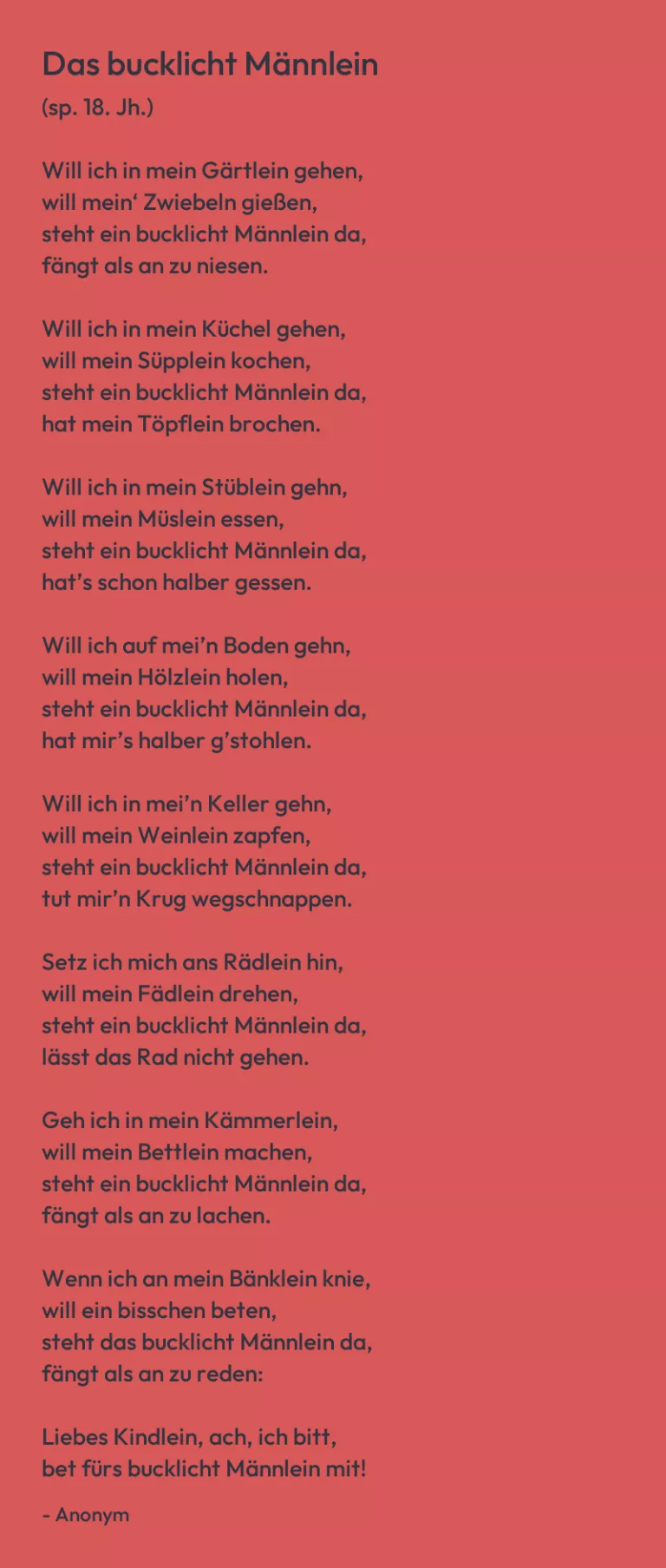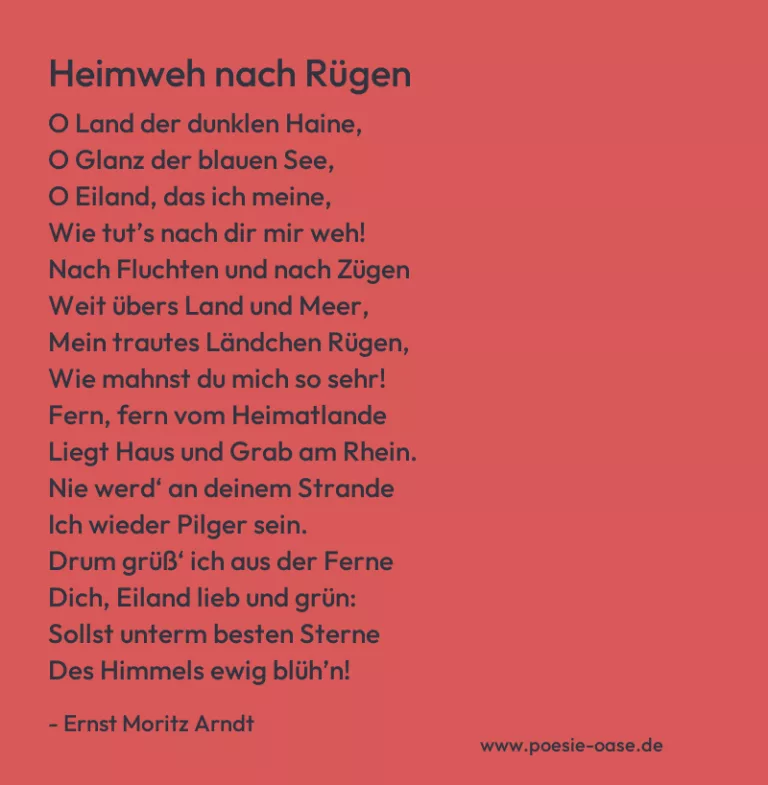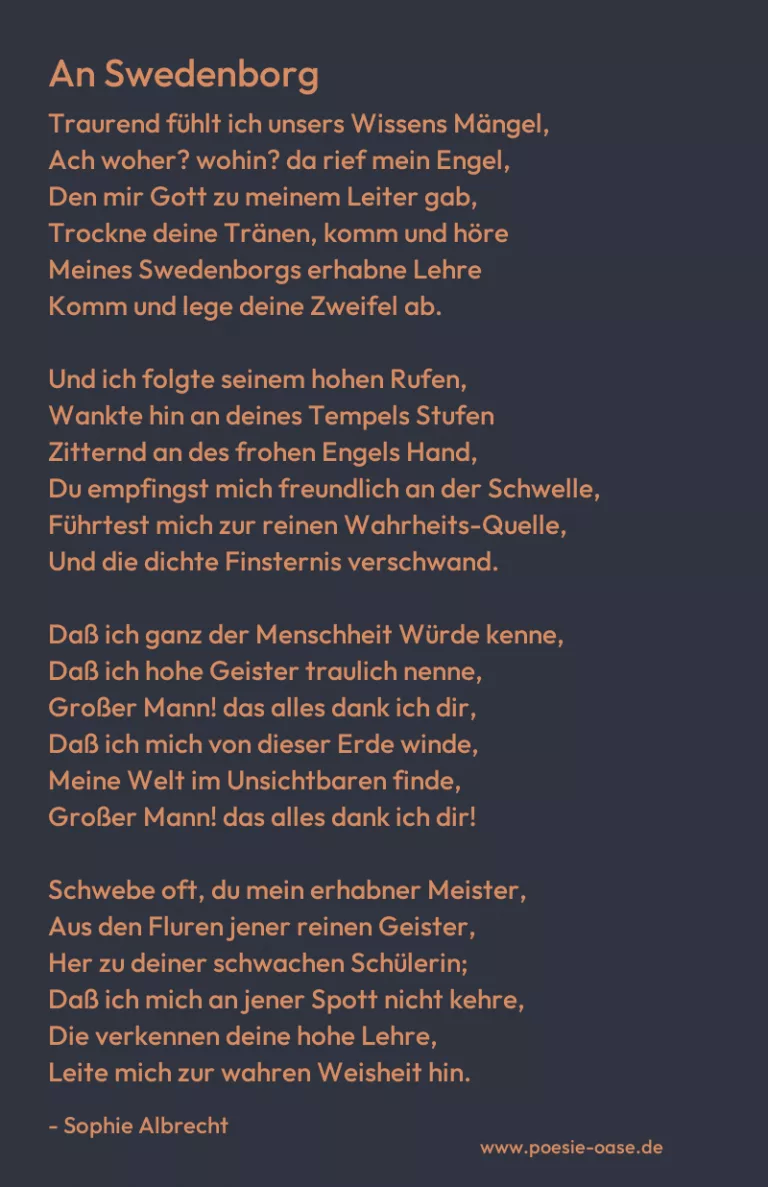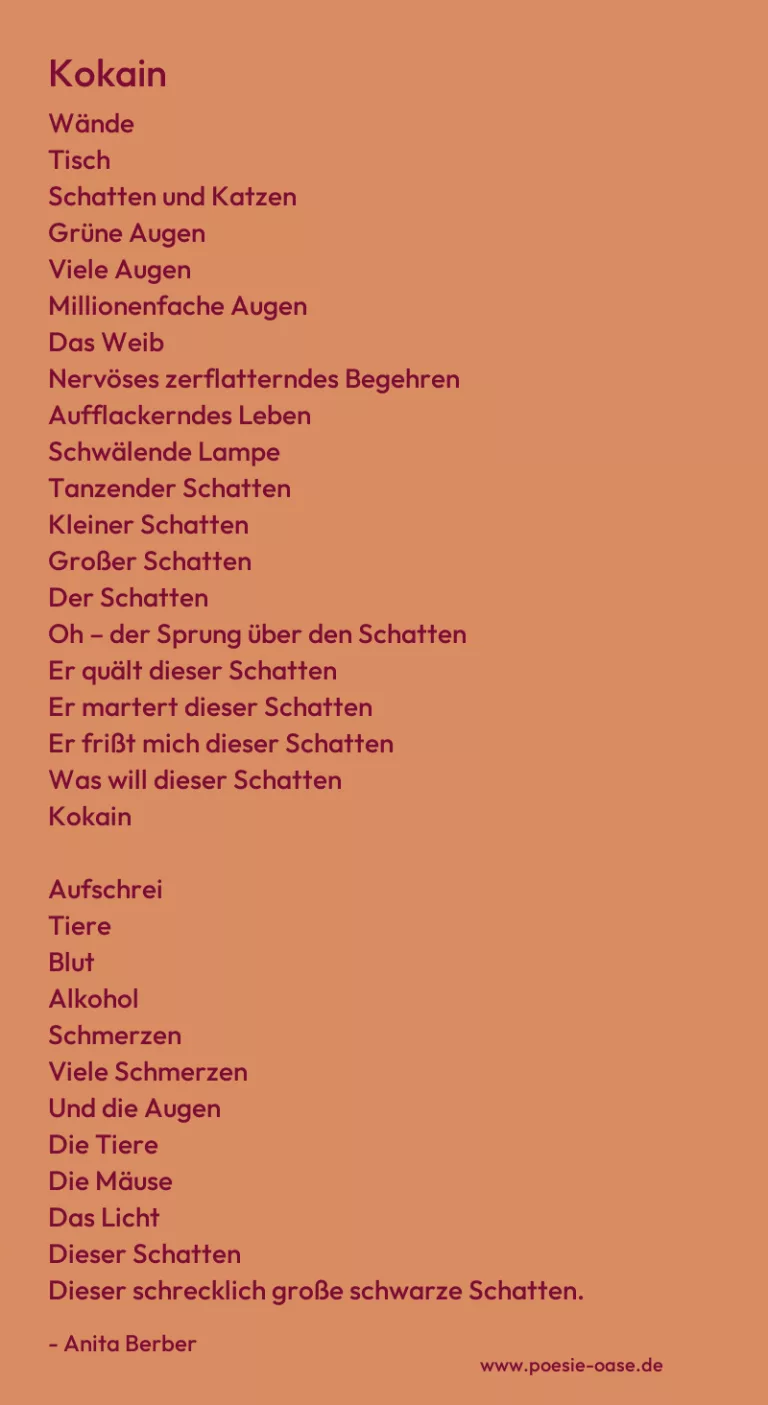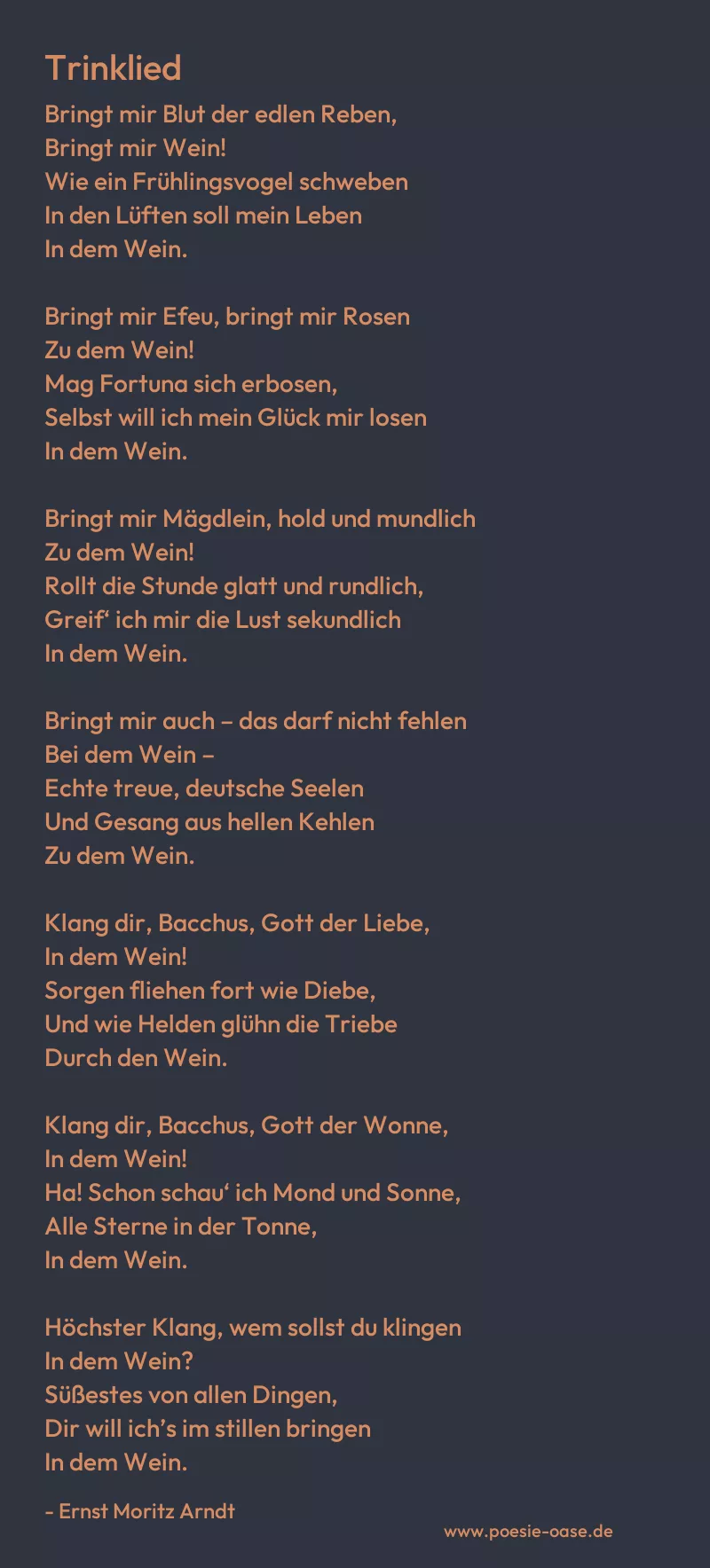Alltag, Emotionen & Gefühle, Freude, Gemeinfrei, Harmonie, Heldenmut, Himmel & Wolken, Jahreszeiten, Kriegsgeschichte, Leichtigkeit, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Religion, Sommer, Weihnachten
Trinklied
Bringt mir Blut der edlen Reben,
Bringt mir Wein!
Wie ein Frühlingsvogel schweben
In den Lüften soll mein Leben
In dem Wein.
Bringt mir Efeu, bringt mir Rosen
Zu dem Wein!
Mag Fortuna sich erbosen,
Selbst will ich mein Glück mir losen
In dem Wein.
Bringt mir Mägdlein, hold und mundlich
Zu dem Wein!
Rollt die Stunde glatt und rundlich,
Greif‘ ich mir die Lust sekundlich
In dem Wein.
Bringt mir auch – das darf nicht fehlen
Bei dem Wein –
Echte treue, deutsche Seelen
Und Gesang aus hellen Kehlen
Zu dem Wein.
Klang dir, Bacchus, Gott der Liebe,
In dem Wein!
Sorgen fliehen fort wie Diebe,
Und wie Helden glühn die Triebe
Durch den Wein.
Klang dir, Bacchus, Gott der Wonne,
In dem Wein!
Ha! Schon schau‘ ich Mond und Sonne,
Alle Sterne in der Tonne,
In dem Wein.
Höchster Klang, wem sollst du klingen
In dem Wein?
Süßestes von allen Dingen,
Dir will ich’s im stillen bringen
In dem Wein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
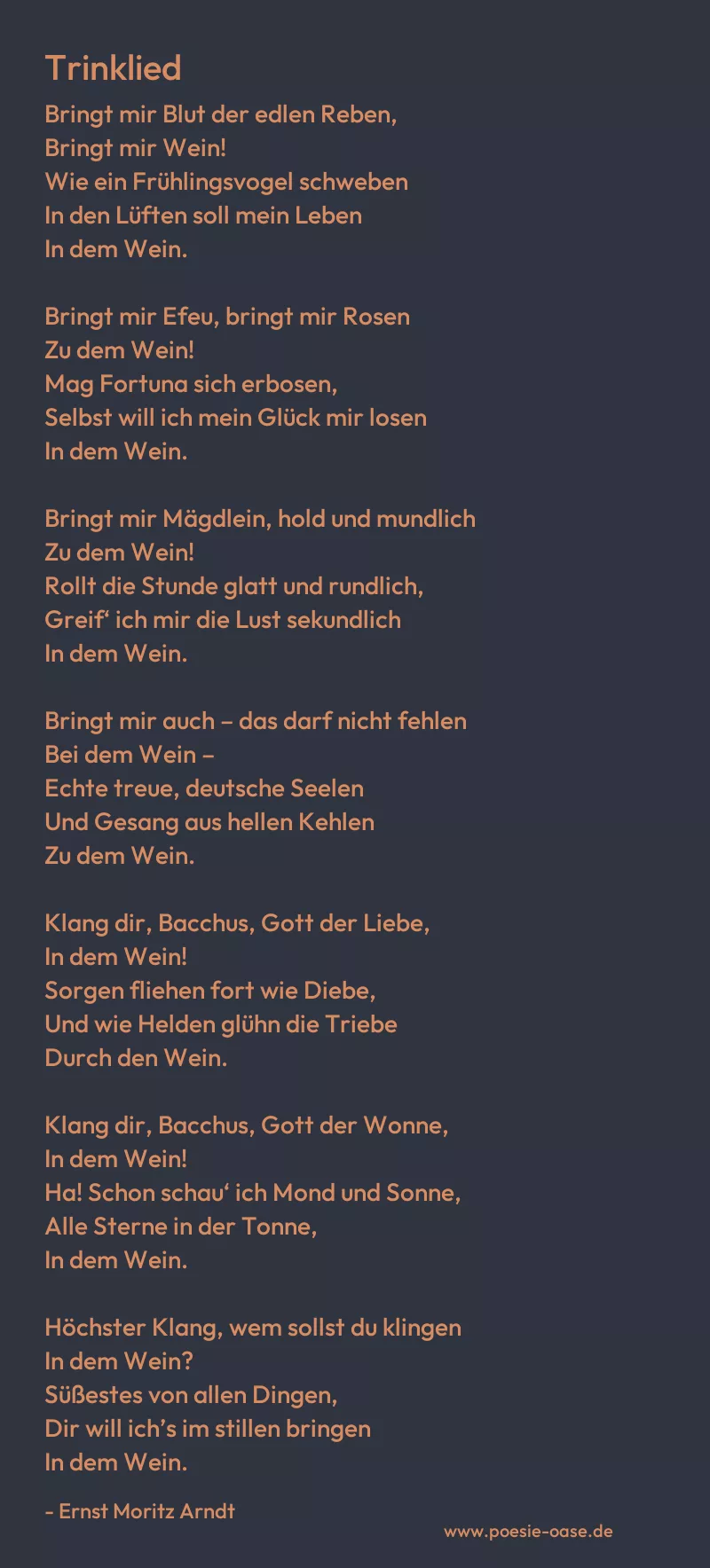
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Trinklied“ von Ernst Moritz Arndt feiert auf schwungvolle, lebensfrohe Weise den Wein als Quelle der Freude, der Freiheit und der Lebenslust. In regelmäßig wiederkehrender Struktur mit dem Refrain „in dem Wein“ entfaltet Arndt ein heiteres und zugleich tief verwurzeltes Lob auf die Verbindung von Natur, Sinnesfreude, Freundschaft und Geselligkeit.
Bereits in der ersten Strophe wird der Wein mit einem belebenden, fast transzendierenden Effekt verbunden: Das Leben soll „wie ein Frühlingsvogel“ in den Lüften schweben – leicht, beschwingt, befreit vom Irdischen. Der Wein steht hier sinnbildlich für eine gesteigerte, losgelöste Daseinsform, die durch ihre Verbindung zur Natur (Frühling, Rebe) besonders rein und edel wirkt.
In den folgenden Strophen erweitert Arndt das Fest des Weins um weitere Lebensfreuden: Rosen und Efeu als Symbole der Schönheit, Fortuna als unzuverlässige Glücksgöttin, deren Launen durch selbstbestimmten Genuss überwunden werden. Auch die Liebe und Erotik finden ihren Platz – in der dritten Strophe wird das Zusammenspiel von Wein, Zeit und sinnlichem Vergnügen humorvoll und offen besungen. Die Kombination aus „Mägdlein“ und „sekundlicher Lust“ vermittelt ein unbeschwertes, fast übermütiges Lebensgefühl.
Doch Arndt beschränkt sich nicht auf rein körperliche Freuden: In der vierten Strophe treten „echte treue, deutsche Seelen“ und gemeinsamer Gesang hinzu. Der Wein wird hier zum Mittel geselliger Verbundenheit, zur Quelle von Gemeinschaft und Heimatgefühl. Damit schlägt das Gedicht eine Brücke zwischen individueller Lebensfreude und kollektiver Identität – typisch für Arndts Dichtung.
Die letzten Strophen steigern die poetische Wirkung des Weins ins beinahe Mythische. Bacchus, der Gott des Weines, wird angerufen, Sorgen verschwinden, Leid wird in Lust verwandelt. Schließlich gipfelt das Gedicht in einer Mischung aus Überhöhung und augenzwinkernder Übertreibung: Der Sprecher sieht „Mond und Sonne, alle Sterne in der Tonne“ – ein Bild für die völlige Auflösung der Grenzen zwischen Innerem und Äußerem, Wirklichkeit und Rausch. Der „höchste Klang“ am Ende bleibt offen, wird aber in einer geheimnisvollen Zuwendung „im stillen“ weitergegeben – vielleicht als Liebeserklärung, vielleicht als tiefste Lebensfreude.
Insgesamt ist „Trinklied“ ein lebensbejahendes, spielerisch leichtes Gedicht, das Genuss und Gemeinschaft preist, ohne ins Banale zu verfallen. Arndt gelingt eine kunstvolle Verbindung von Feierlaune, Naturbild, Erotik und Nationalgefühl – alles „in dem Wein“.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.