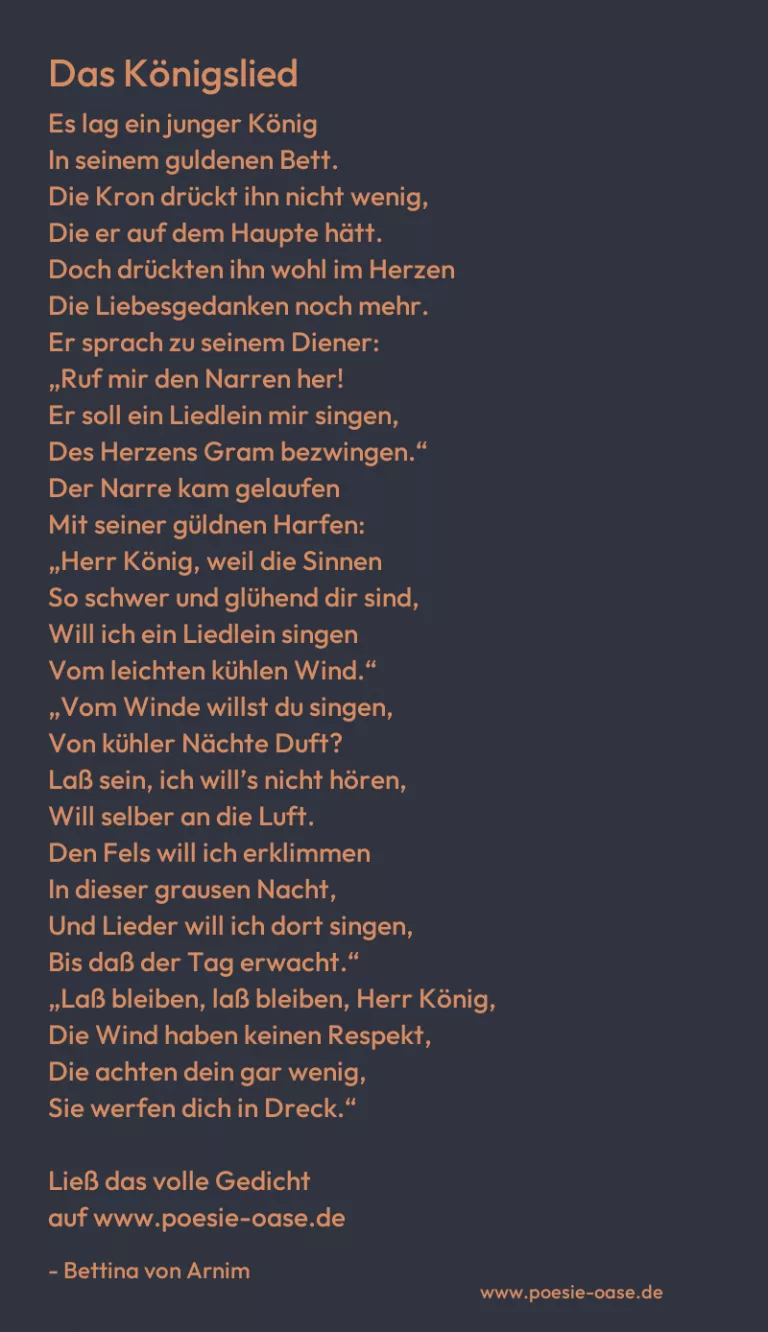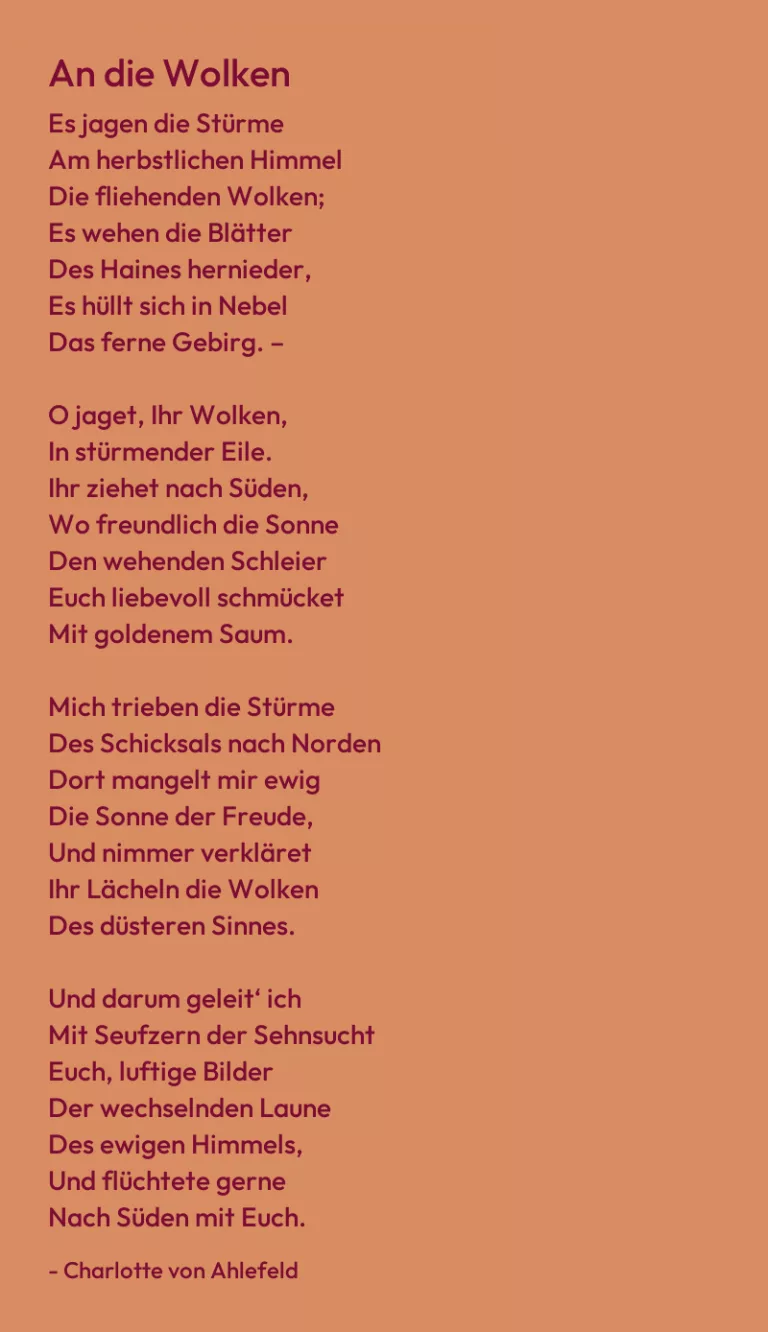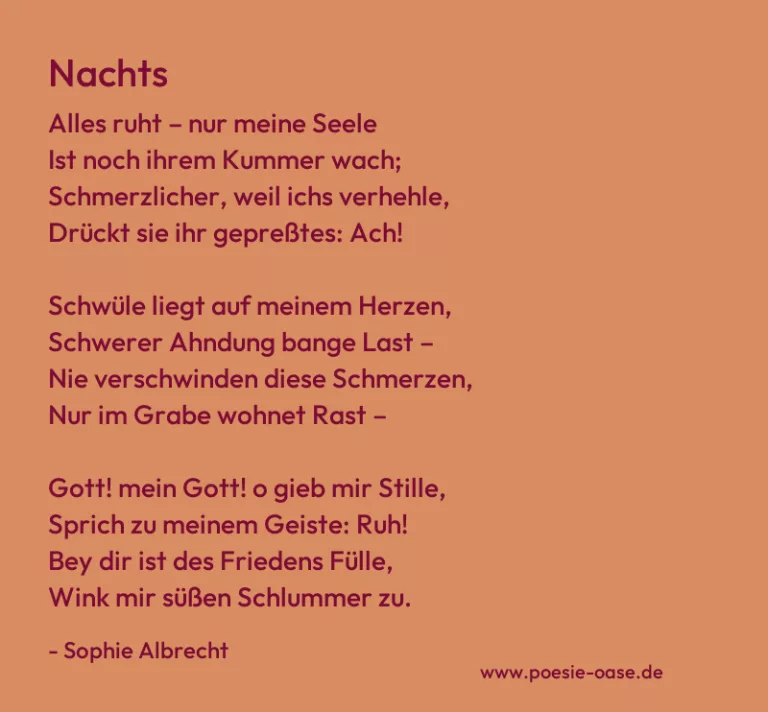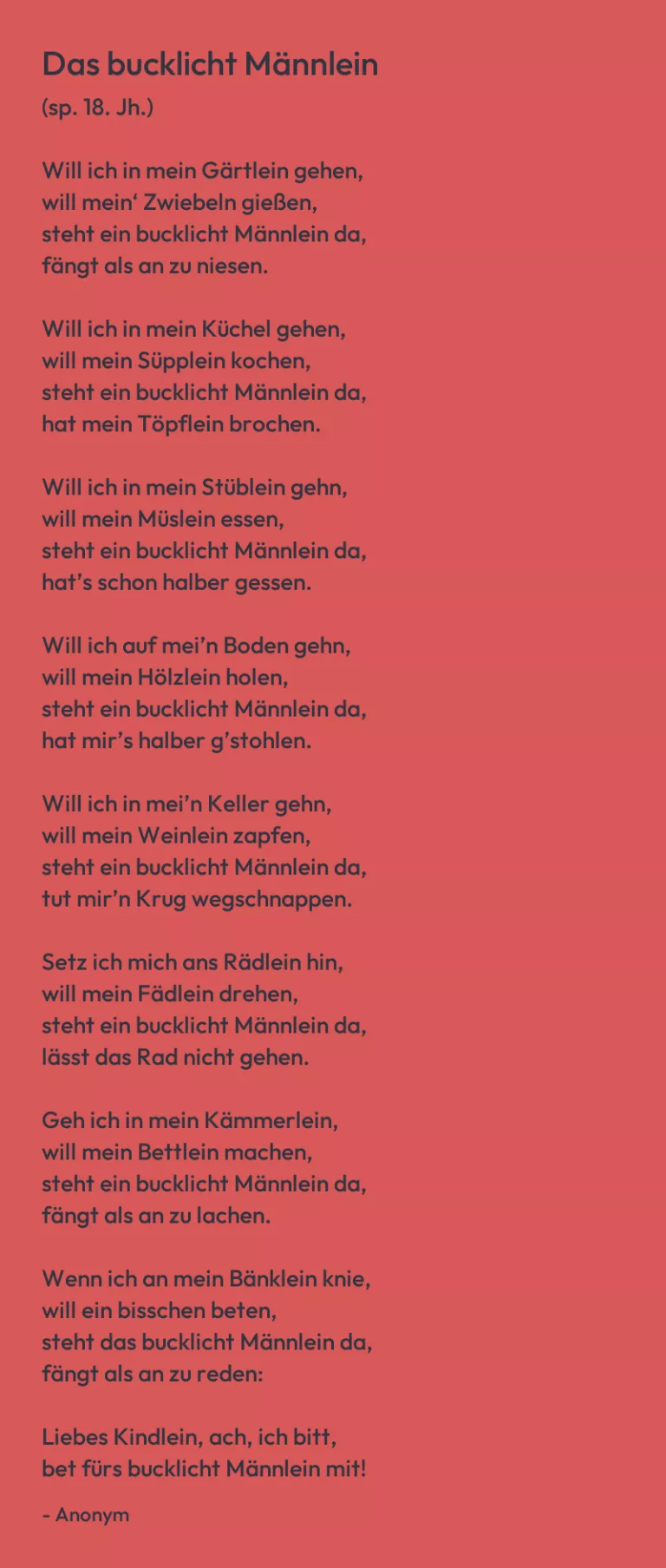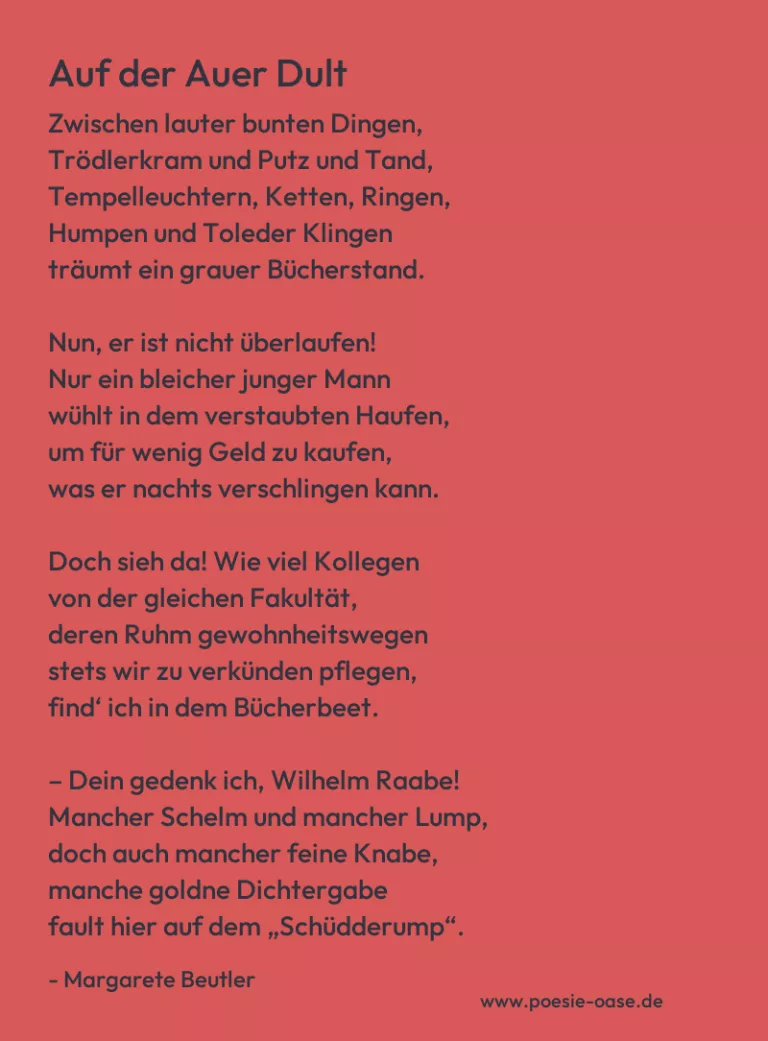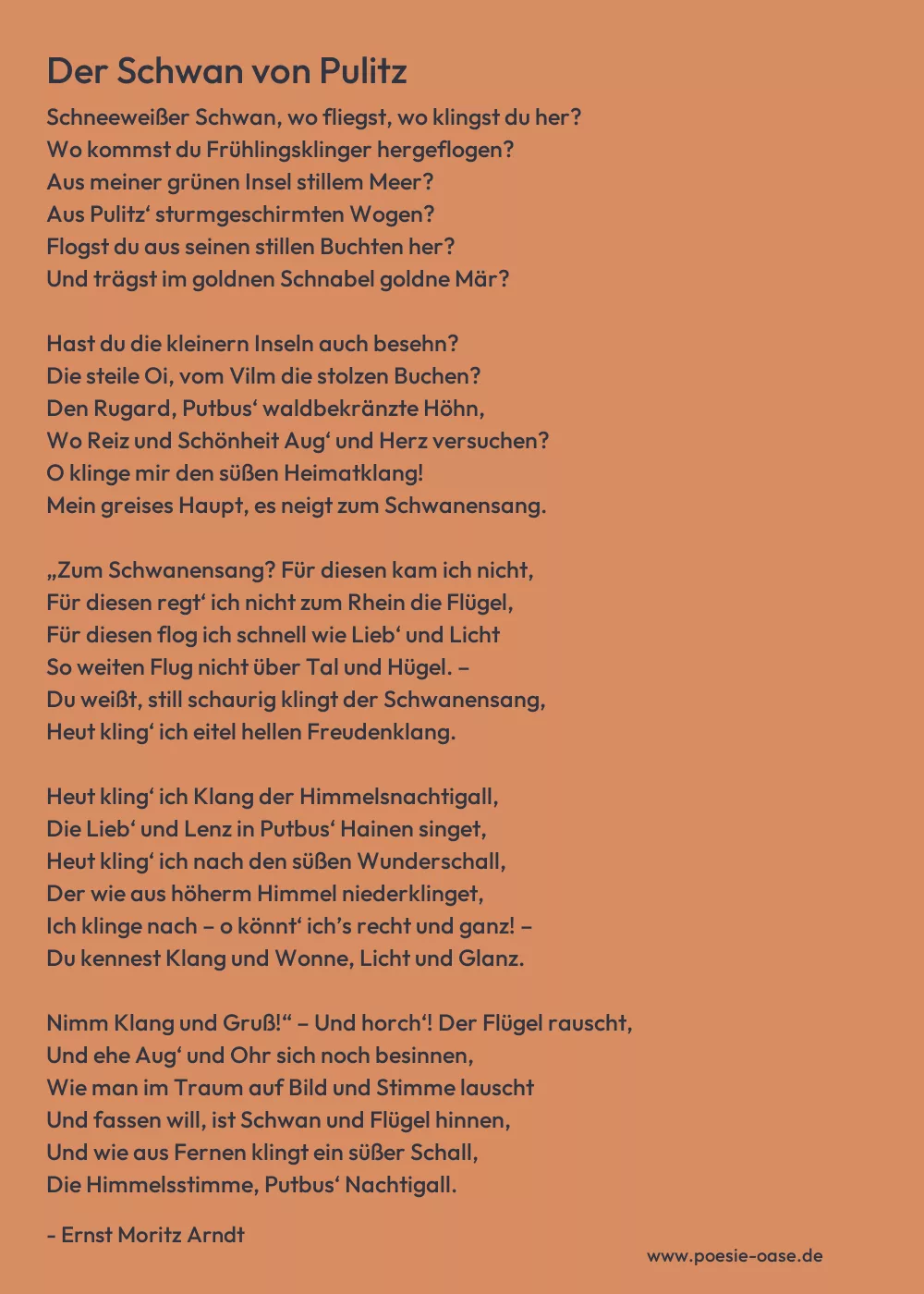Der Schwan von Pulitz
Schneeweißer Schwan, wo fliegst, wo klingst du her?
Wo kommst du Frühlingsklinger hergeflogen?
Aus meiner grünen Insel stillem Meer?
Aus Pulitz‘ sturmgeschirmten Wogen?
Flogst du aus seinen stillen Buchten her?
Und trägst im goldnen Schnabel goldne Mär?
Hast du die kleinern Inseln auch besehn?
Die steile Oi, vom Vilm die stolzen Buchen?
Den Rugard, Putbus‘ waldbekränzte Höhn,
Wo Reiz und Schönheit Aug‘ und Herz versuchen?
O klinge mir den süßen Heimatklang!
Mein greises Haupt, es neigt zum Schwanensang.
„Zum Schwanensang? Für diesen kam ich nicht,
Für diesen regt‘ ich nicht zum Rhein die Flügel,
Für diesen flog ich schnell wie Lieb‘ und Licht
So weiten Flug nicht über Tal und Hügel. –
Du weißt, still schaurig klingt der Schwanensang,
Heut kling‘ ich eitel hellen Freudenklang.
Heut kling‘ ich Klang der Himmelsnachtigall,
Die Lieb‘ und Lenz in Putbus‘ Hainen singet,
Heut kling‘ ich nach den süßen Wunderschall,
Der wie aus höherm Himmel niederklinget,
Ich klinge nach – o könnt‘ ich’s recht und ganz! –
Du kennest Klang und Wonne, Licht und Glanz.
Nimm Klang und Gruß!“ – Und horch‘! Der Flügel rauscht,
Und ehe Aug‘ und Ohr sich noch besinnen,
Wie man im Traum auf Bild und Stimme lauscht
Und fassen will, ist Schwan und Flügel hinnen,
Und wie aus Fernen klingt ein süßer Schall,
Die Himmelsstimme, Putbus‘ Nachtigall.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
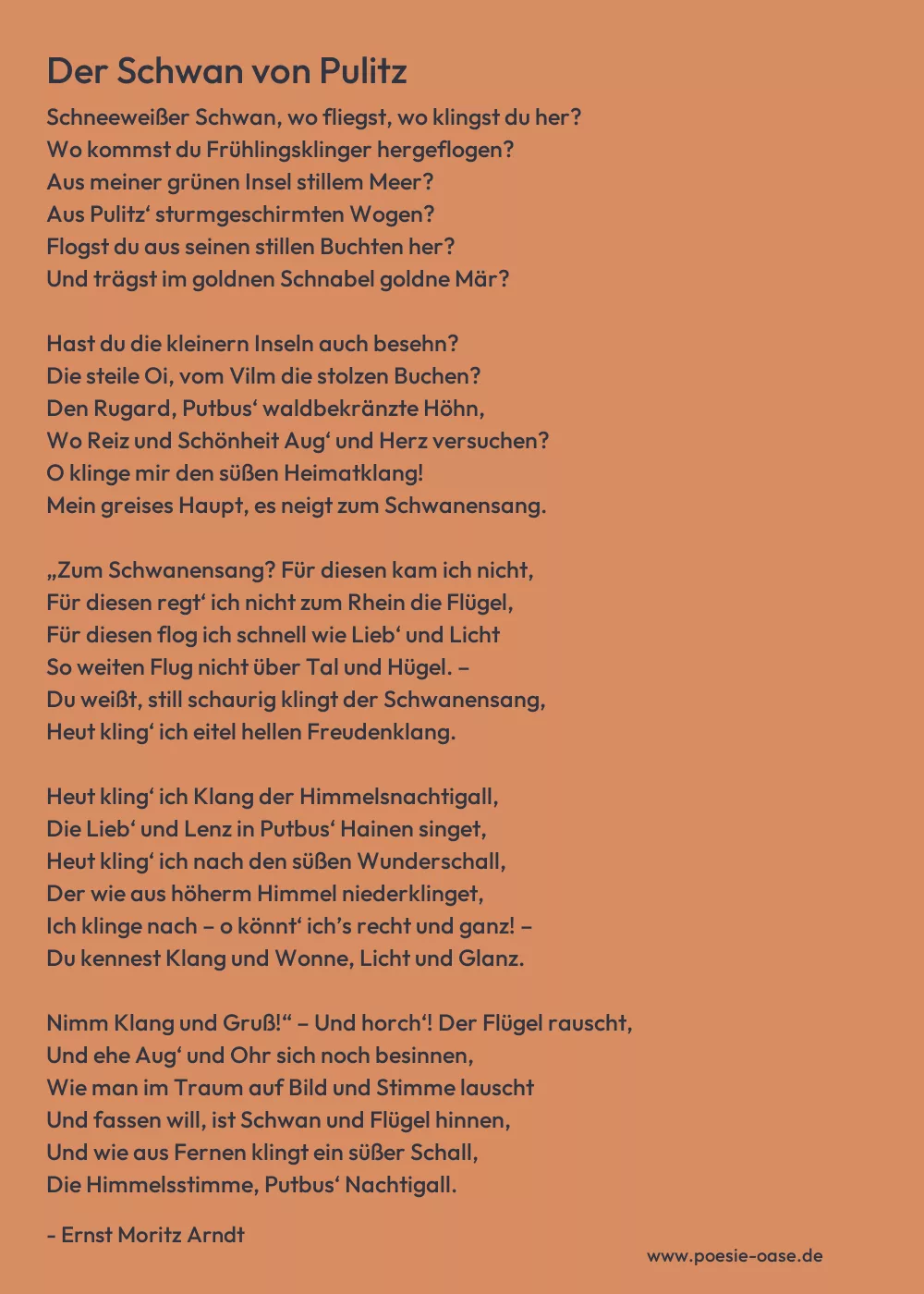
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Schwan von Pulitz“ von Ernst Moritz Arndt verbindet Naturbild, Heimatliebe und eine tiefe Sehnsucht nach Schönheit und Erinnerung. Im Zentrum steht ein schneeweißer Schwan, der als poetisches Symbol fungiert und Fragen nach Herkunft, Botschaft und Bedeutung mit sich trägt. Der Schwan wird dabei nicht nur als reales Tier, sondern auch als Bote zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Diesseits und einer idealisierten Heimat gedeutet.
Das lyrische Ich begegnet dem Schwan mit einer Mischung aus Staunen und Wehmut. Es vermutet, dass dieser aus Pulitz, einer Insel der Ostsee, stammt und damit Erinnerungen an die eigene Herkunft mitbringt. Die Landschaftsbeschreibungen – wie die „steile Oi“, die „stolzen Buchen vom Vilm“, der „Rugard“ oder „Putbus‘ waldbekränzte Höhn“ – schaffen ein romantisches Bild von Rügen, Arndts Heimatregion. Diese Orte stehen für persönliche Erinnerung und emotionale Verbundenheit, während der Schwan als Träger dieser Erinnerungen auftritt.
Zunächst erwartet das lyrische Ich einen Schwanengesang im klassischen Sinn – einen letzten, melancholischen Gesang am Lebensabend. Doch der Schwan widerspricht: Er sei nicht gekommen, um den Abschied zu künden, sondern um „hellen Freudenklang“ zu bringen. Diese Wendung bricht mit der Erwartung des Alters und der Vergänglichkeit, die das lyrische Ich kurzzeitig andeutet. Stattdessen bringt der Schwan eine Botschaft von Licht, Liebe, Frühling und himmlischer Musik – einer „Himmelsnachtigall“, die in Putbus singt.
Im letzten Abschnitt verschwindet der Schwan plötzlich wieder, beinahe wie in einem Traum. Diese flüchtige Begegnung unterstreicht die Idee des Schwanes als Symbol für das Flüchtige, das Erhabene, das nicht festzuhalten ist. Doch zurück bleibt ein „süßer Schall“, ein Nachklang, der wie eine Verheißung klingt – eine Verbindung zwischen Mensch, Natur, Heimat und einer höheren, beinahe göttlichen Schönheit.
Das Gedicht lebt von einem romantischen Naturgefühl, einer fast mystischen Heimatverbundenheit und dem Wunsch, das Schöne und Bedeutungsvolle in der Welt nicht zu verlieren. In der Figur des Schwans verwebt Arndt Erinnerungen, Naturbilder und emotionale Tiefe zu einem feinsinnigen lyrischen Ausdruck innerer Sehnsucht und leiser Hoffnung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.