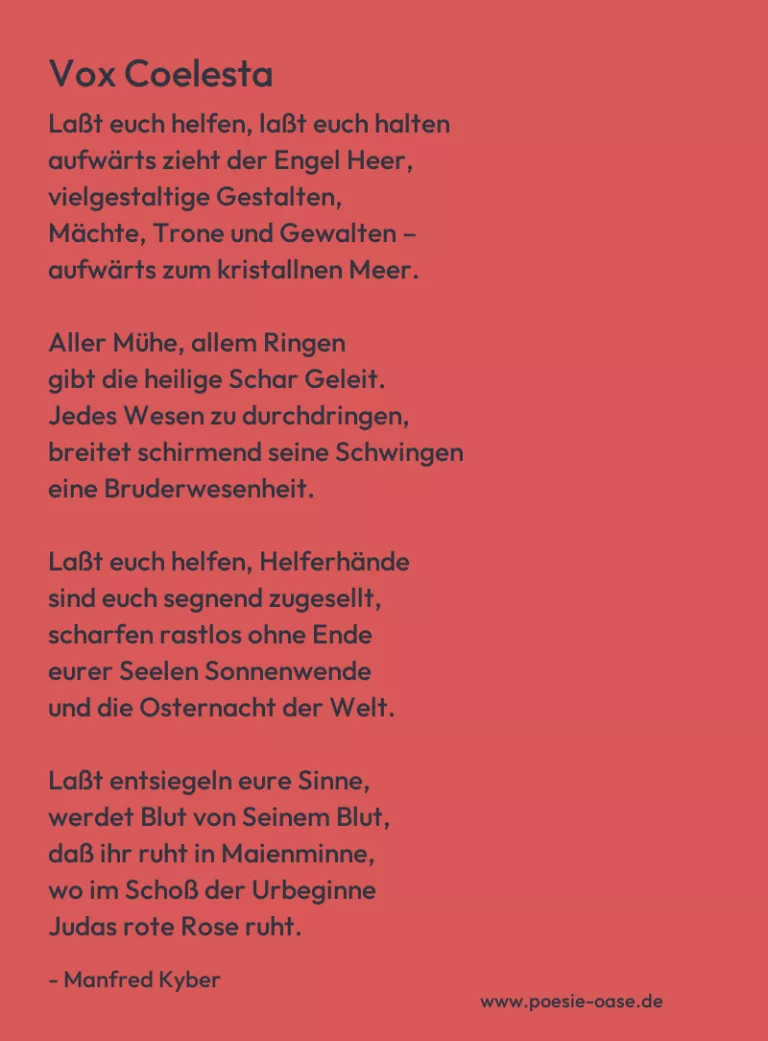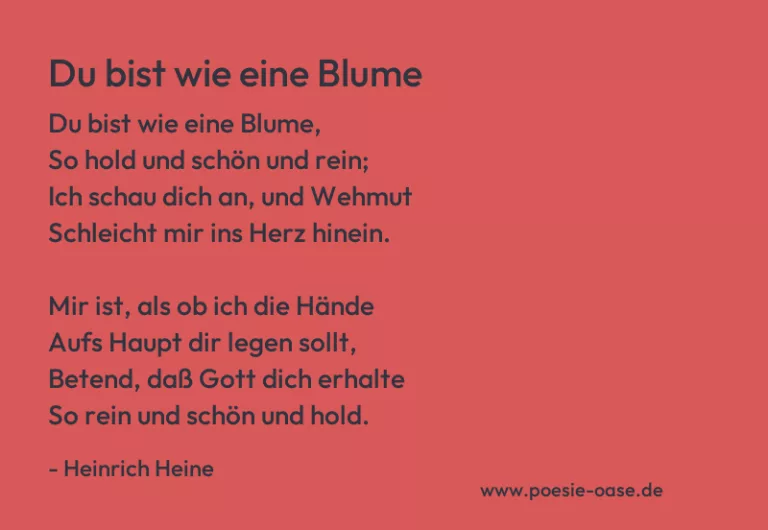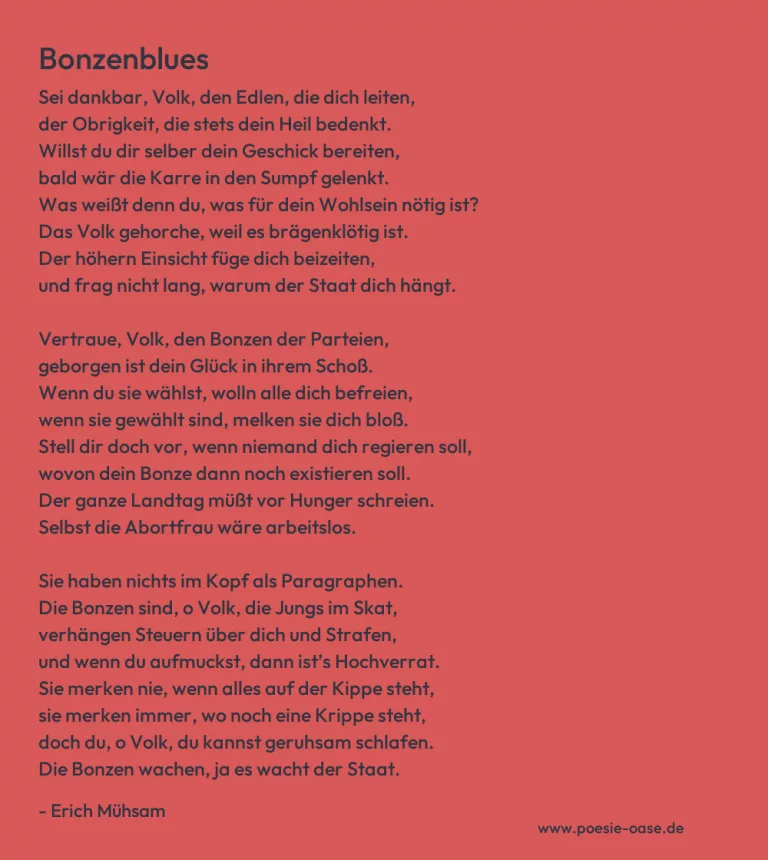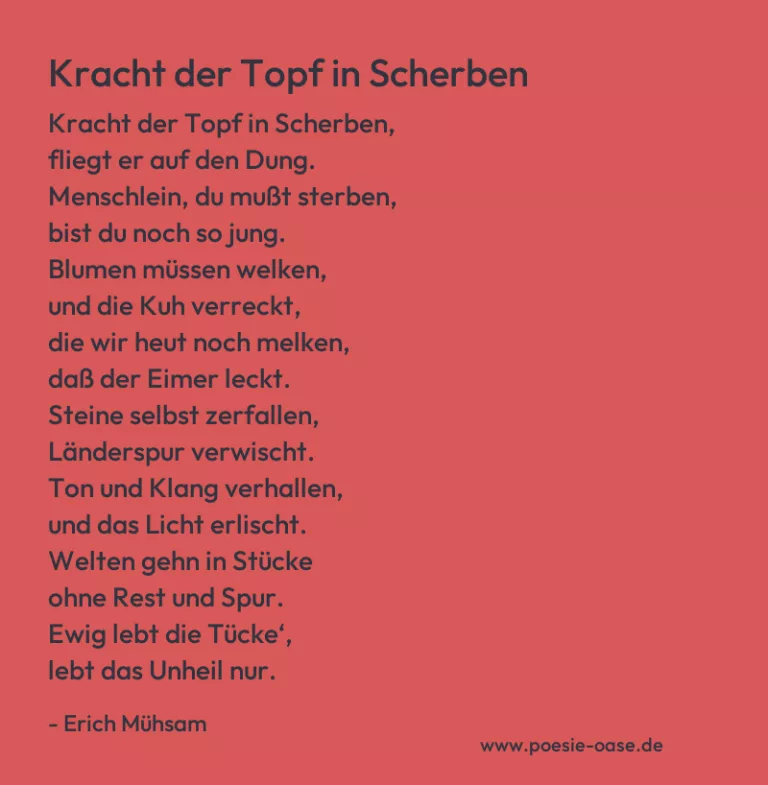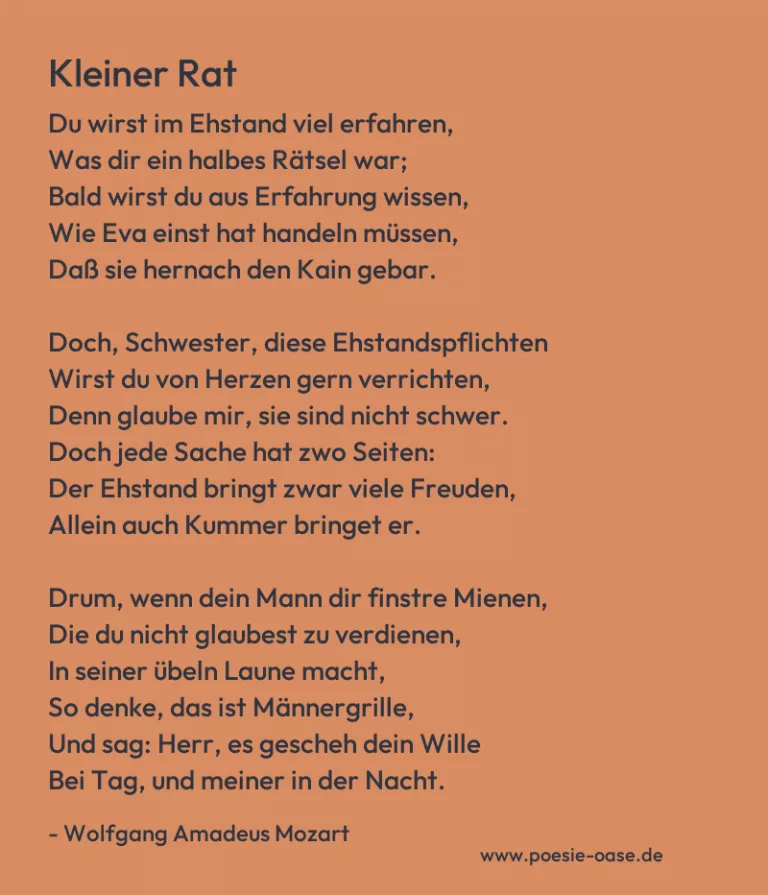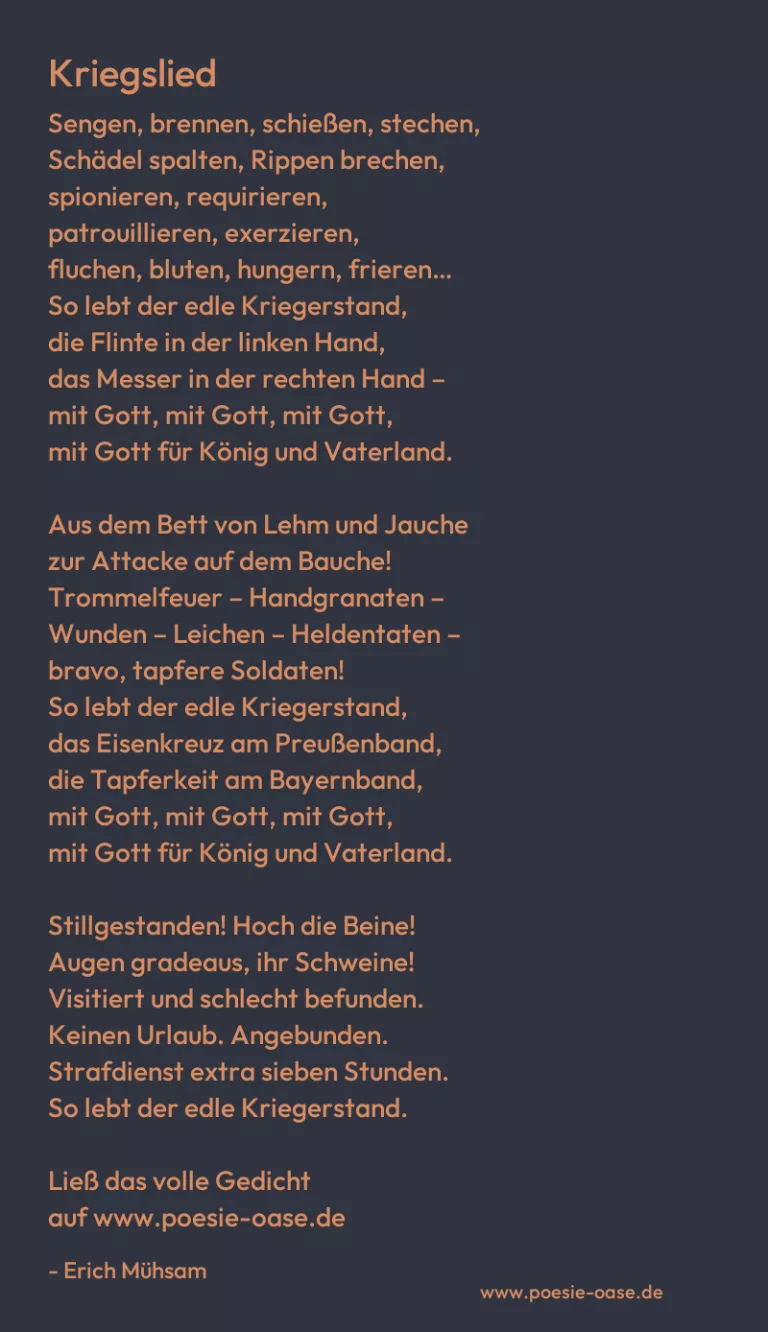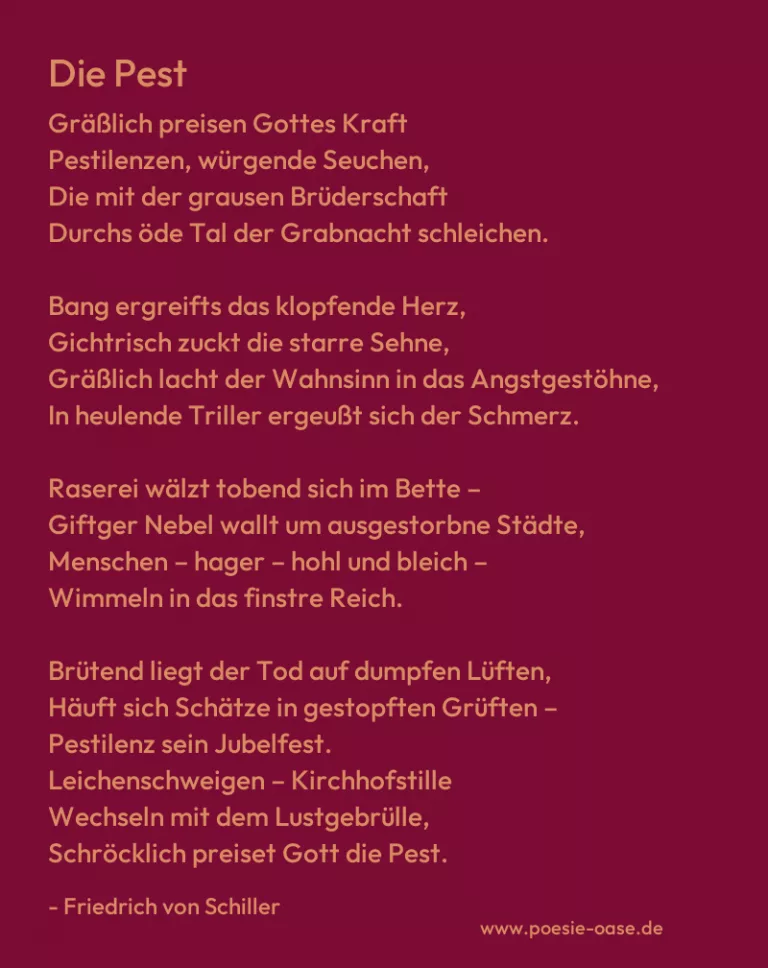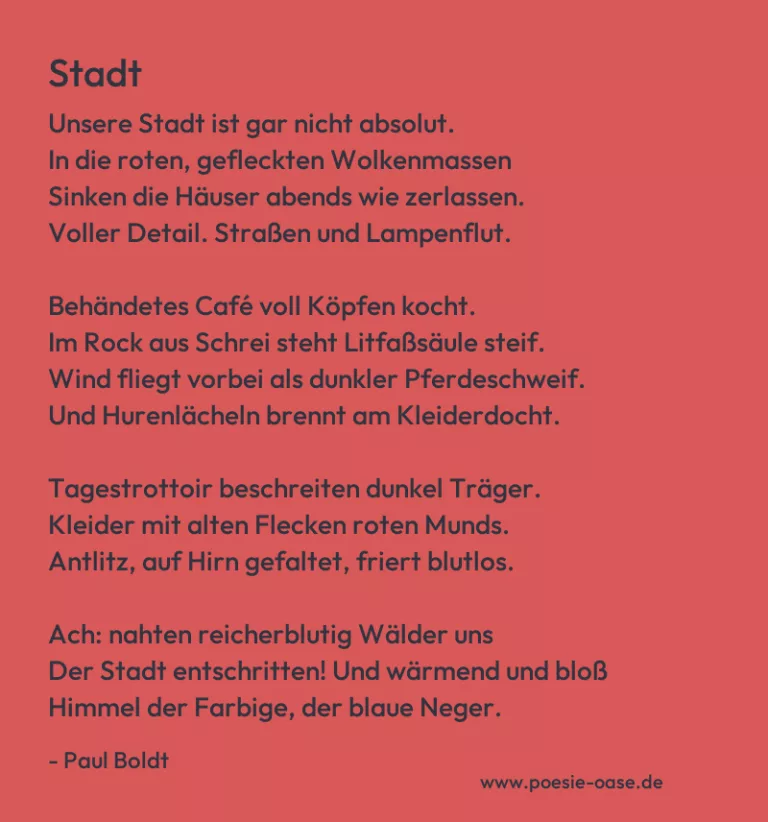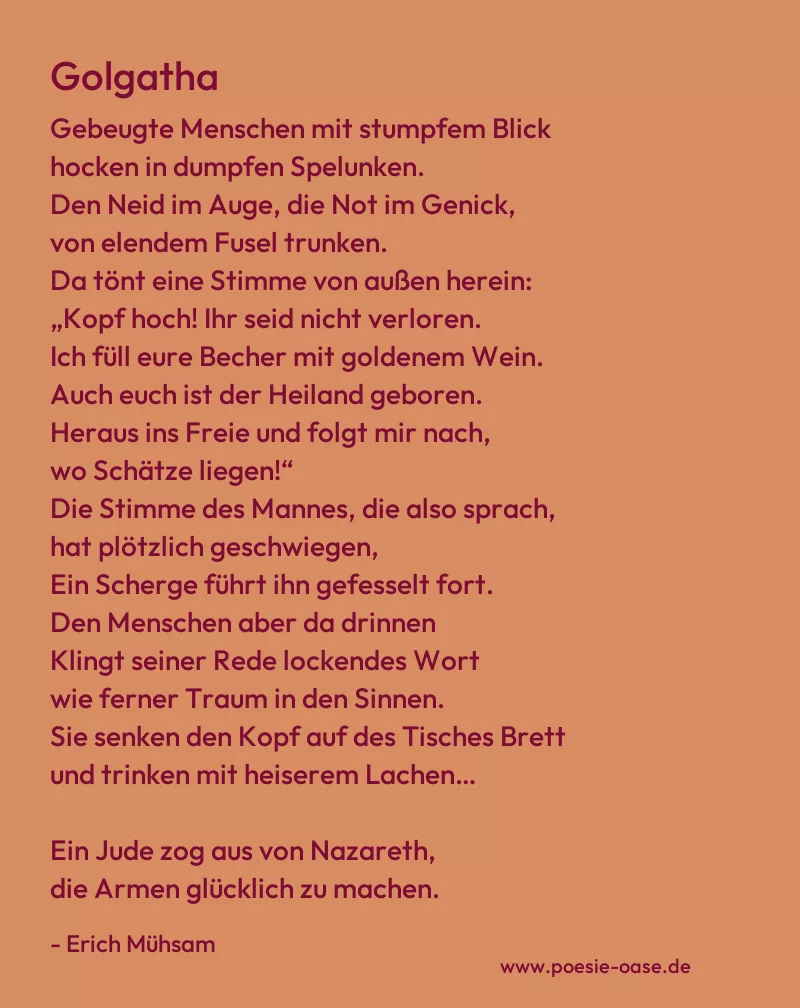Golgatha
Gebeugte Menschen mit stumpfem Blick
hocken in dumpfen Spelunken.
Den Neid im Auge, die Not im Genick,
von elendem Fusel trunken.
Da tönt eine Stimme von außen herein:
„Kopf hoch! Ihr seid nicht verloren.
Ich füll eure Becher mit goldenem Wein.
Auch euch ist der Heiland geboren.
Heraus ins Freie und folgt mir nach,
wo Schätze liegen!“
Die Stimme des Mannes, die also sprach,
hat plötzlich geschwiegen,
Ein Scherge führt ihn gefesselt fort.
Den Menschen aber da drinnen
Klingt seiner Rede lockendes Wort
wie ferner Traum in den Sinnen.
Sie senken den Kopf auf des Tisches Brett
und trinken mit heiserem Lachen…
Ein Jude zog aus von Nazareth,
die Armen glücklich zu machen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
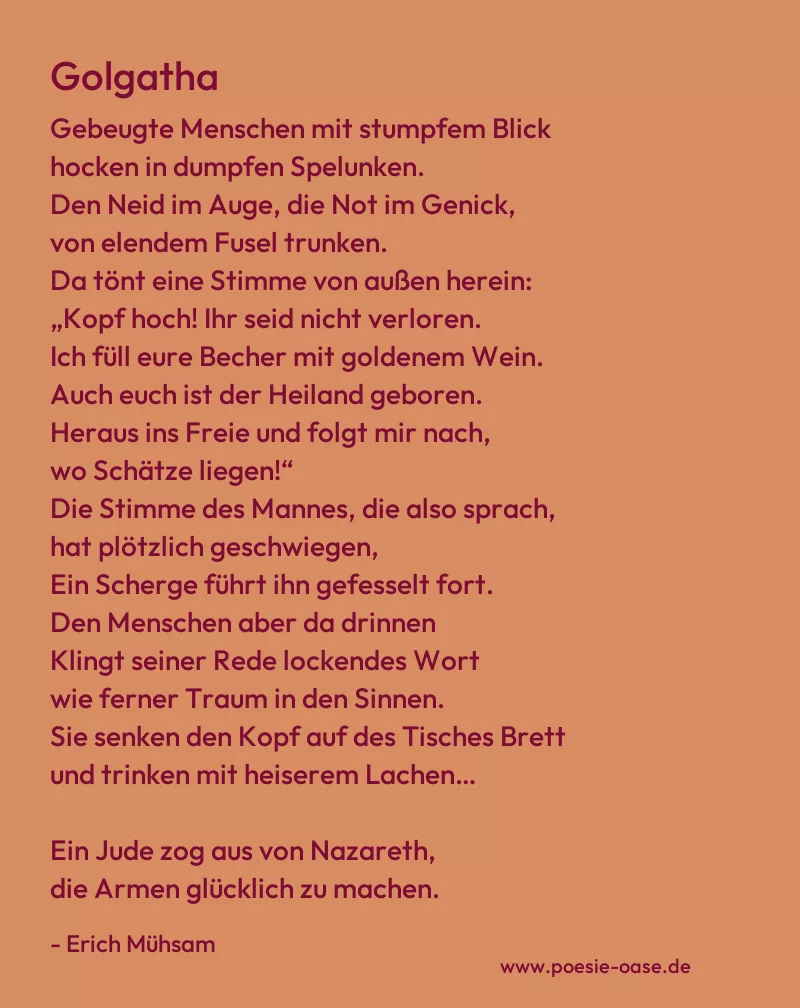
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Golgatha“ von Erich Mühsam thematisiert die Enttäuschung und die Ironie der Welt, in der Hoffnung und Erlösung von denjenigen, die sie predigen, oft nicht erreicht werden. Zu Beginn des Gedichts beschreibt Mühsam eine Gruppe von „gebeugten Menschen“ mit „stumpfem Blick“, die in „dumpfen Spelunken“ in der Tristesse ihres Lebens gefangen sind. Der „Neid im Auge“ und die „Not im Genick“ zeichnen ein Bild von Menschen, die von Armut und Verzweiflung geplagt werden, während der „elende Fusel“ als Symbol für den Versuch dient, das Leid zu betäuben. Diese Darstellung vermittelt eine düstere Realität, in der die Hoffnungslosigkeit der Menschen durch den schmerzhaften Alltag bestimmt wird.
Die Wende kommt mit der Stimme von außen, die den betroffenen Menschen Trost und Erlösung verspricht: „Kopf hoch! Ihr seid nicht verloren. / Ich füll eure Becher mit goldenem Wein.“ Der Sprecher, der den Menschen Hoffnung und eine bessere Zukunft in Aussicht stellt, wird als Erlöserfigur dargestellt, die den Armen und Elenden eine Möglichkeit zur Befreiung bietet. Diese Worte erinnern an die Botschaft des christlichen Heils, das den „verlorenen“ Menschen Rettung verspricht. Doch die Hoffnung wird schnell zerstört, als die Stimme des Mannes „plötzlich geschwiegen“ ist und er von einem „Scherge“ gefesselt fortgeführt wird. Dies symbolisiert die Zerschlagung der Hoffnung durch die grausame Realität von Macht und Unterdrückung.
Der Konflikt zwischen der verheißungsvollen Botschaft und der brutalen Realität wird weiter verstärkt, als die „Menschen da drinnen“ nach dem fortgeführten Mann weiter in ihrer Tristesse verharren. Das „lockende Wort“ des Erlösers klingt nur wie ein „ferner Traum in den Sinnen“ – eine unerreichbare, unerfüllte Sehnsucht. Statt der erhofften Erlösung sinken die Menschen wieder in ihren alten Trott zurück, trinken weiter „mit heiserem Lachen“ und scheinen sich von der Möglichkeit der Befreiung verabschiedet zu haben.
Am Ende des Gedichts führt Mühsam den „Juden aus Nazareth“ ein, der in einem starken historischen Bezug auf die christliche Erlösungsfigur anspielt. Die Schilderung des Auszugs dieses Mannes, „die Armen glücklich zu machen“, verweist auf die ursprüngliche Botschaft von Hoffnung und Barmherzigkeit, die jedoch von der Realität der Welt unterdrückt wird. Der Erlöser, der gekommen ist, um den Armen zu helfen, wird durch Gewalt und Ungerechtigkeit zum Schweigen gebracht. Das Gedicht kritisiert nicht nur die soziale Ungerechtigkeit und das Verblassen der Hoffnung, sondern auch die Kluft zwischen den verheißungsvollen Worten und der traurigen Wirklichkeit, in der sie verklingen.
Erich Mühsam setzt in diesem Gedicht auf eine scharfsinnige Gesellschaftskritik, die die Zerbrechlichkeit menschlicher Hoffnung und den zynischen Umgang mit Erlösungsversprechen thematisiert. Es ist eine düstere Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen idealistischen Visionen und der brutalen Realität des Lebens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.