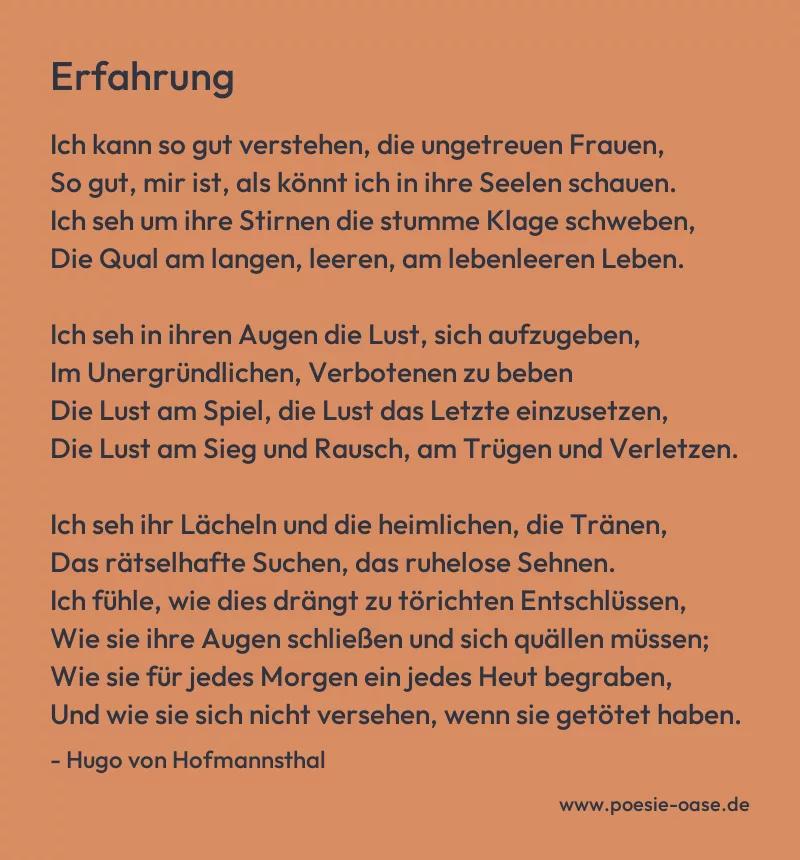Erfahrung
Ich kann so gut verstehen, die ungetreuen Frauen,
So gut, mir ist, als könnt ich in ihre Seelen schauen.
Ich seh um ihre Stirnen die stumme Klage schweben,
Die Qual am langen, leeren, am lebenleeren Leben.
Ich seh in ihren Augen die Lust, sich aufzugeben,
Im Unergründlichen, Verbotenen zu beben
Die Lust am Spiel, die Lust das Letzte einzusetzen,
Die Lust am Sieg und Rausch, am Trügen und Verletzen.
Ich seh ihr Lächeln und die heimlichen, die Tränen,
Das rätselhafte Suchen, das ruhelose Sehnen.
Ich fühle, wie dies drängt zu törichten Entschlüssen,
Wie sie ihre Augen schließen und sich quällen müssen;
Wie sie für jedes Morgen ein jedes Heut begraben,
Und wie sie sich nicht versehen, wenn sie getötet haben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
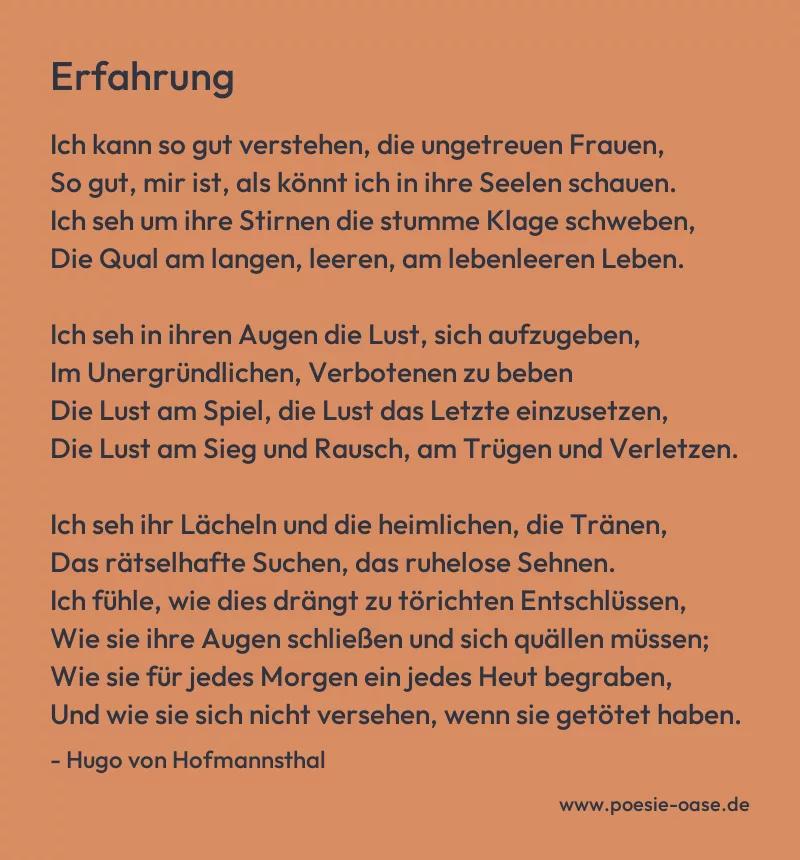
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Erfahrung“ von Hugo von Hofmannsthal offenbart eine tiefgehende Empathie und das Verständnis für die inneren Konflikte untreuer Frauen. Der Sprecher, der sich selbst in die Gefühlswelt dieser Frauen hineinversetzen kann, deutet auf eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema oder zumindest auf eine reiche Beobachtungsgabe hin. Die ersten beiden Strophen zeichnen ein komplexes Bild von Leid und Verlangen, das von der „stummen Klage“ und der „Qual“ bis hin zur „Lust, sich aufzugeben“ und der „Lust am Trügen und Verletzen“ reicht. Dieses breite Spektrum an Emotionen zeigt die Zerrissenheit der Frauen, die zwischen Verzweiflung und ungestilltem Verlangen gefangen sind.
Die zweite Hälfte des Gedichts konzentriert sich auf die konkreten Symptome dieses inneren Zwiespalts. Der Sprecher sieht „ihr Lächeln und die heimlichen, die Tränen“, das „rätselhafte Suchen“ und das „ruhelose Sehnen“. Diese Beobachtungen verdeutlichen das paradoxe Verhalten der Frauen, die einerseits nach Erfüllung streben, andererseits von einer inneren Leere getrieben werden. Die Beschreibung des „törichten Entschlüssen“ und des selbst zugefügten „Quällen“ deutet auf einen Kreislauf aus Leid, Reue und der Unfähigkeit, aus den eigenen Fehlern zu lernen, hin.
Die abschließenden Verse, „Wie sie für jedes Morgen ein jedes Heut begraben / Und wie sie sich nicht versehen, wenn sie getötet haben“, offenbaren die tragische Konsequenz dieses Verhaltensmusters. Das „Begraben“ des „Heut“ für jedes neue „Morgen“ symbolisiert die ständige Flucht vor der eigenen Realität und die Unfähigkeit, im gegenwärtigen Moment zu leben. Die Metapher des „Tötens“ ist hier besonders stark und deutet auf die zerstörerische Natur der Leidenschaft und Untreue hin, die letztendlich nicht nur andere, sondern auch sich selbst vernichten kann. Es ist ein düsteres Fazit, das die Tragödie des menschlichen Daseins in Bezug auf Liebe und Leidenschaft widerspiegelt.
Die Struktur des Gedichts, von der Beobachtung der äußeren Anzeichen bis zur Analyse der inneren Beweggründe und dem abschließenden Urteil, verstärkt die Tiefe der Auseinandersetzung. Hofmannsthals Sprache ist präzise und ausdrucksstark, sie erzeugt ein Gefühl der Intimität und des Verständnisses für die dargestellten Charaktere, ohne diese jedoch zu verurteilen. Die Verwendung von Bildern und Metaphern, wie die „stumme Klage“, die „Lust, sich aufzugeben“ oder das „Begraben“ des „Heut“, verleiht dem Gedicht eine hohe emotionale Dichte und lässt den Leser an der Erfahrung und den Emotionen der beschriebenen Frauen teilhaben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.