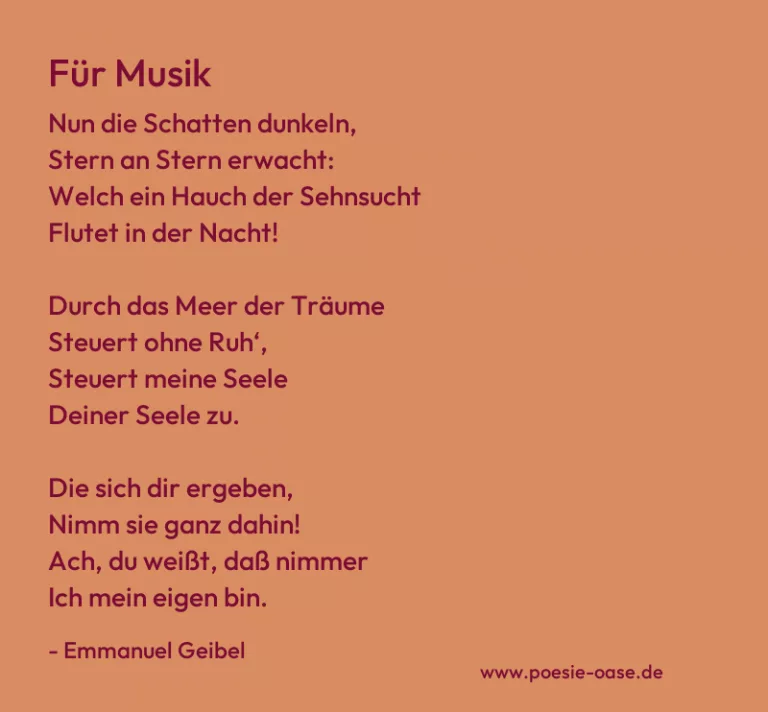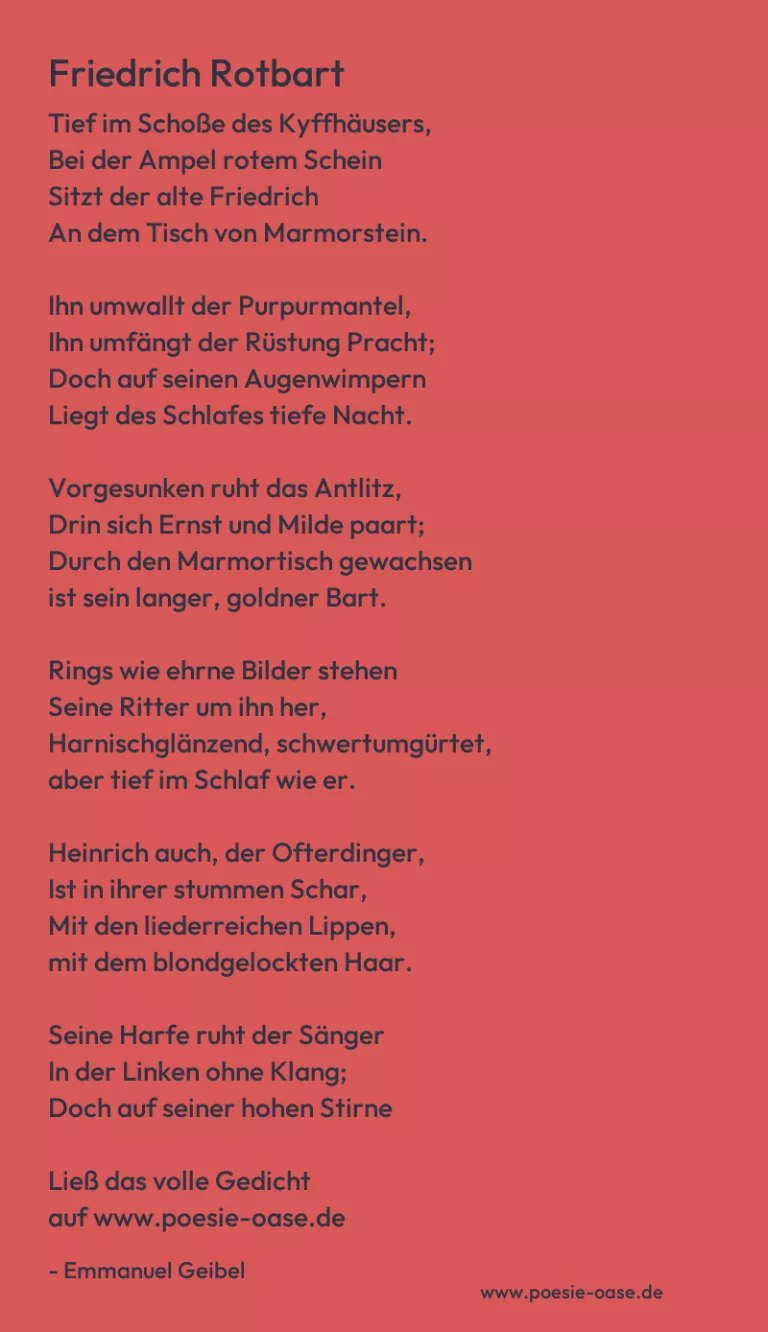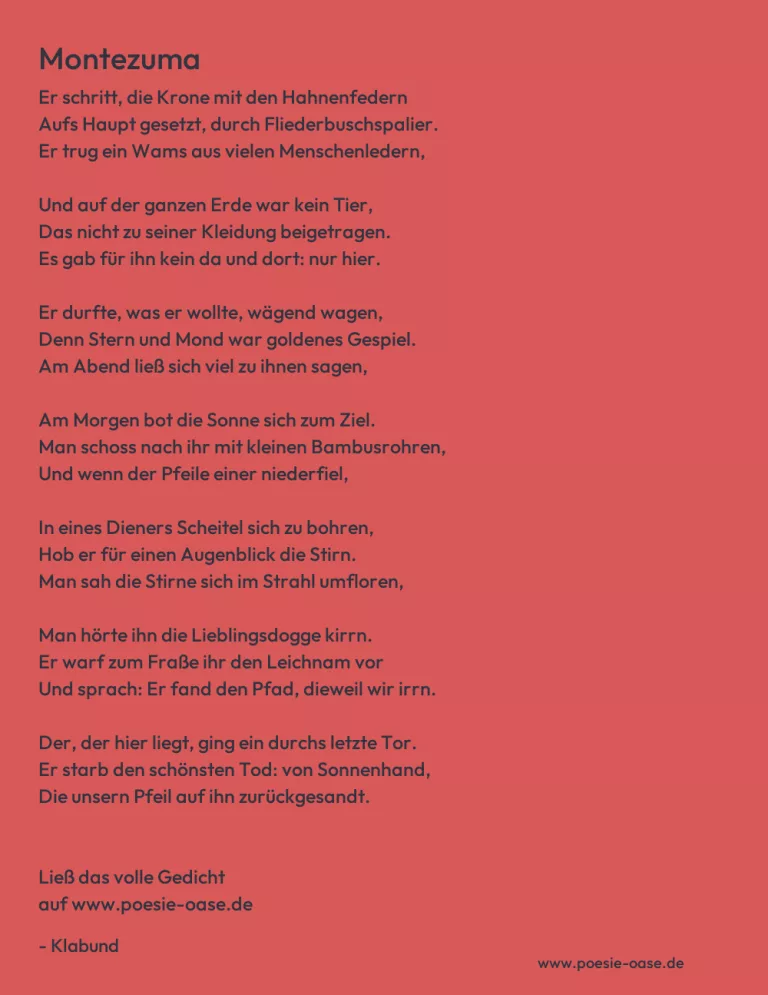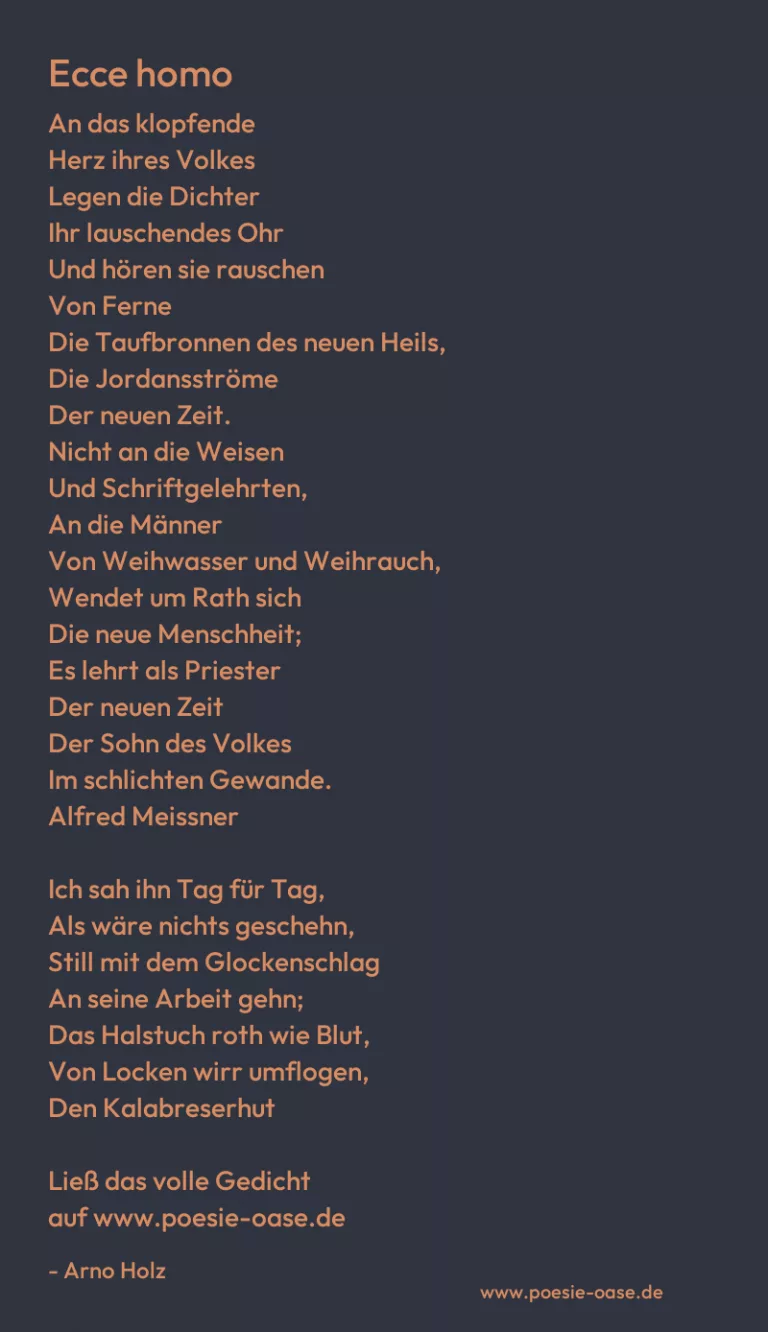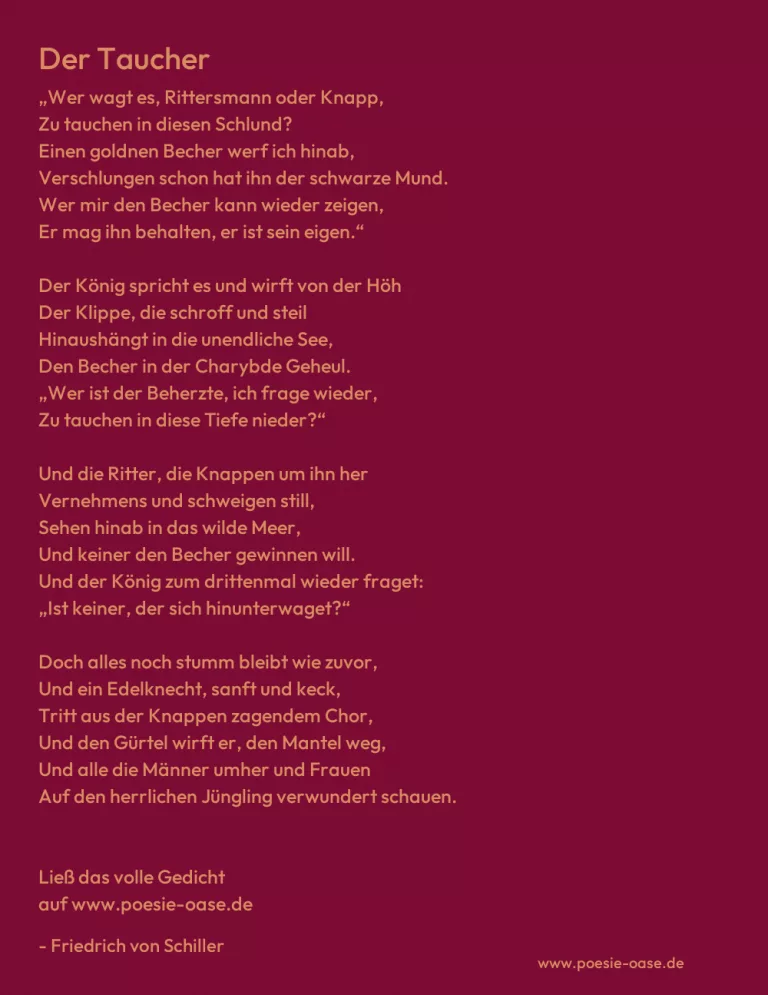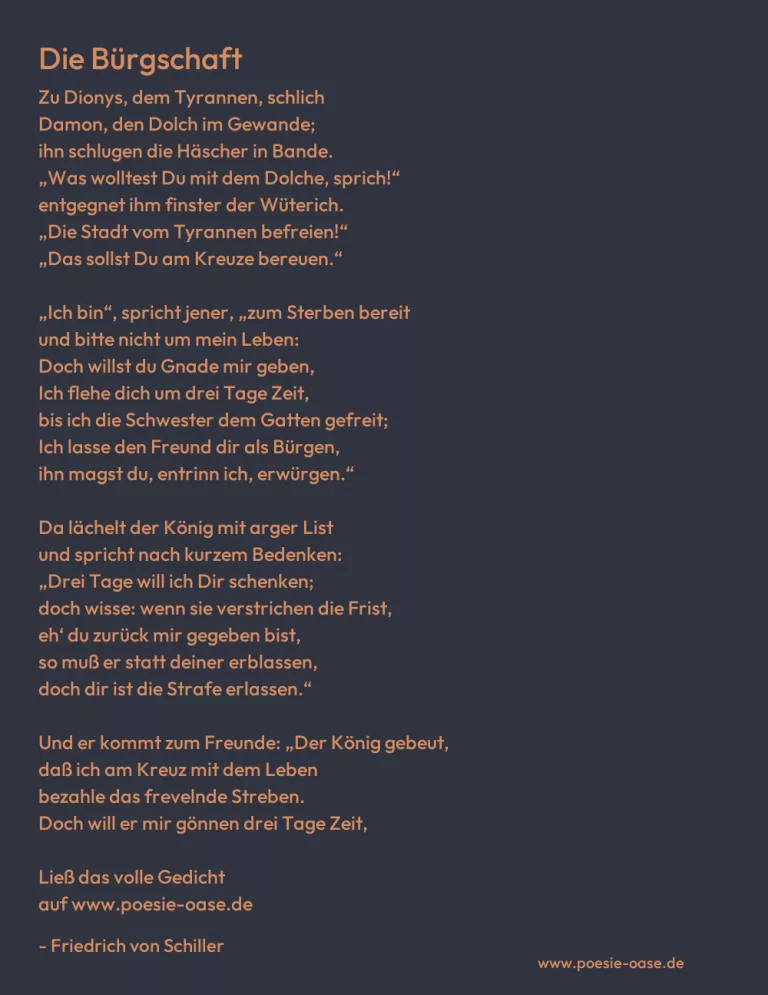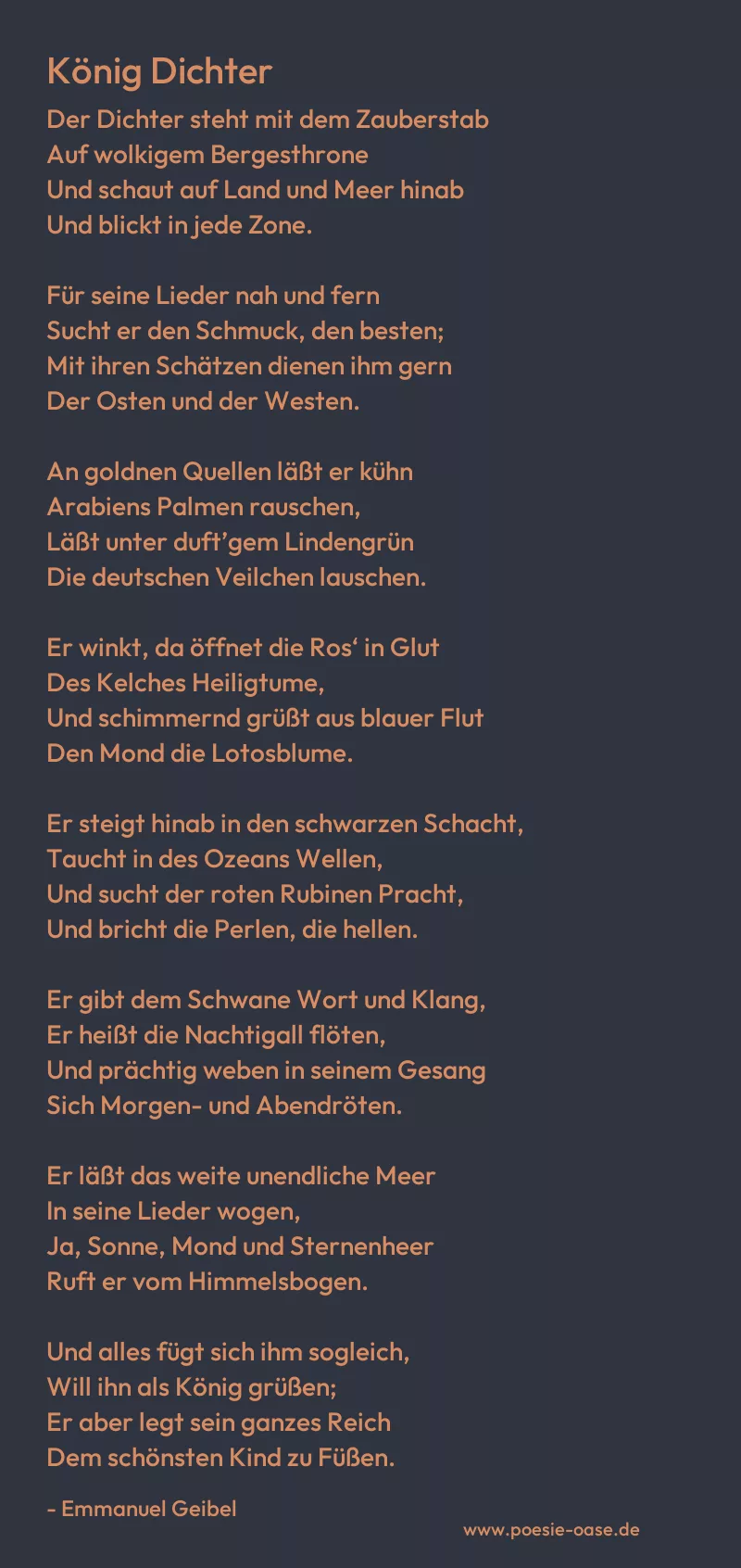Der Dichter steht mit dem Zauberstab
Auf wolkigem Bergesthrone
Und schaut auf Land und Meer hinab
Und blickt in jede Zone.
Für seine Lieder nah und fern
Sucht er den Schmuck, den besten;
Mit ihren Schätzen dienen ihm gern
Der Osten und der Westen.
An goldnen Quellen läßt er kühn
Arabiens Palmen rauschen,
Läßt unter duft’gem Lindengrün
Die deutschen Veilchen lauschen.
Er winkt, da öffnet die Ros‘ in Glut
Des Kelches Heiligtume,
Und schimmernd grüßt aus blauer Flut
Den Mond die Lotosblume.
Er steigt hinab in den schwarzen Schacht,
Taucht in des Ozeans Wellen,
Und sucht der roten Rubinen Pracht,
Und bricht die Perlen, die hellen.
Er gibt dem Schwane Wort und Klang,
Er heißt die Nachtigall flöten,
Und prächtig weben in seinem Gesang
Sich Morgen- und Abendröten.
Er läßt das weite unendliche Meer
In seine Lieder wogen,
Ja, Sonne, Mond und Sternenheer
Ruft er vom Himmelsbogen.
Und alles fügt sich ihm sogleich,
Will ihn als König grüßen;
Er aber legt sein ganzes Reich
Dem schönsten Kind zu Füßen.