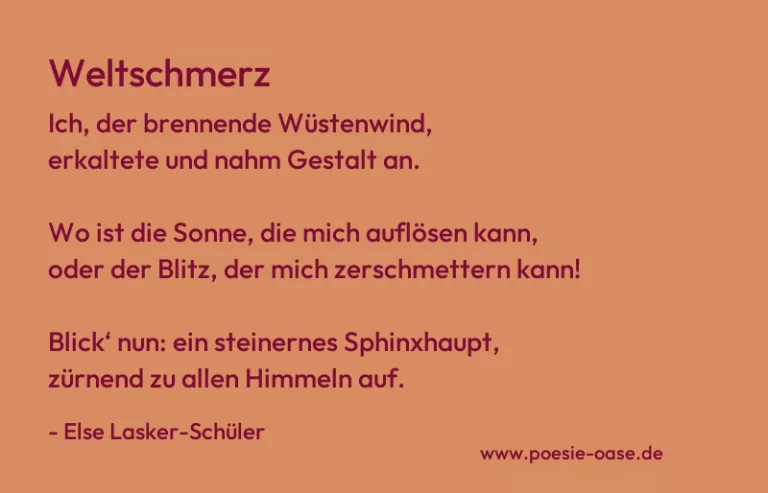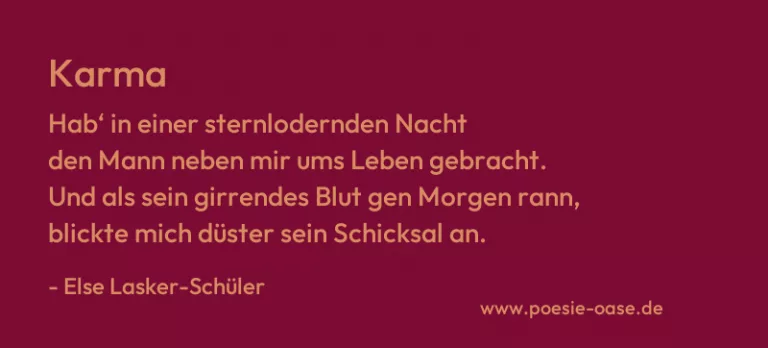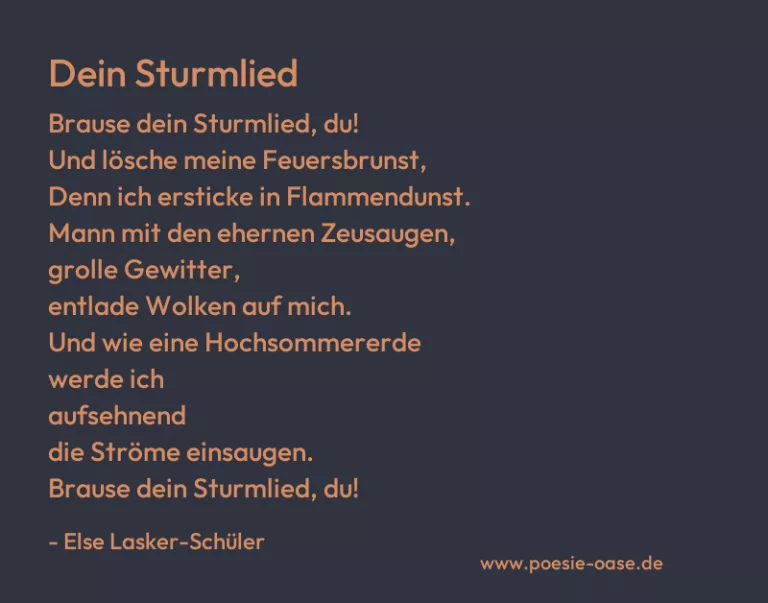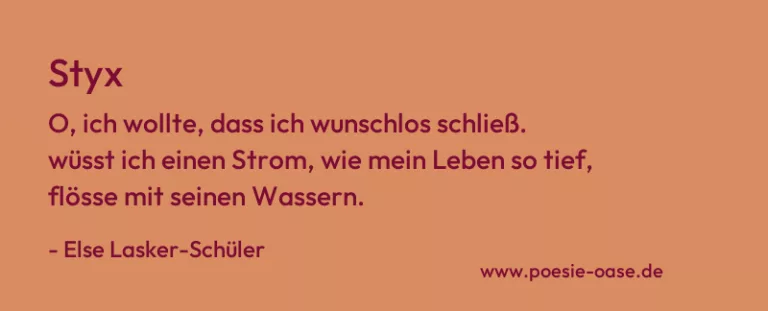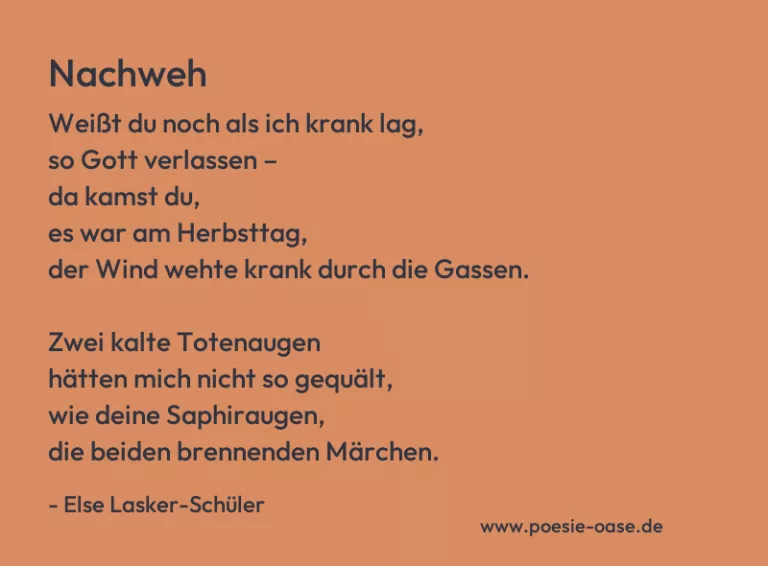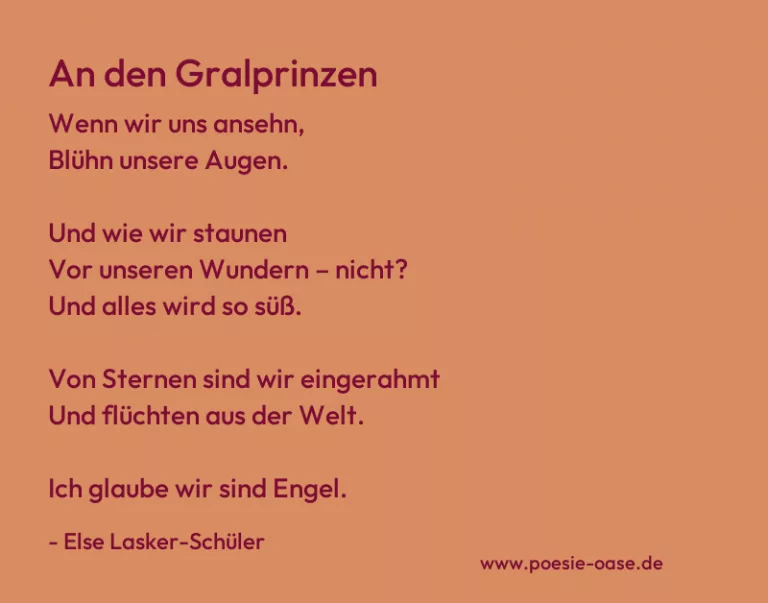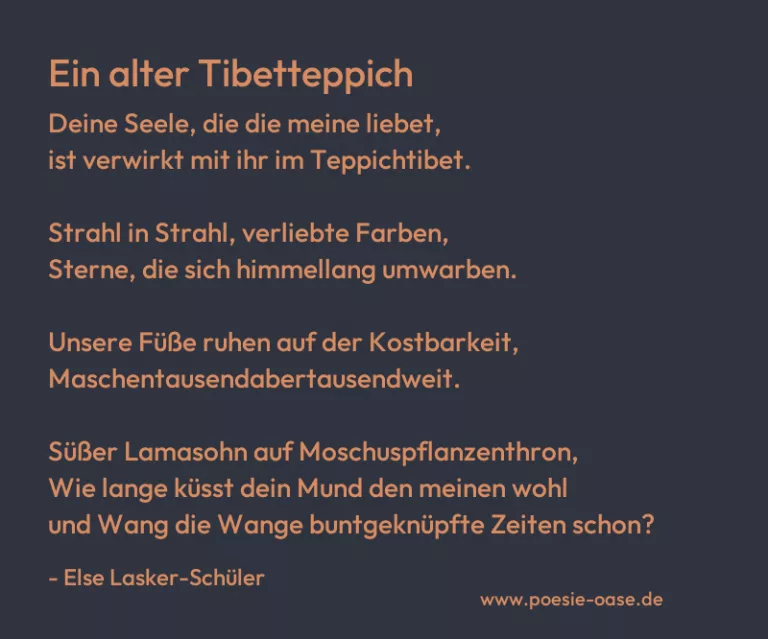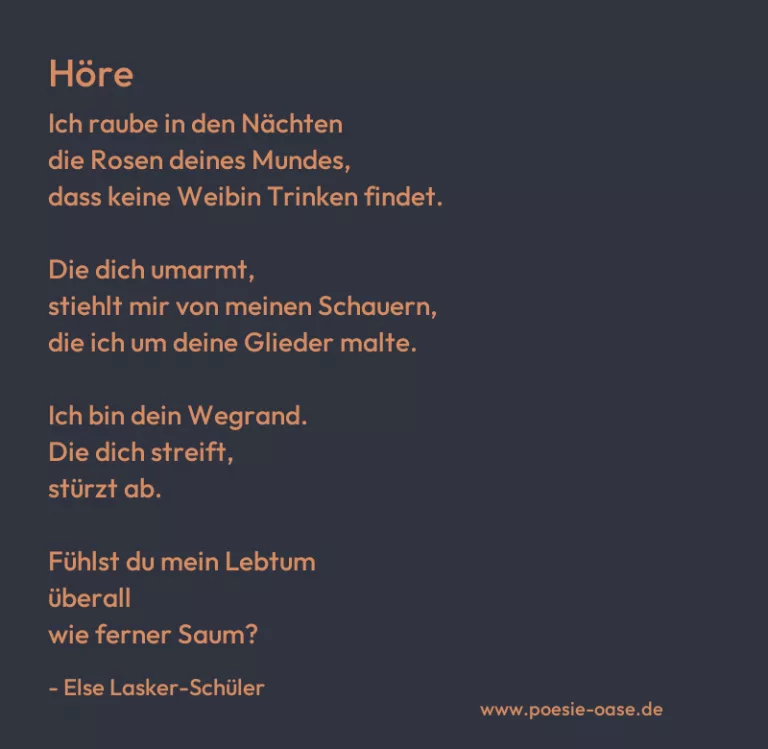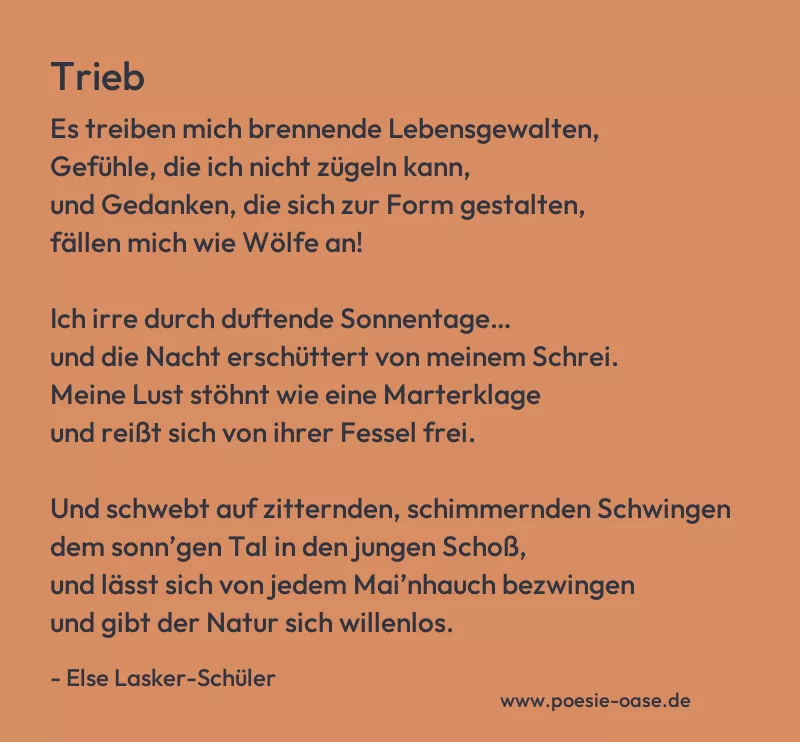Trieb
Es treiben mich brennende Lebensgewalten,
Gefühle, die ich nicht zügeln kann,
und Gedanken, die sich zur Form gestalten,
fällen mich wie Wölfe an!
Ich irre durch duftende Sonnentage…
und die Nacht erschüttert von meinem Schrei.
Meine Lust stöhnt wie eine Marterklage
und reißt sich von ihrer Fessel frei.
Und schwebt auf zitternden, schimmernden Schwingen
dem sonn’gen Tal in den jungen Schoß,
und lässt sich von jedem Mai’nhauch bezwingen
und gibt der Natur sich willenlos.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
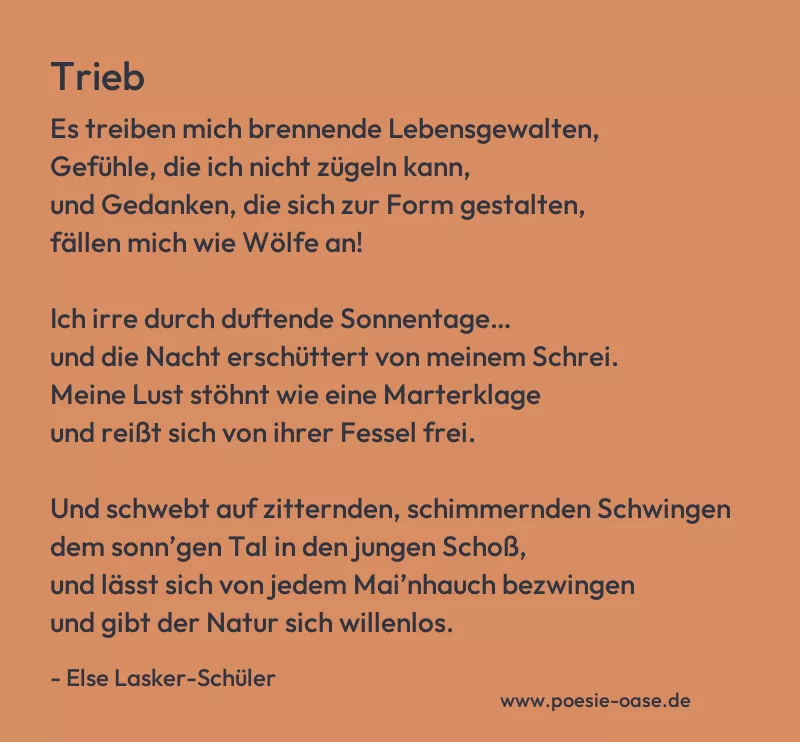
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Trieb“ von Else Lasker-Schüler vermittelt eine intensive Darstellung von unkontrollierbaren inneren Kräften und Leidenschaften, die den Sprecher sowohl quälen als auch befreien. Die ersten Zeilen setzen mit den „brennenden Lebensgewalten“ einen dramatischen Ton, indem sie die aufgewühlte, ungezähmte Natur der Gefühle und Gedanken des Sprechers betonen. Diese „Lebensgewalten“ werden als so stark beschrieben, dass sie den Sprecher wie „Wölfe“ überfallen, was die wilde, kaum beherrschbare Kraft seines inneren Drangs unterstreicht. Es ist ein Bild von Überwältigung und Angst, das durch den Vergleich mit Wölfen verstärkt wird – wilden, unbändigen Tieren, die Jagd auf den Sprecher machen.
Die Zeile „Ich irre durch duftende Sonnentage“ zeigt den Versuch, mit den eigenen Gefühlen und Wünschen einen klaren, geraden Weg zu finden, was jedoch durch die metaphorische „Irrung“ des Sprechers verweigert wird. Die „duftenden Sonnentage“ stehen für Momente von Schönheit und Leichtigkeit, doch diese positiven Eindrücke werden von der inneren Zerrissenheit und den „erschütternden“ Nächten, die von seinem „Schrei“ geprägt sind, überschattet. Der „Schrei“ könnte als Ausdruck von innerer Qual oder dem Ausbruch eines unterdrückten Verlangens interpretiert werden, das sich gegen die eigenen Fesseln erhebt.
Im nächsten Abschnitt wird die „Lust“ des Sprechers als „Marterklage“ beschrieben, was die ambivalente Beziehung des Ichs zu seinen eigenen Trieben darstellt. Einerseits wird diese Lust als befreiend und erlösend empfunden, andererseits jedoch als eine schmerzhafte und zerstörerische Kraft, die sich von ihren Fesseln löst und nicht mehr kontrollierbar ist. Die Darstellung der Lust als „Marterklage“ lässt eine tiefgreifende Qual durch den Akt der Befreiung von inneren Einschränkungen erahnen.
Die letzte Strophe beschreibt die Freiheit des Sprechers, der sich von den Fesseln seiner eigenen Natur löst und „auf zitternden, schimmernden Schwingen“ in die Welt hinausschwebt. Das Bild des „sonn’gen Tals“ und des „jungen Schoßes“ verweist auf ein natürliches, lebensbejahendes Ziel, das den Sprecher anzieht. Die Lust und der Trieb sind hier nicht mehr nur Zwang, sondern auch eine natürliche und intime Verbindung zur Welt und zu den Kräften der Natur. Diese „Natur“ wird von dem Sprecher als eine Kraft erfahren, die ihn „bezwingt“ und in die vollkommene Hingabe zieht – ein Bild der vollständigen Verschmelzung mit dem eigenen Trieb und der Natur, in einer Art willenloser Hingabe. Das Gedicht schließt somit mit einem Bild der Befreiung und der Versenkung in die Natur und das Leben, in einem Zustand von sowohl Gewalt als auch Ekstase.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.