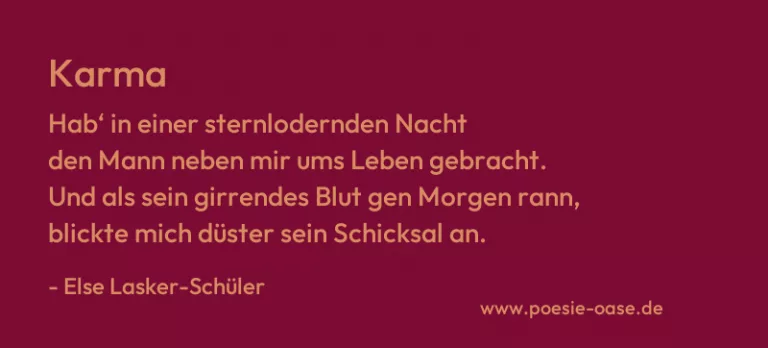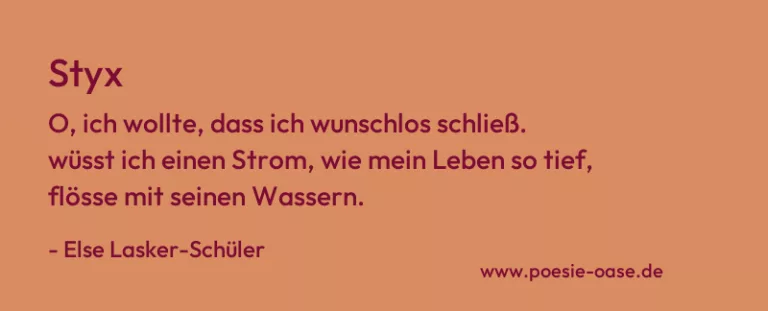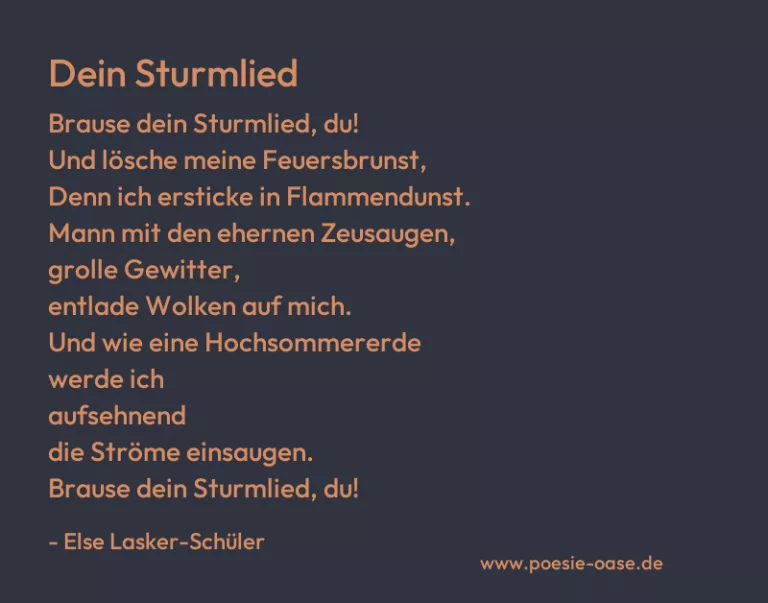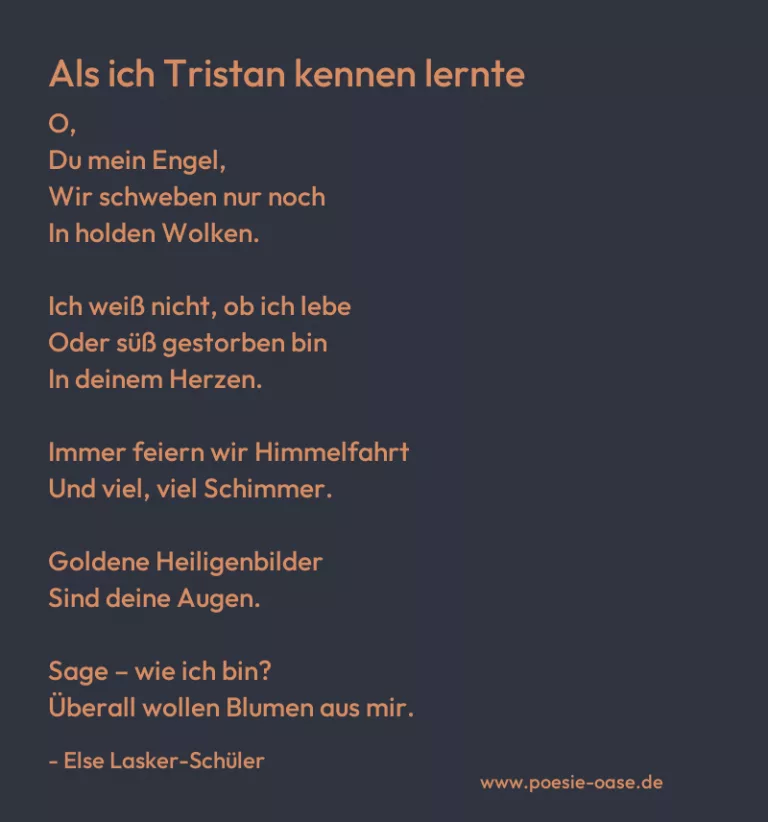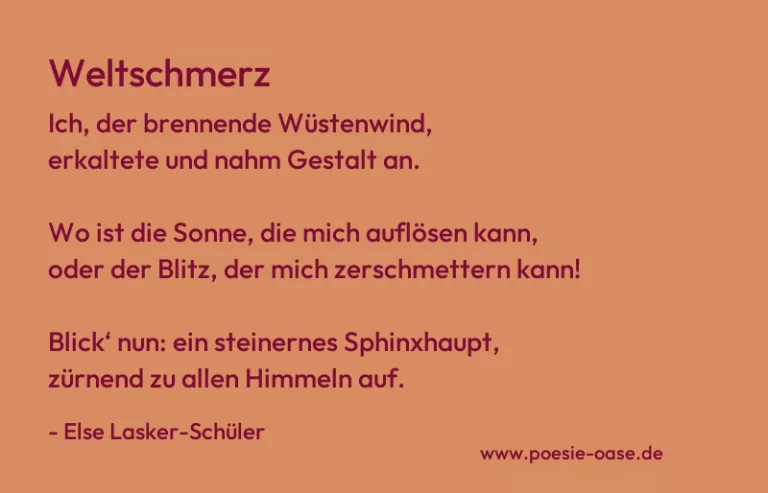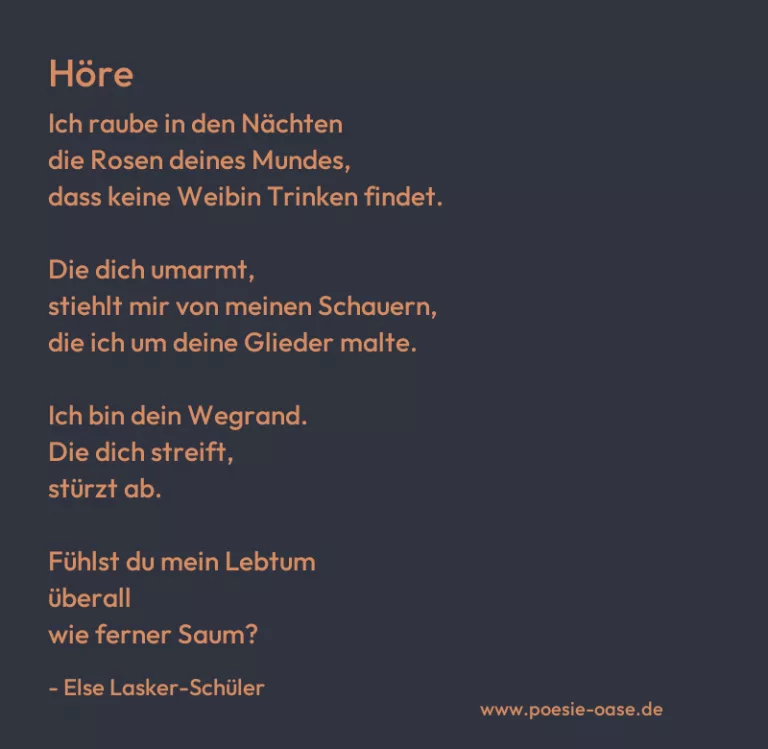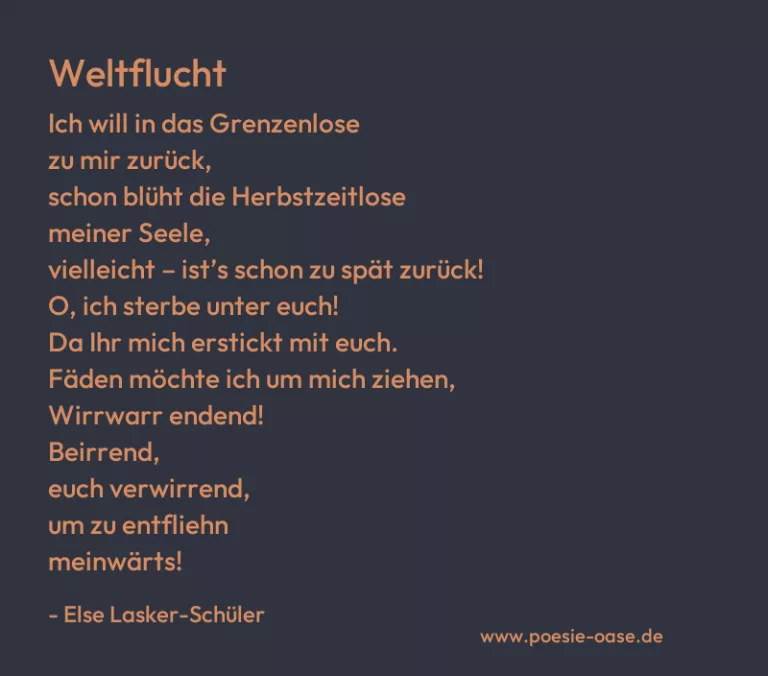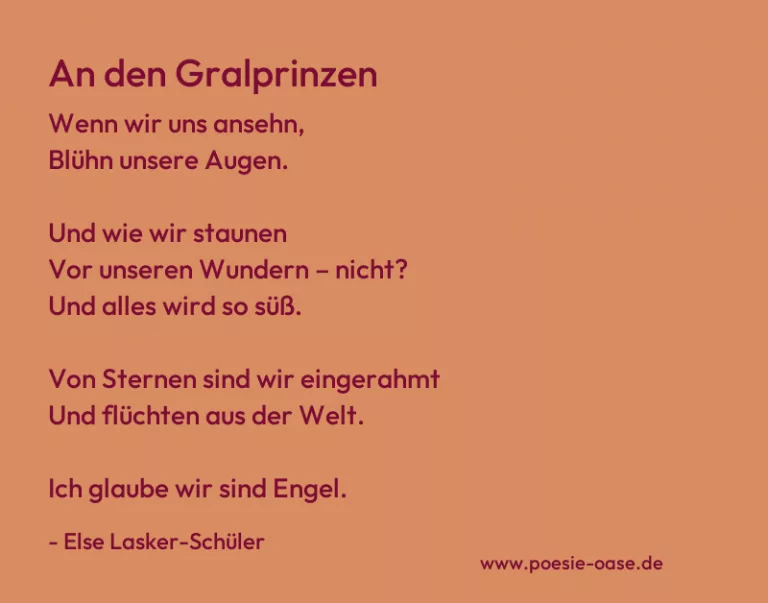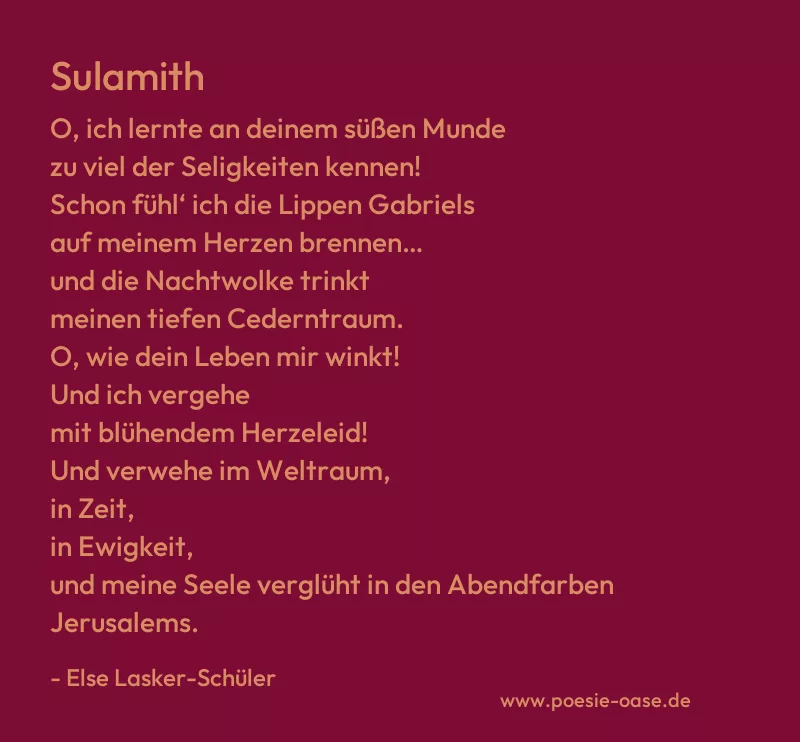Sulamith
O, ich lernte an deinem süßen Munde
zu viel der Seligkeiten kennen!
Schon fühl‘ ich die Lippen Gabriels
auf meinem Herzen brennen…
und die Nachtwolke trinkt
meinen tiefen Cederntraum.
O, wie dein Leben mir winkt!
Und ich vergehe
mit blühendem Herzeleid!
Und verwehe im Weltraum,
in Zeit,
in Ewigkeit,
und meine Seele verglüht in den Abendfarben
Jerusalems.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
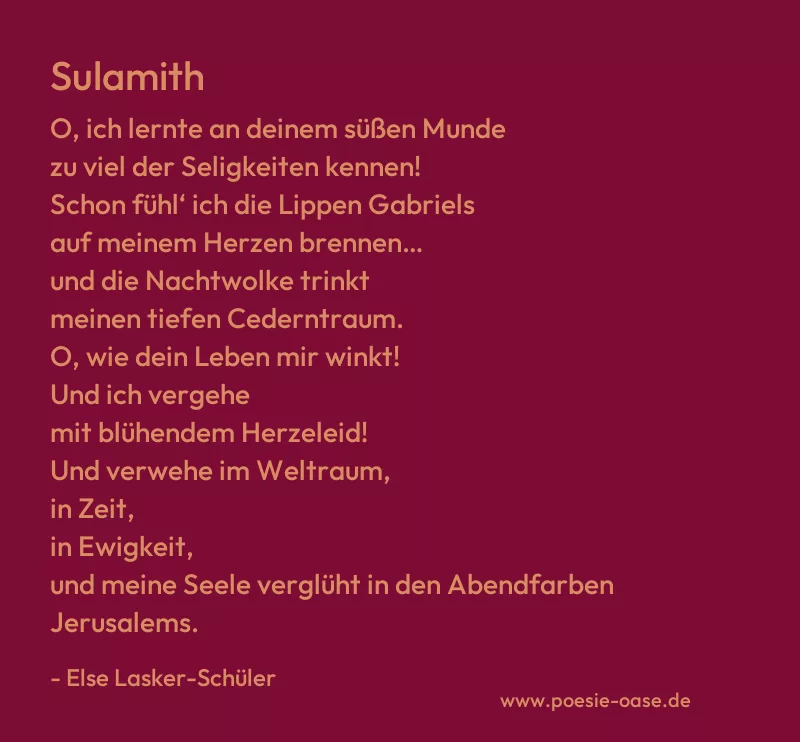
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sulamith“ von Else Lasker-Schüler thematisiert eine leidenschaftliche, fast überirdische Liebe, die mit einer Mischung aus Ekstase und tragischer Sehnsucht dargestellt wird. Die Eröffnung mit der Zeile „O, ich lernte an deinem süßen Munde / zu viel der Seligkeiten kennen!“ beschreibt eine intensive emotionale und sinnliche Erfahrung, bei der der Sprecher durch die Nähe und den Kuss des Geliebten in eine Art transzendente Glückseligkeit versetzt wird. Die „Seligkeiten“, die der Sprecher „kennenlernt“, könnten sowohl körperliche Lust als auch eine tiefere spirituelle Erfüllung ansprechen. Der Hinweis auf „die Lippen Gabriels“ verweist auf eine Verbindung zu göttlichen oder heiligen Assoziationen, was die Erhebung der Liebe auf eine höhere, fast himmlische Ebene unterstreicht.
Die Zeile „auf meinem Herzen brennen“ erzeugt das Bild einer schmerzhaften, aber zugleich belebenden Leidenschaft, die die Seele des Sprechers in Brand setzt. Diese Metapher betont die Intensität der Gefühle, die in der Liebe entbrennen und eine starke innere Transformation hervorrufen. Der „tiefe Cederntraum“, den die „Nachtwolke“ trinkt, könnte eine symbolische Darstellung von etwas Unendlichem und Mystischem sein – die „Cedern“ repräsentieren im Allgemeinen Stärke und Ewigkeit, was die tragische Tiefe des Traums und der Sehnsucht des Sprechers widerspiegelt.
Das Bild des Lebens, das dem Sprecher „winkt“, deutet auf eine Einladung oder ein lockendes Versprechen hin, die Liebe in all ihrer Intensität zu erleben. Doch gleichzeitig verzeichnet das Gedicht eine Art von Vergehens – „und ich vergehe / mit blühendem Herzeleid!“ Das „blühende Herzeleid“ verweist auf eine bittersüße Leidenschaft, die nicht nur Freude, sondern auch Schmerz und Verlust mit sich bringt. Diese Ambivalenz ist ein zentrales Thema des Gedichts, in dem Liebe sowohl als Quelle des Lebens als auch als Quelle des Leidens dargestellt wird.
Die letzte Strophe steigert die Vision der Vergänglichkeit, in der der Sprecher im „Weltraum“, in „Zeit“ und „Ewigkeit“ verweht. Diese Form der Auflösung in das Unendliche und das Vergehen im „Weltraum“ lässt den Sprecher als unendlich kleine, aber doch bedeutungsvolle Entität erscheinen, die ihre physische Existenz im Kosmos und in der Zeit verliert. Das Bild von „Jerusalems Abendfarben“ bringt die religiöse und spirituelle Dimension in das Gedicht, in der der Tod und das Vergehen mit einer mystischen und sakralen Erfahrung verknüpft werden. Die „Verglühen“ der Seele in diesen Farben verweist auf eine transzendente, göttliche Vereinigung, die über das weltliche Leben hinausgeht. Das Gedicht endet also mit einer Vision der Erhebung und des Verschwindens in einem Zustand jenseits von Raum und Zeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.