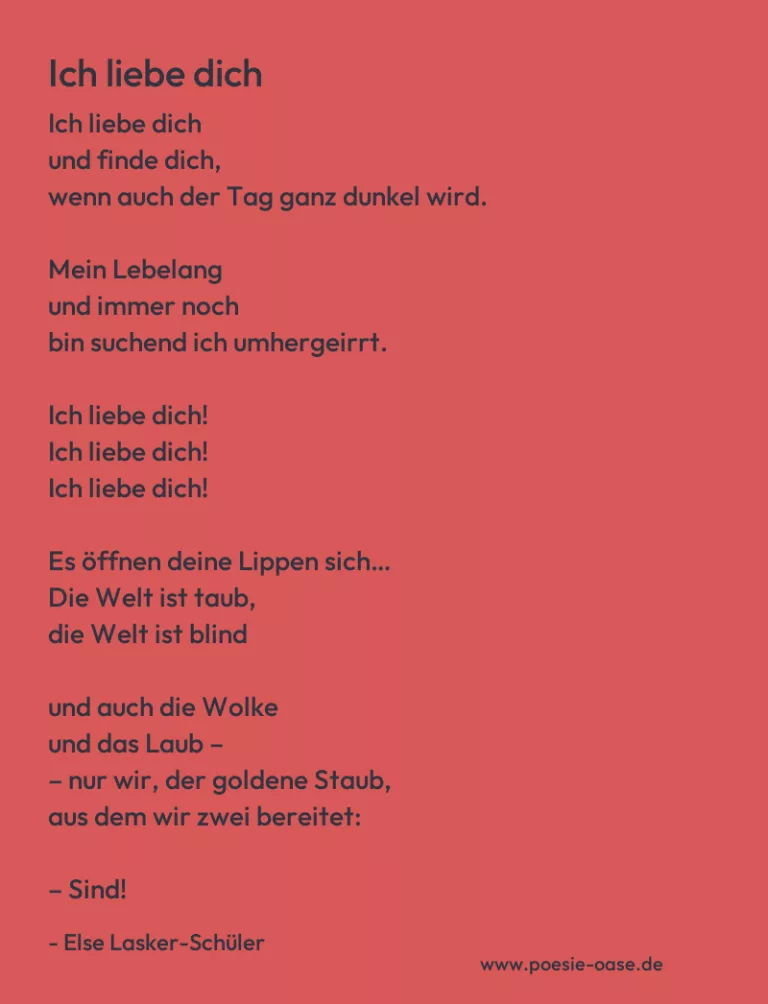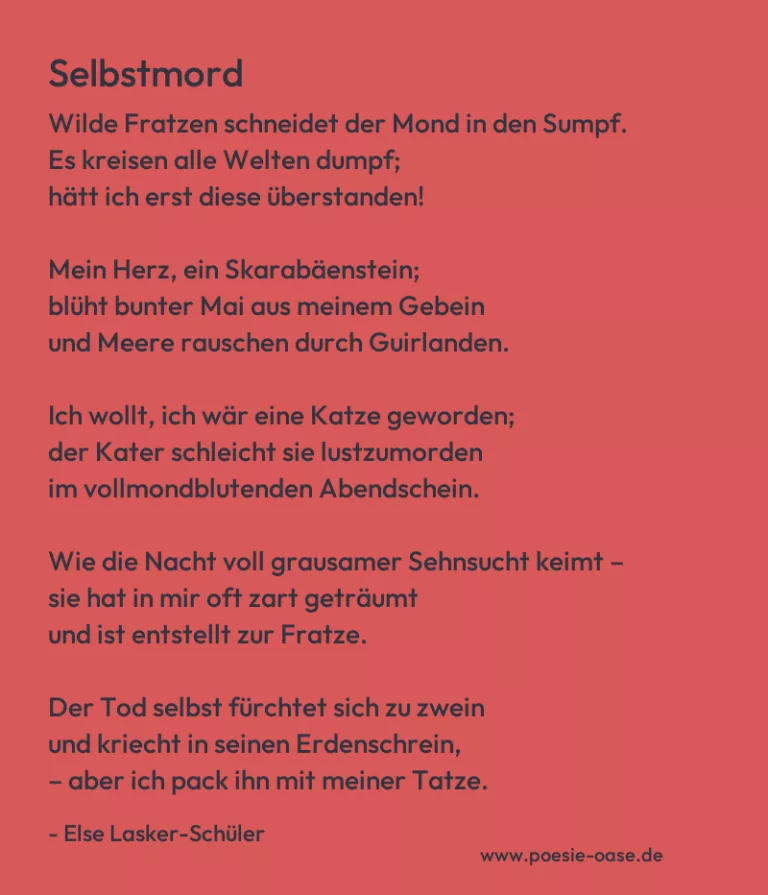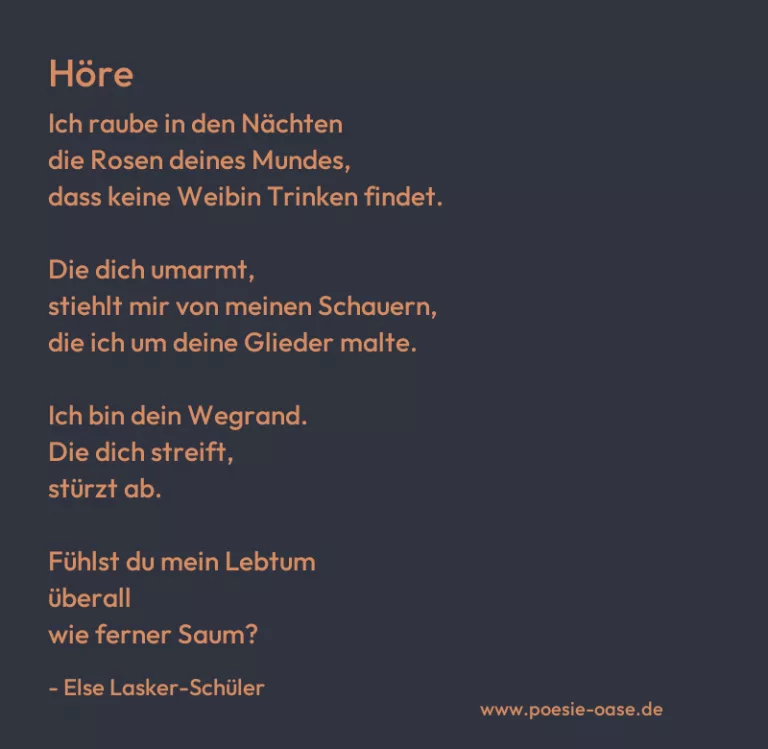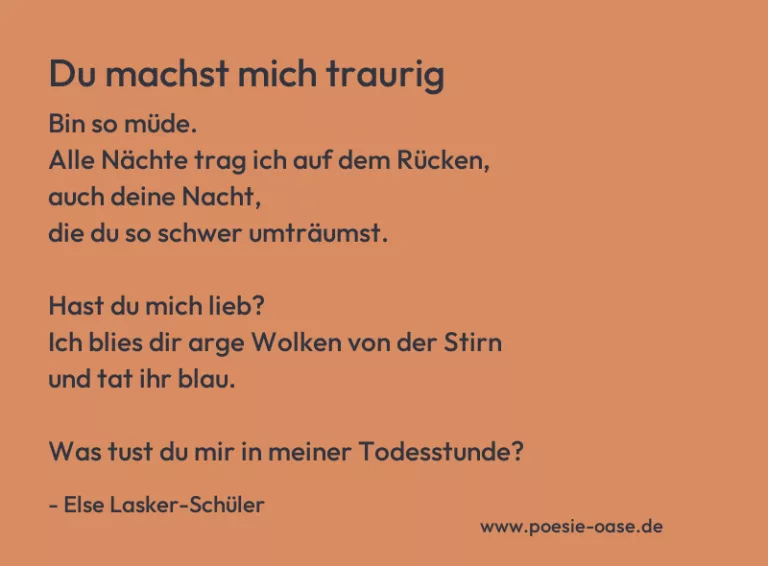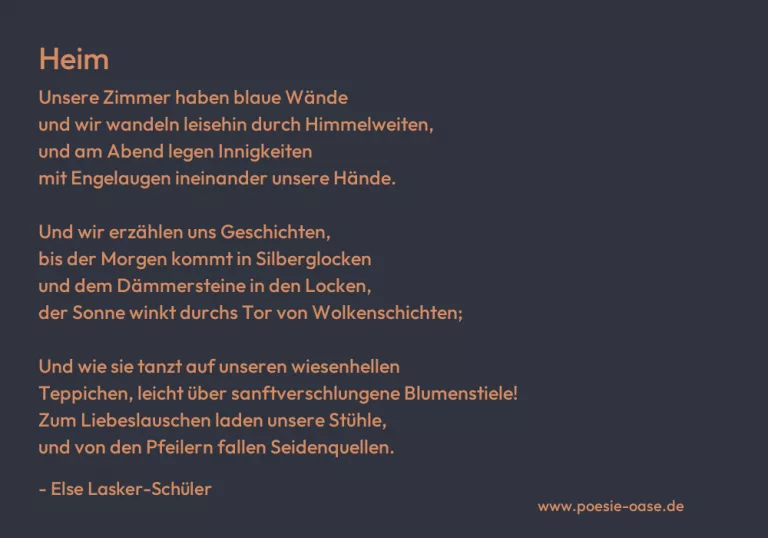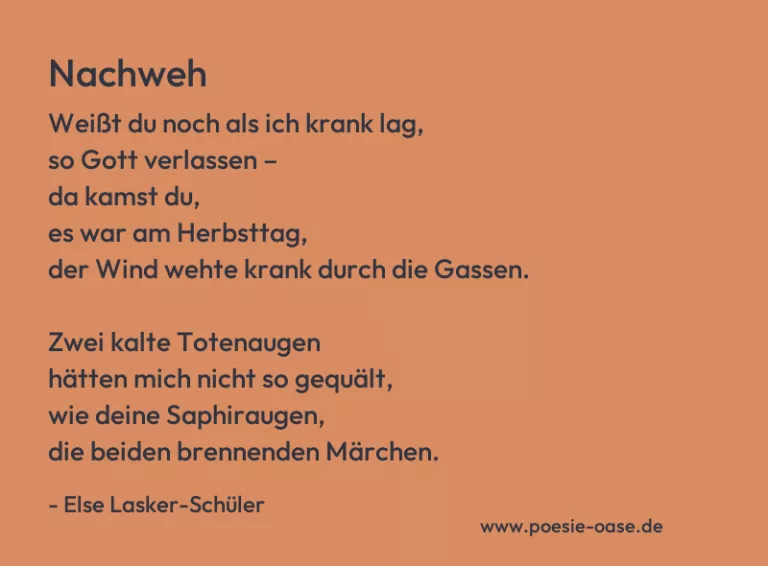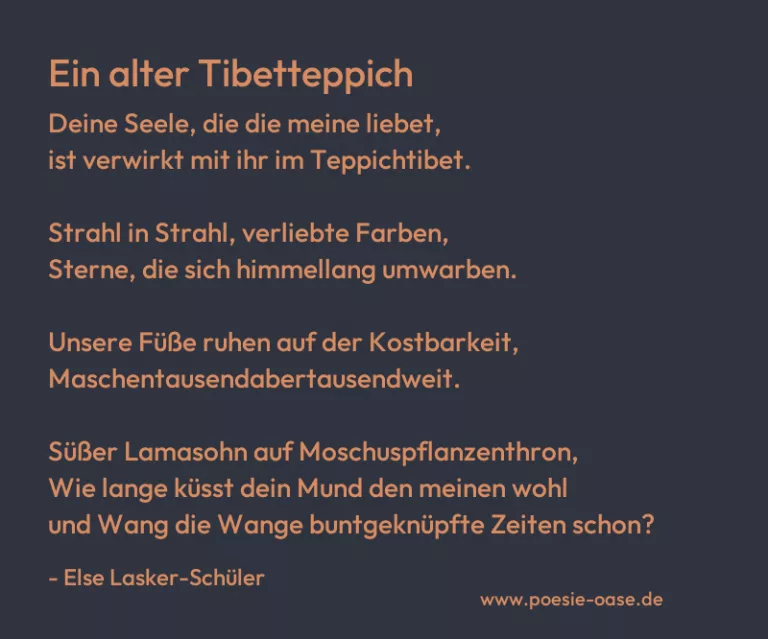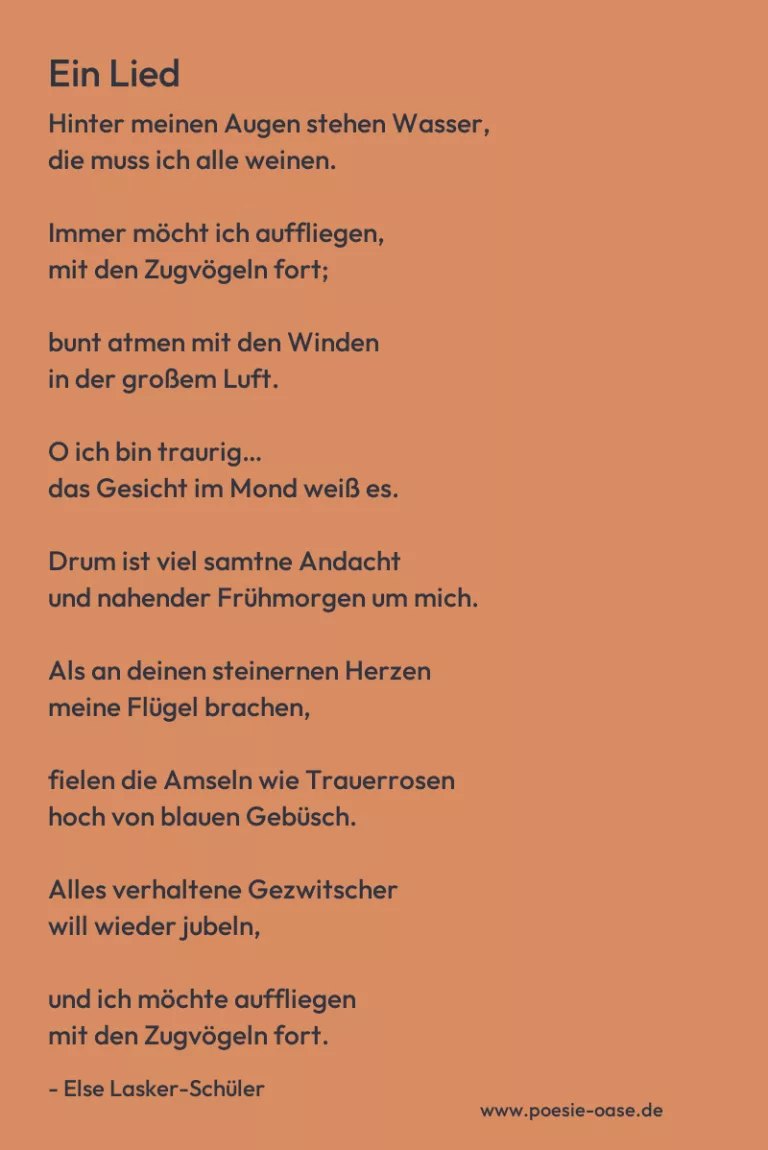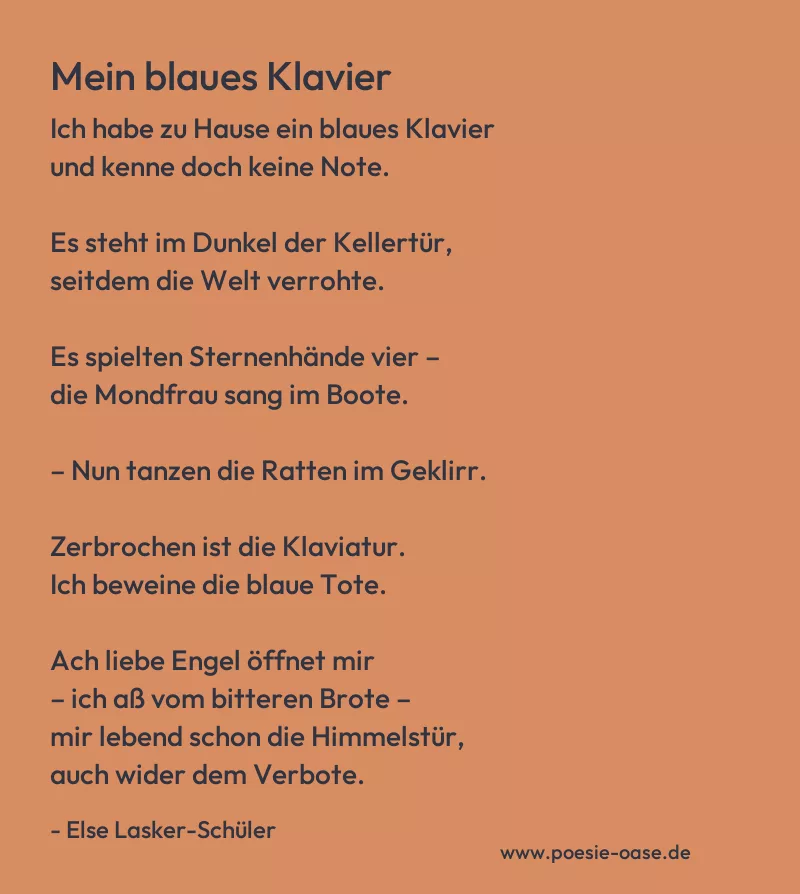Mein blaues Klavier
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
und kenne doch keine Note.
Es steht im Dunkel der Kellertür,
seitdem die Welt verrohte.
Es spielten Sternenhände vier –
die Mondfrau sang im Boote.
– Nun tanzen die Ratten im Geklirr.
Zerbrochen ist die Klaviatur.
Ich beweine die blaue Tote.
Ach liebe Engel öffnet mir
– ich aß vom bitteren Brote –
mir lebend schon die Himmelstür,
auch wider dem Verbote.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
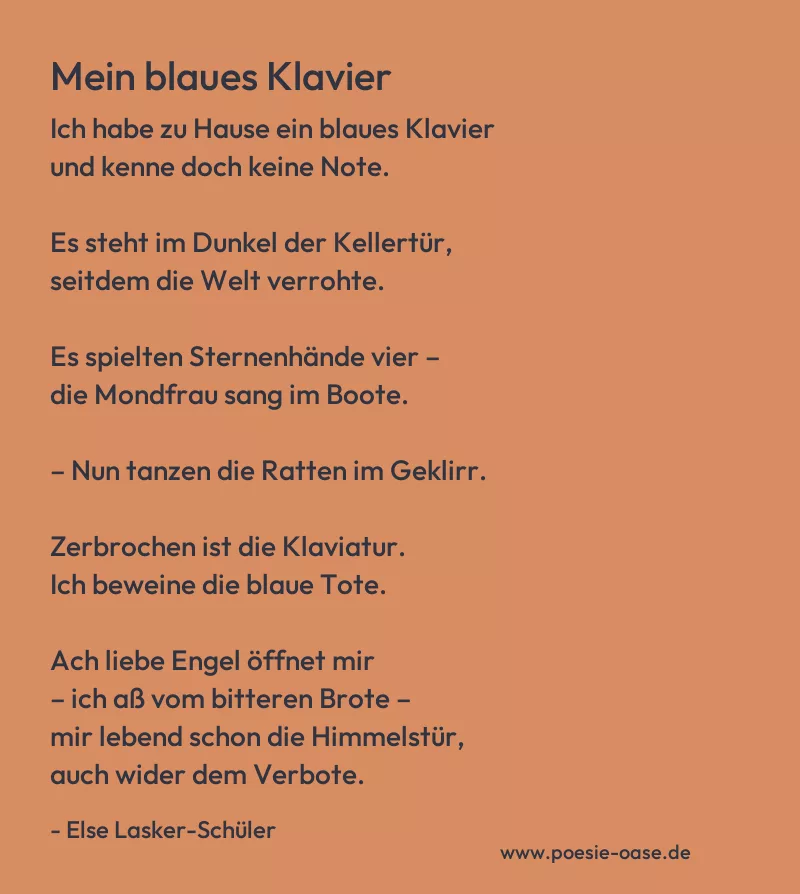
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mein blaues Klavier“ von Else Lasker-Schüler ist eine poetische Auseinandersetzung mit Verlust, Entfremdung und der Sehnsucht nach einer übernatürlichen Erlösung. Zu Beginn beschreibt die Sprecherin ein „blaues Klavier“, das sie zu Hause hat, aber keine „Note“ kennt. Das Klavier als Symbol für Kunst, Kreativität und Ausdruck ist zwar vorhanden, doch sie ist nicht in der Lage, seine „Töne“ zu spielen oder die Schönheit seiner Musik zu erfassen. Diese Unfähigkeit, das Klavier zu nutzen, könnte eine Metapher für das Gefühl der Entfremdung von der eigenen inneren Welt oder von der Möglichkeit der schöpferischen Entfaltung sein.
Das „Dunkel der Kellertür“ ist ein weiterer Hinweis auf das Vergessen oder das Unterdrücken von etwas, das einst lebendig war. Der Keller, ein Ort des Verborgenen und des Vergessens, stellt den Raum dar, in dem das Klavier – und möglicherweise die Erinnerungen oder Gefühle, die es repräsentiert – in Dunkelheit gehüllt sind. Es wird gesagt, dass das Klavier „seitdem die Welt verrohte“ da steht, was auf einen tiefen Verlust und einen dramatischen Wandel hinweist. Der Verfall der Welt, der als „verroht“ beschrieben wird, könnte den inneren Zustand der Sprecherin widerspiegeln, der von einer verlorenen Unschuld und der Zerstörung von Idealen geprägt ist.
Das Bild der „Sternenhände“ und der „Mondfrau“, die im Boot singt, fügt eine mystische Dimension hinzu. Diese Vorstellung von „Sternenhänden“ und der „Mondfrau“ könnte auf die Vorstellung von unerreichbaren, himmlischen Kräften hindeuten, die im Einklang mit der Natur und dem Universum wirken. Sie spielen das Klavier und singen, was einen Moment der Harmonie und Schönheit suggeriert – jedoch ist dieser Moment bereits vergangen, und die Schönheit wird von der dunklen Gegenwart verdrängt. Die „Ratten im Geklirr“ und das „Zerbrochene“ deuten auf den Zerfall und die Zerstörung hin, sowohl im inneren als auch im äußeren Leben der Sprecherin. Der Verlust der „Klaviatur“ und das „Beweinen der blauen Toten“ verstärken die Traurigkeit und den Schmerz über das Verlorene, das nicht mehr erreichbar ist.
Die Bitte „Ach liebe Engel öffnet mir / – ich aß vom bitteren Brote – / mir lebend schon die Himmelstür“ drückt eine tiefe Sehnsucht nach Erlösung aus. Die Sprecherin bittet die Engel um Hilfe, um Zugang zu einer höheren Ebene der Existenz zu erhalten – die „Himmelstür“, die ihr sonst verschlossen bleibt. Sie hat „vom bitteren Brote“ gegessen, was auf Leiden und Entbehrung hinweist. Dennoch fordert sie heraus, was ihr verboten wurde, und wünscht sich, lebendig den Zugang zu einer anderen, besseren Welt zu finden. Diese Rebellion gegen das „Verbote“ könnte als Ausdruck eines Verlangens nach Freiheit und einer Weigerung, sich der Schwere des Lebens und der tragischen Verhältnisse zu unterwerfen, verstanden werden.
Zusammenfassend ist „Mein blaues Klavier“ ein Gedicht über den Verlust der kreativen und spirituellen Verbindung, den inneren Verfall und die Sehnsucht nach einer höheren Erlösung. Das Klavier, das einst für Kunst und Schönheit stand, ist jetzt ein Symbol für das, was verloren und unerreichbar geworden ist. Die Dichterin wendet sich an die Engel, um durch ihre Gebete und ihren Wunsch nach Transzendenz zu einer höheren Wahrheit oder einem spirituellen Zustand zu gelangen. Es ist ein Gedicht, das von Trauer, Verlust und der ewigen Suche nach einem Ausweg aus der Dunkelheit spricht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.