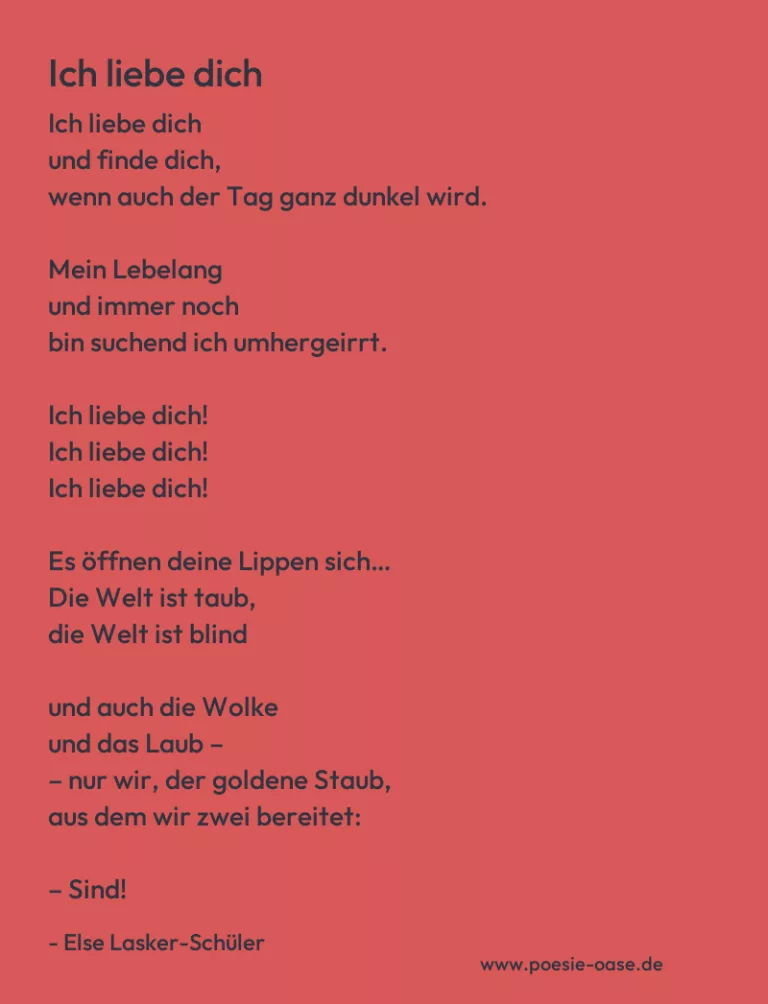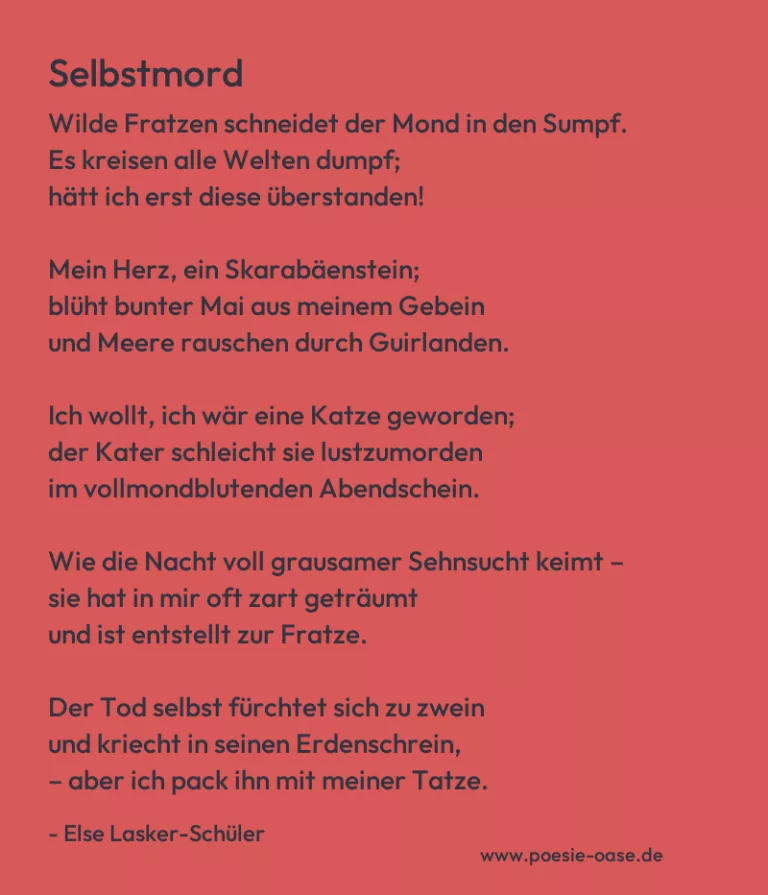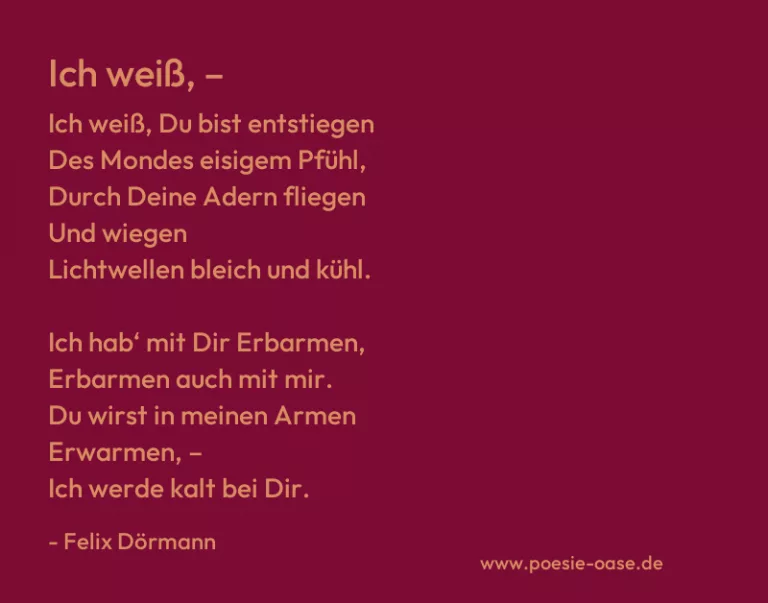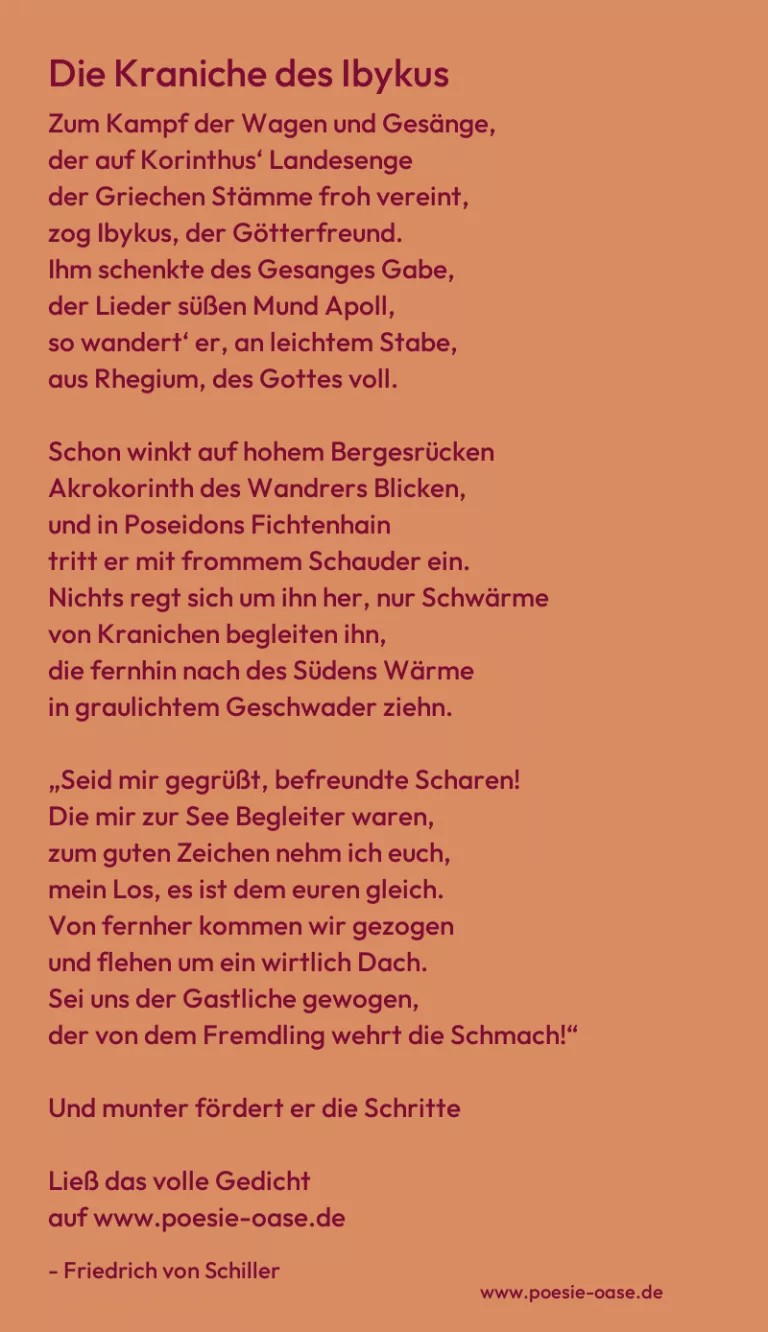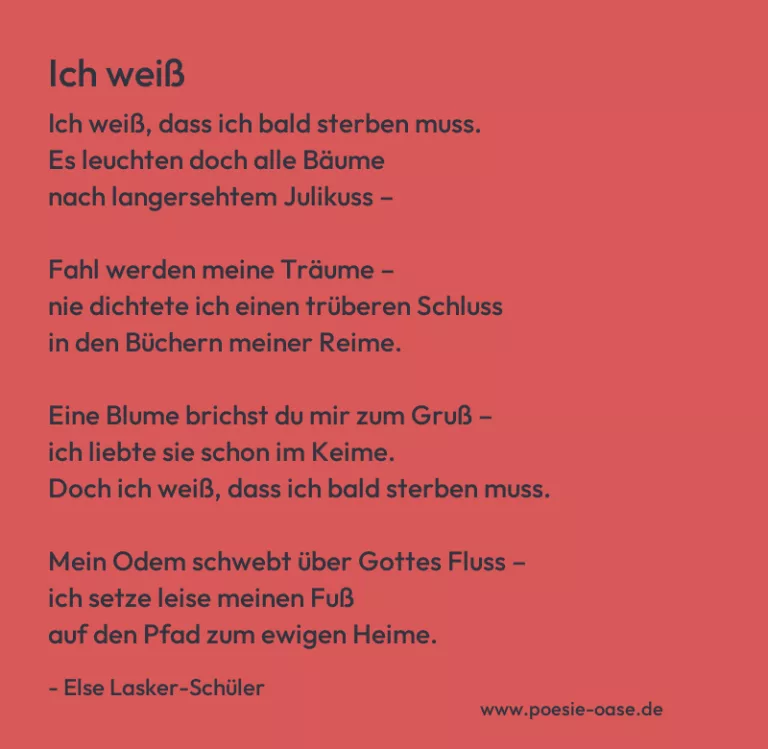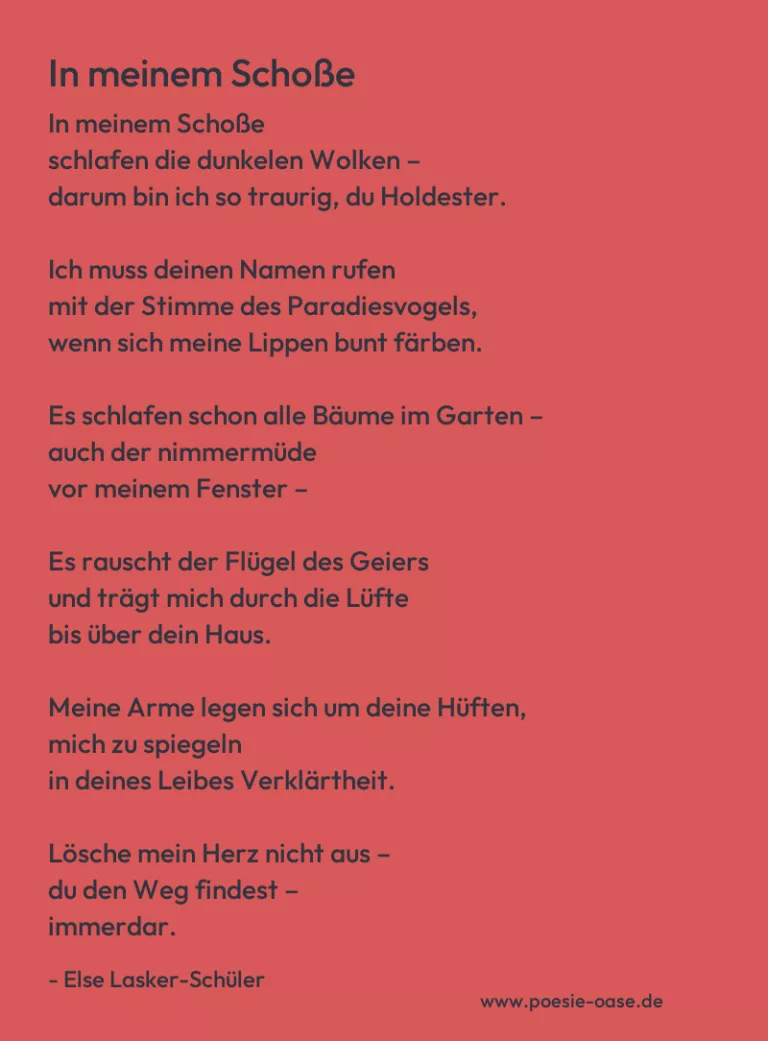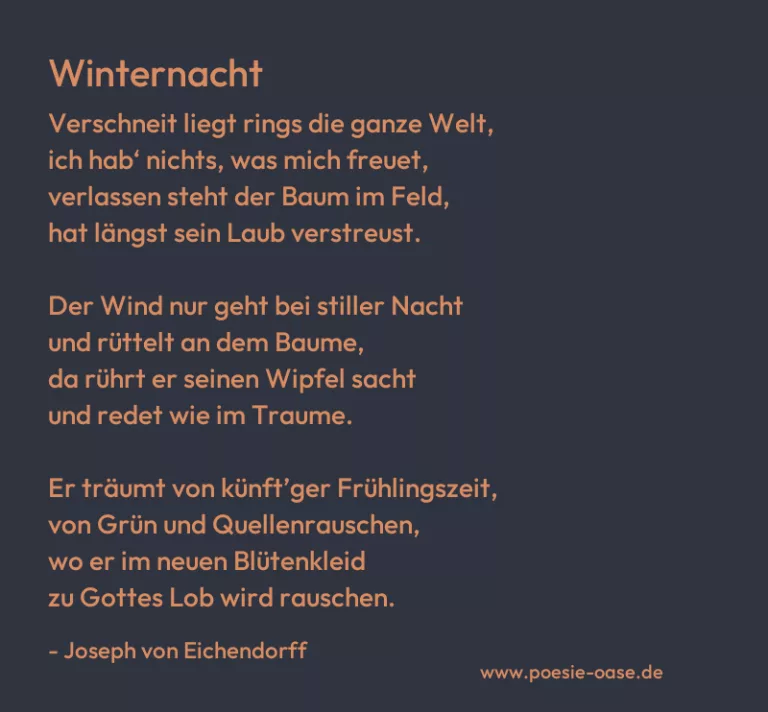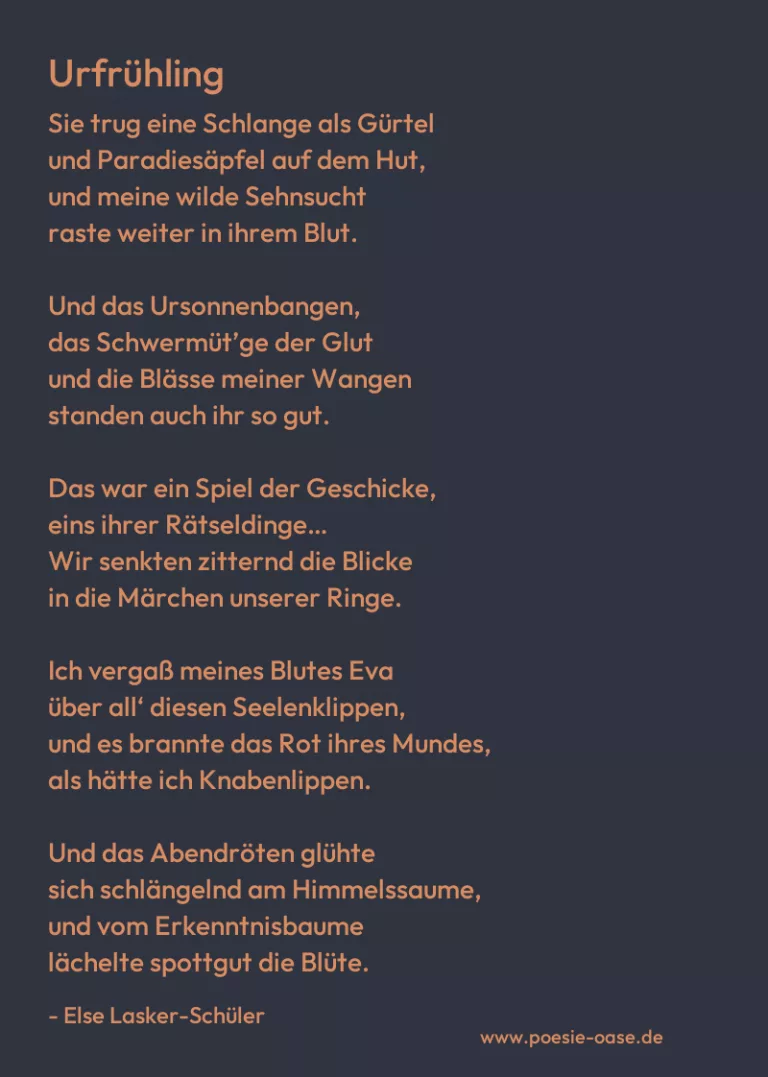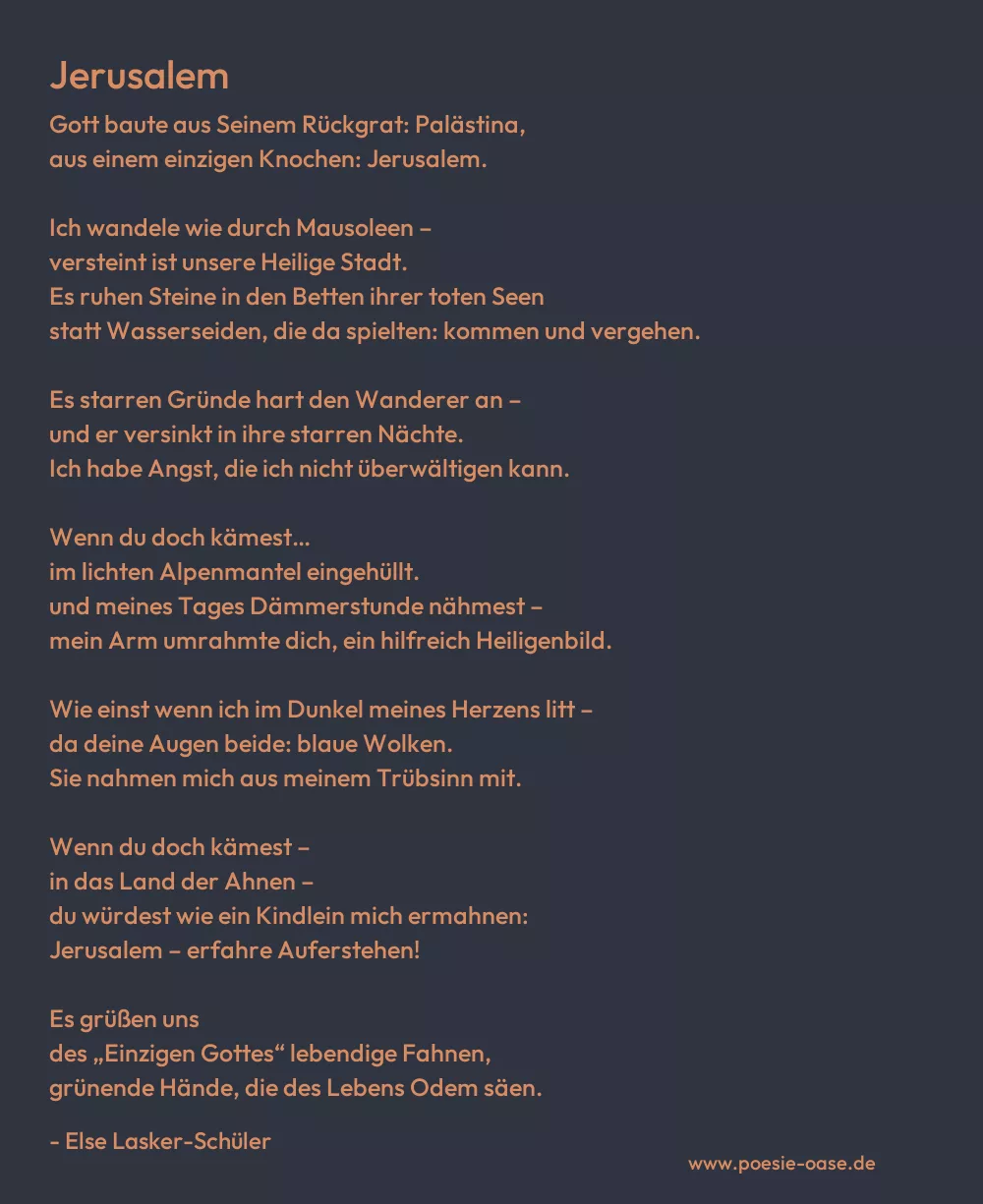Jerusalem
Gott baute aus Seinem Rückgrat: Palästina,
aus einem einzigen Knochen: Jerusalem.
Ich wandele wie durch Mausoleen –
versteint ist unsere Heilige Stadt.
Es ruhen Steine in den Betten ihrer toten Seen
statt Wasserseiden, die da spielten: kommen und vergehen.
Es starren Gründe hart den Wanderer an –
und er versinkt in ihre starren Nächte.
Ich habe Angst, die ich nicht überwältigen kann.
Wenn du doch kämest…
im lichten Alpenmantel eingehüllt.
und meines Tages Dämmerstunde nähmest –
mein Arm umrahmte dich, ein hilfreich Heiligenbild.
Wie einst wenn ich im Dunkel meines Herzens litt –
da deine Augen beide: blaue Wolken.
Sie nahmen mich aus meinem Trübsinn mit.
Wenn du doch kämest –
in das Land der Ahnen –
du würdest wie ein Kindlein mich ermahnen:
Jerusalem – erfahre Auferstehen!
Es grüßen uns
des „Einzigen Gottes“ lebendige Fahnen,
grünende Hände, die des Lebens Odem säen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
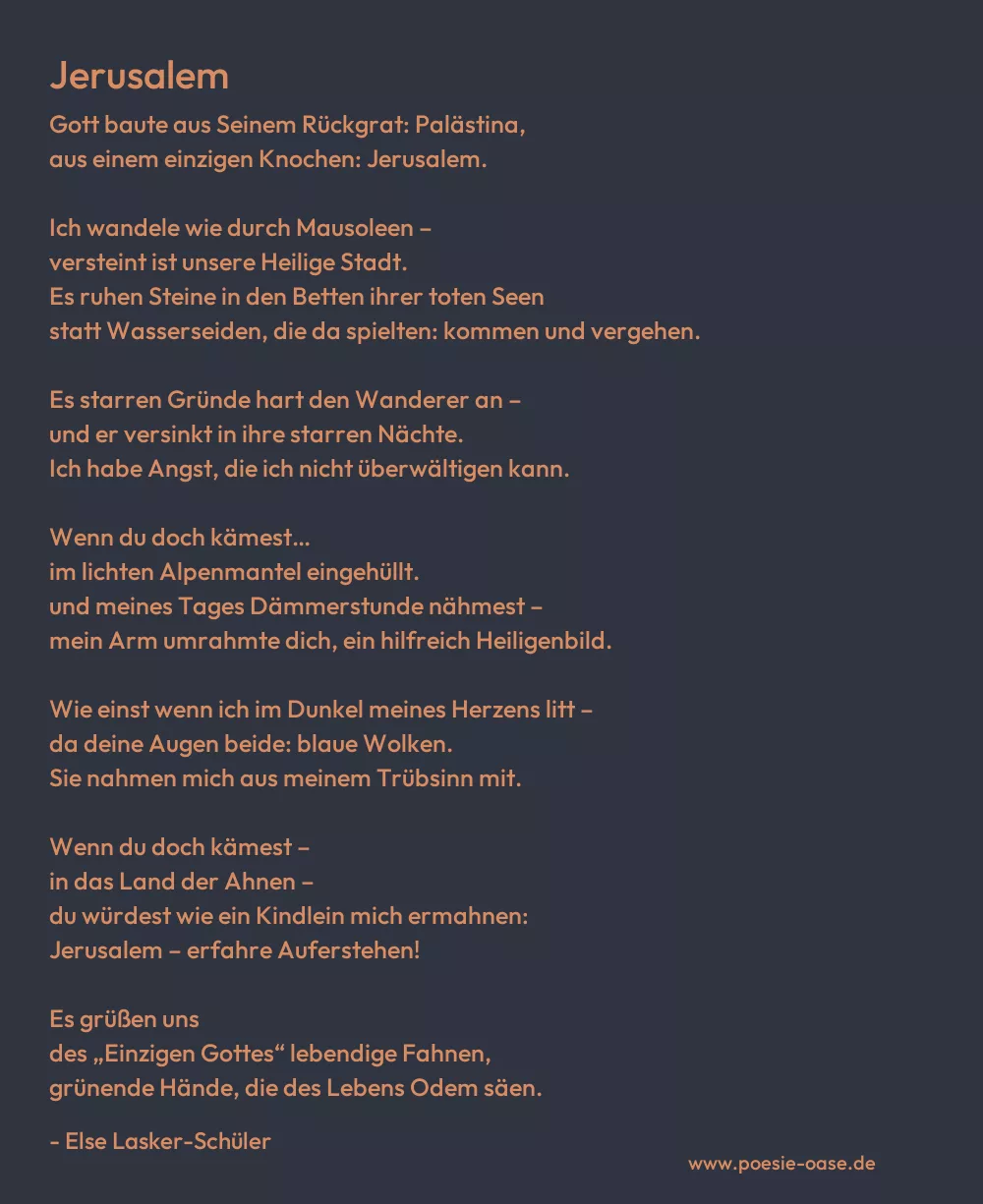
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Jerusalem“ von Else Lasker-Schüler ist eine tief symbolische Auseinandersetzung mit der Heiligen Stadt und ihrer Bedeutung für die Dichterin. Es beschreibt die Stadt Jerusalem als einen Ort der Ruhe und des Verfalls, wo Steine und Tote Seen die Lebendigkeit ersetzen. Diese Darstellung der Stadt als „versteinert“ reflektiert eine tiefe Entfremdung und die Sehnsucht nach einer längst verlorenen spirituellen Erneuerung. Die erste Zeile, in der Jerusalem als Schöpfung Gottes aus einem „einzigen Knochen“ beschrieben wird, stellt die Stadt als etwas Urständiges und zugleich Zerbrechliches dar.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird Jerusalem als ein „Mausoleum“ beschrieben, als ein Ort, der in der Gegenwart des Dichters versteinert und ohne Leben erscheint. Der Kontrast zwischen den „toten Seen“ und den „Wasserseiden“, die früher das Bild von fließendem Leben und Wandel trugen, verstärkt das Gefühl der Stagnation und Trauer. Diese Vision von Jerusalem als einem Ort der toten Natur wird durch die „starren Nächte“ und das Gefühl der Angst weiter betont, das die Dichterin in der Stadt verspürt. Diese Angst steht in enger Verbindung mit einer tiefen inneren Leere und einer Sehnsucht nach Erlösung.
Der zweite Teil des Gedichts richtet sich an eine imaginäre oder göttliche Person, die der Dichterin die Hoffnung auf eine spirituelle Wiederbelebung bringen könnte. Der Wunsch, dass diese Person im „lichten Alpenmantel“ erscheine, wird zu einem symbolischen Ausdruck der Hoffnung auf göttliche Intervention und Heilung. Die Erinnerung an vergangene Zeiten, in denen die Augen dieser Person wie „blaue Wolken“ die Dichterin aus ihrem „Trübsinn“ befreiten, verstärkt die Nostalgie und den Wunsch nach einer Rückkehr zu einer heilen und lebendigen Welt.
Im letzten Abschnitt des Gedichts wird eine starke Verbindung zur jüdischen Tradition und den „Ahnen“ hergestellt. Der Wunsch, dass der Anrufer in das Land der Ahnen käme, trägt sowohl religiöse als auch kulturelle Bedeutung. Die „lebendigen Fahnen“ und die „grünenden Hände“ symbolisieren das Leben und die Hoffnung, die trotz der Schwierigkeiten und des Verfalls immer wieder erneuert werden können. Das Gedicht endet mit einem Aufruf zur Auferstehung Jerusalems, was die übergreifende Thematik von Tod und Wiedergeburt sowie von Verfall und Erneuerung aufgreift.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.