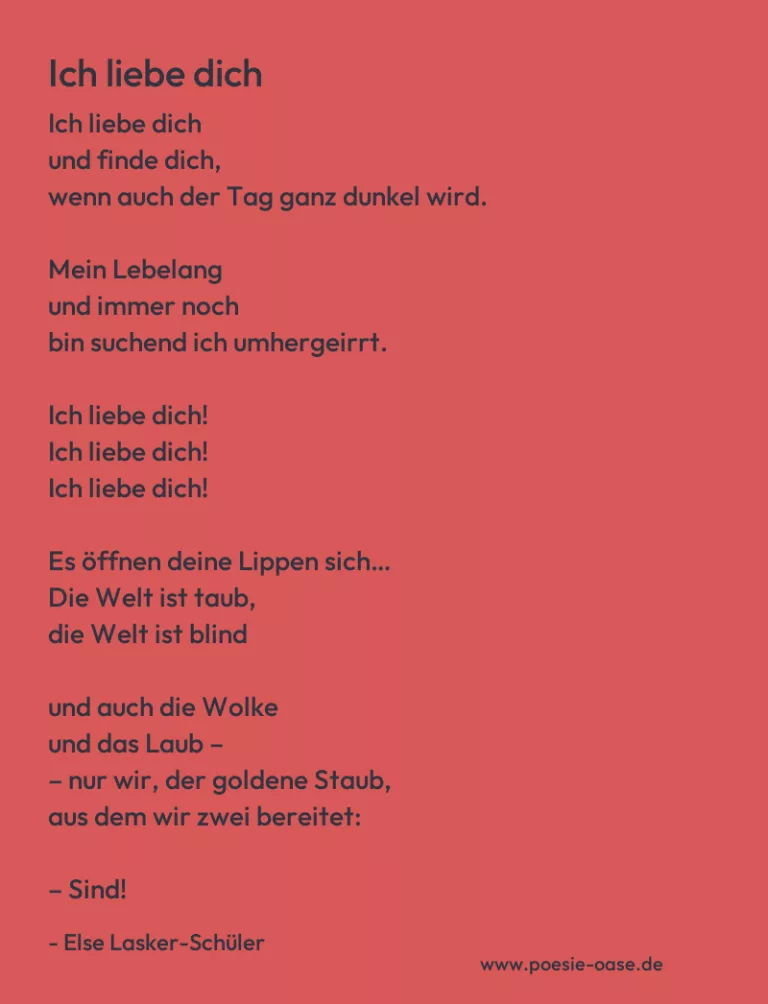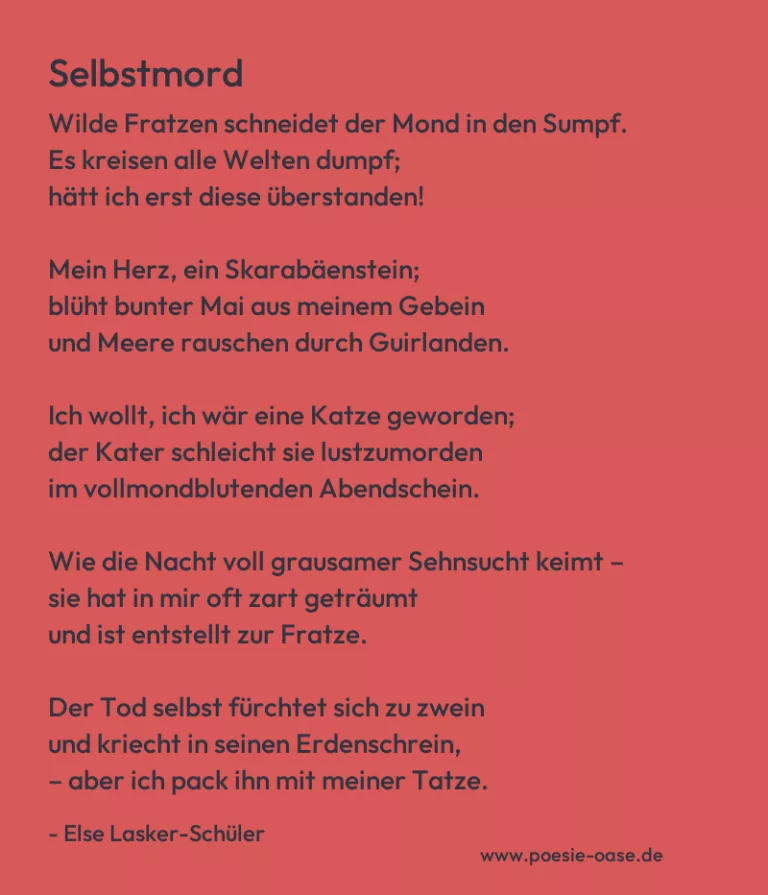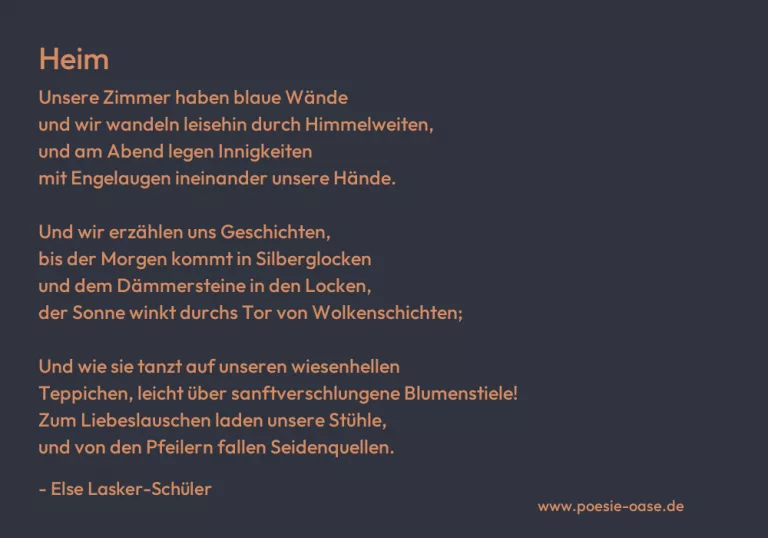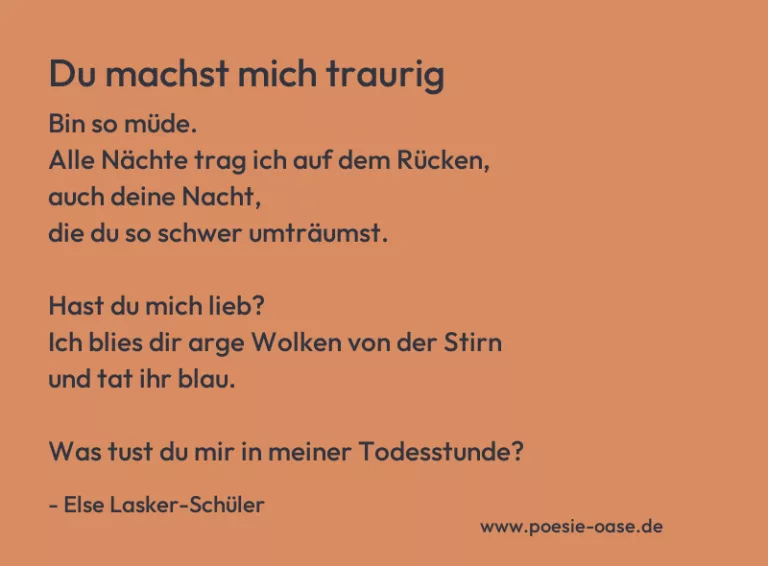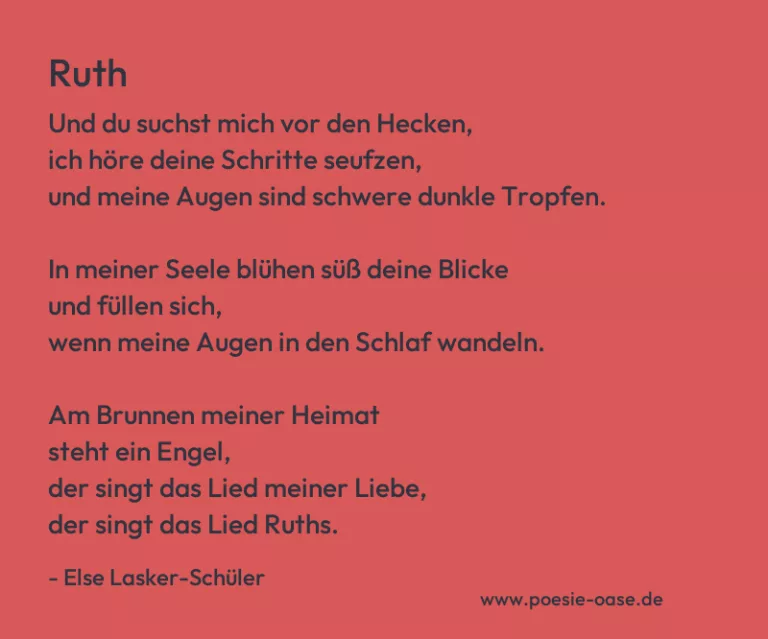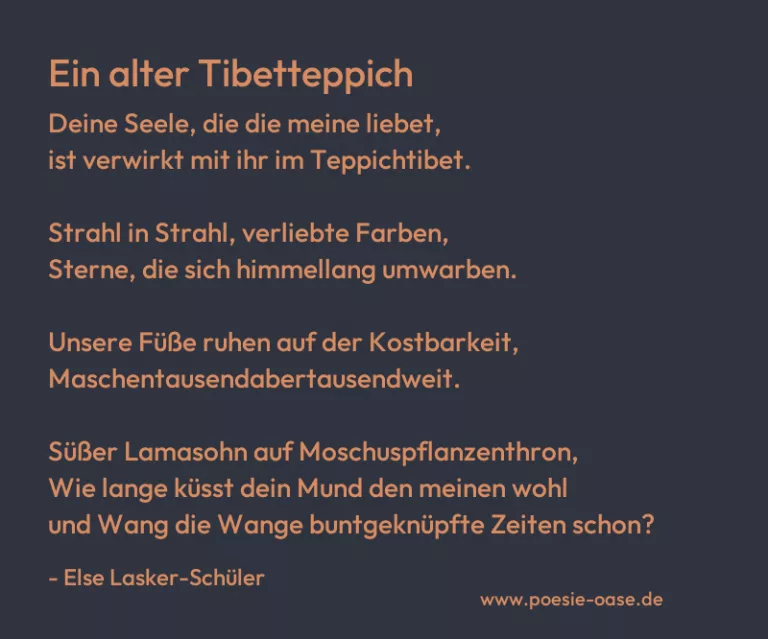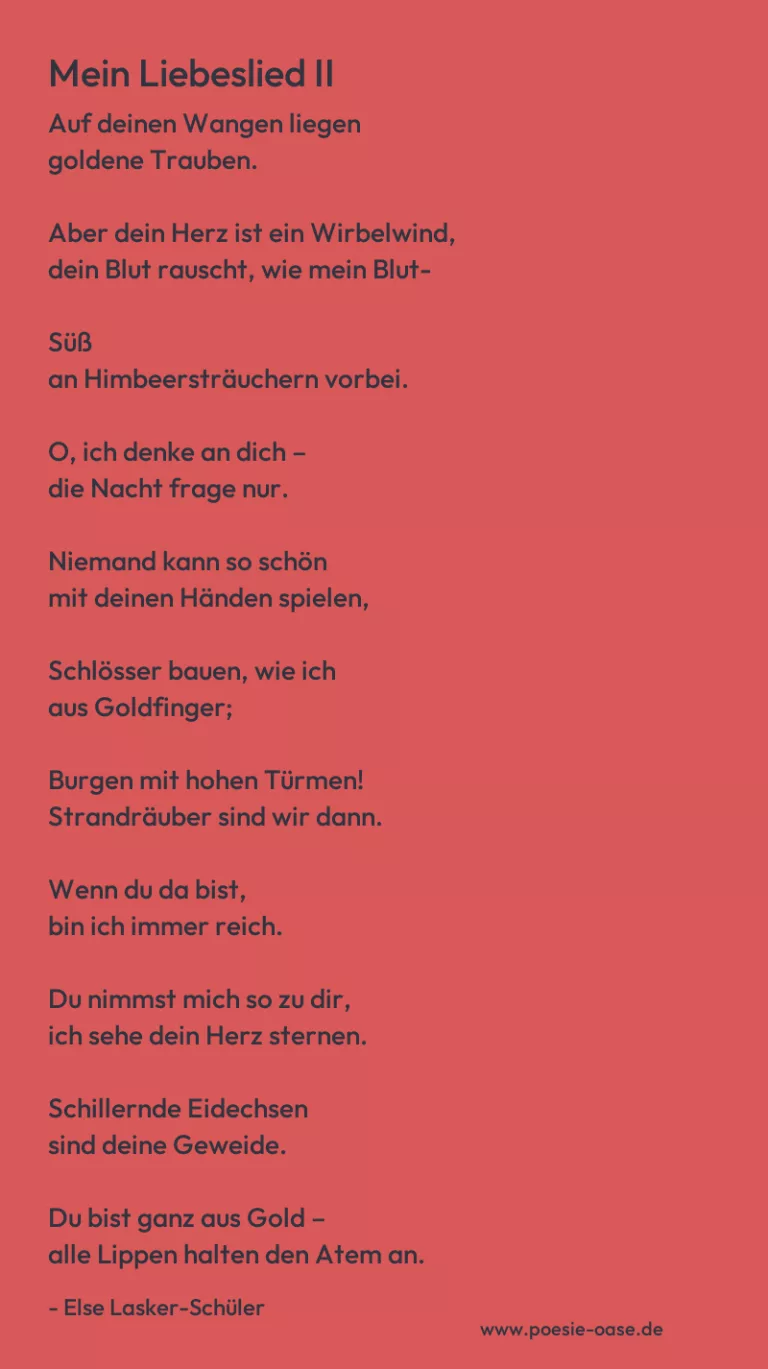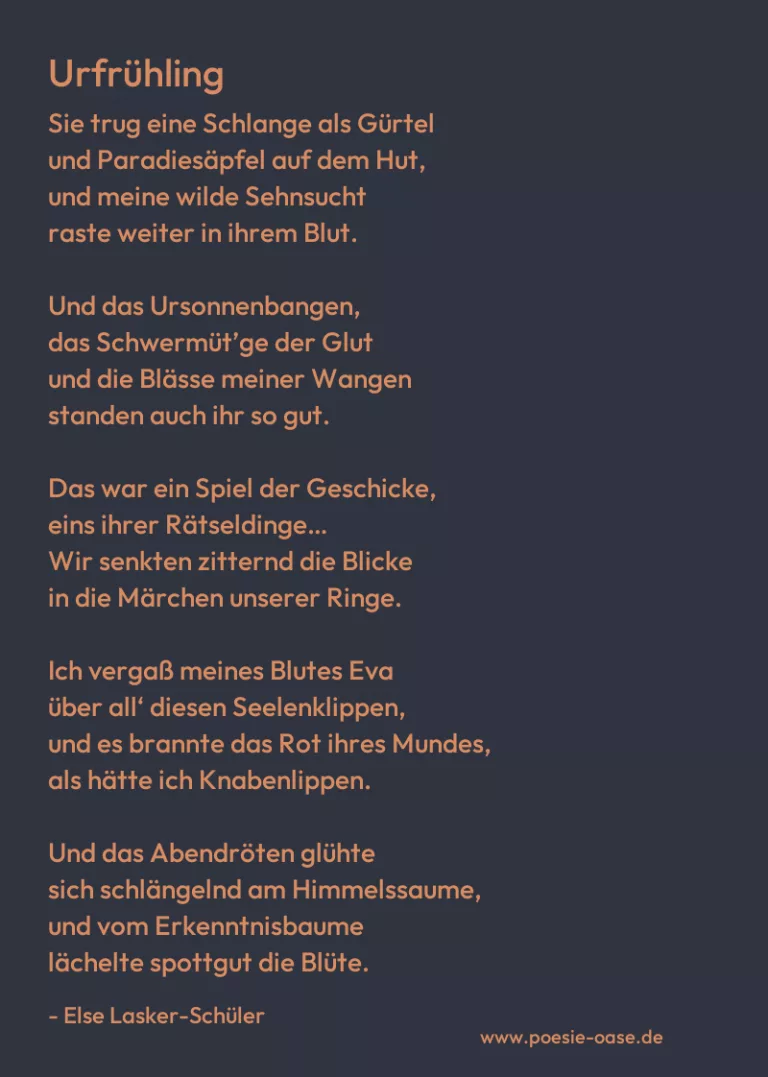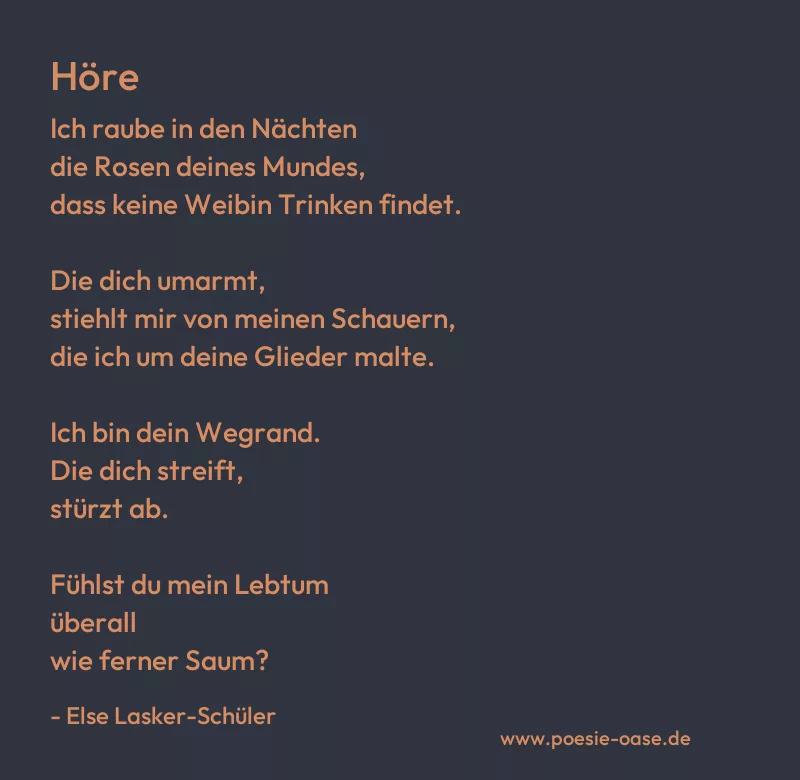Höre
Ich raube in den Nächten
die Rosen deines Mundes,
dass keine Weibin Trinken findet.
Die dich umarmt,
stiehlt mir von meinen Schauern,
die ich um deine Glieder malte.
Ich bin dein Wegrand.
Die dich streift,
stürzt ab.
Fühlst du mein Lebtum
überall
wie ferner Saum?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
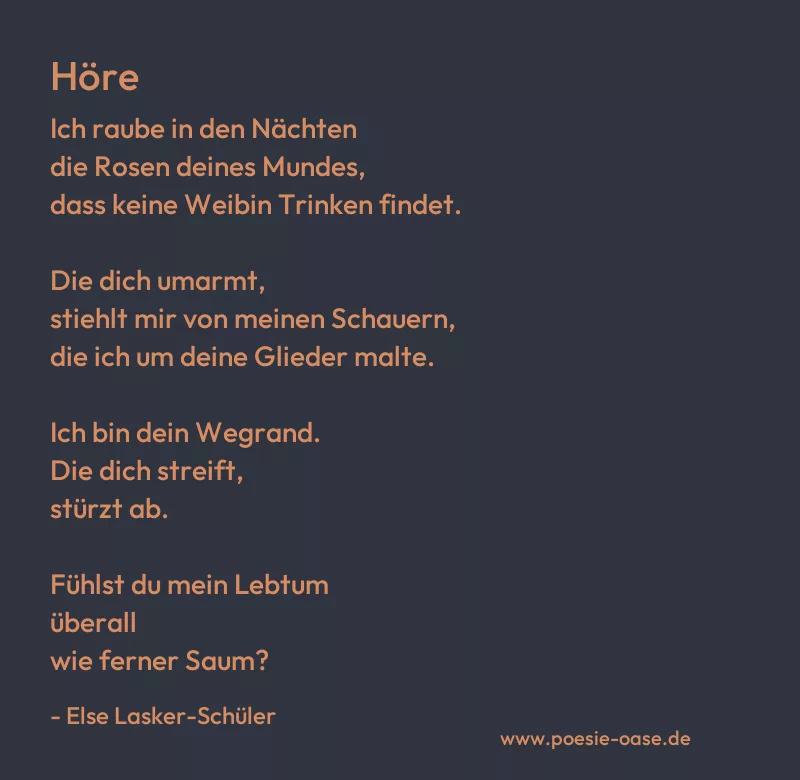
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Höre“ von Else Lasker-Schüler ist von intensiven, fast schmerzhaften Gefühlen der Eifersucht, des Besitzes und der Sehnsucht geprägt. In der ersten Strophe spricht der lyrische Sprecher von einer tiefen, vielleicht zerstörerischen Liebe, die mit dem Bild des „Raubens“ verbunden wird. Der Sprecher „raubt in den Nächten die Rosen deines Mundes“, was die Vorstellung von Liebe als Besitz und das Bedürfnis, den Geliebten für sich allein zu haben, verstärkt. Die „Rosen“ sind ein klassisches Symbol für Liebe, aber in diesem Zusammenhang steht der „Raub“ für eine unaufhörliche und aggressive Gier nach der Zuneigung des anderen, die keine andere „Weibin“ (Frau) finden lassen soll.
In der zweiten Strophe wird die Beziehung des lyrischen Ichs zu seinem Geliebten noch verzweifelter dargestellt. Die „Weibin“, die den Geliebten umarmt, stiehlt „vom Schauern“ des Sprechers, das er „um deine Glieder malte“. Das „Schauern“ kann als Ausdruck von Angst, Verlangen und Erschütterung verstanden werden, die der Sprecher für den Geliebten empfindet. Diese „Glieder“ sind sowohl ein Bild für körperliche Nähe als auch für die seelische Bindung. Das Bild des „Stehlens“ deutet auf die Besorgnis hin, dass eine andere Person etwas von dieser Leidenschaft und Nähe wegnehmen könnte.
In der dritten Strophe kommt der Sprecher zu einer düsteren Selbstdarstellung: „Ich bin dein Wegrand.“ Dies kann als Symbol für den Zustand des Verlassens oder der Verdrängung verstanden werden. Der Sprecher ist nicht die zentrale Person im Leben des Geliebten, sondern nur der „Wegrand“, der keine Bedeutung hat. Wer „dich streift“, stürzt ab, was eine dramatische Metapher für das Scheitern oder die Zerstörung durch den Verlust oder die Ablehnung des Geliebten darstellt. Der Wegrand, der der Geliebte überquert, wird zur Falle, aus der es kein Entkommen gibt.
In der letzten Strophe spricht der Sprecher von seinem „Lebtum“, das überall zu spüren ist – möglicherweise eine Metapher für das eigene Leben und die ständige Präsenz, die der Sprecher trotz der Ablehnung und des schmerzlichen Verlangens immer noch empfindet. Das „ferne Saum“ könnte auf eine unerreichbare, vielleicht vergangene Nähe hinweisen, die der Sprecher vermisst. Diese Zeilen verstärken das Gefühl der Vergeblichkeit und der unerwiderten Sehnsucht, die das gesamte Gedicht durchzieht.
„Höre“ ist ein Gedicht, das von der Intensität der Eifersucht, der Besessenheit und der zerbrochenen Liebe spricht. Es vermittelt eine dunkle, fast quälende Vision von Liebe als einer Kraft, die den Sprecher sowohl erfüllt als auch zerstört. Die Bilder von Raub, Diebstahl und Sturz verdeutlichen das verzweifelte Verlangen nach Nähe und Kontrolle, das im Widerstand des Geliebten gipfelt und den Sprecher in einen Zustand des emotionalen Schmerzes stürzt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.