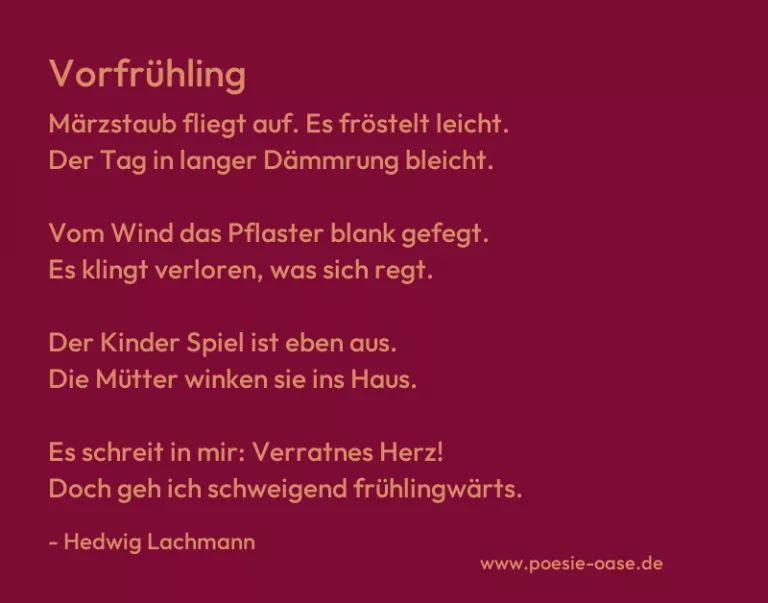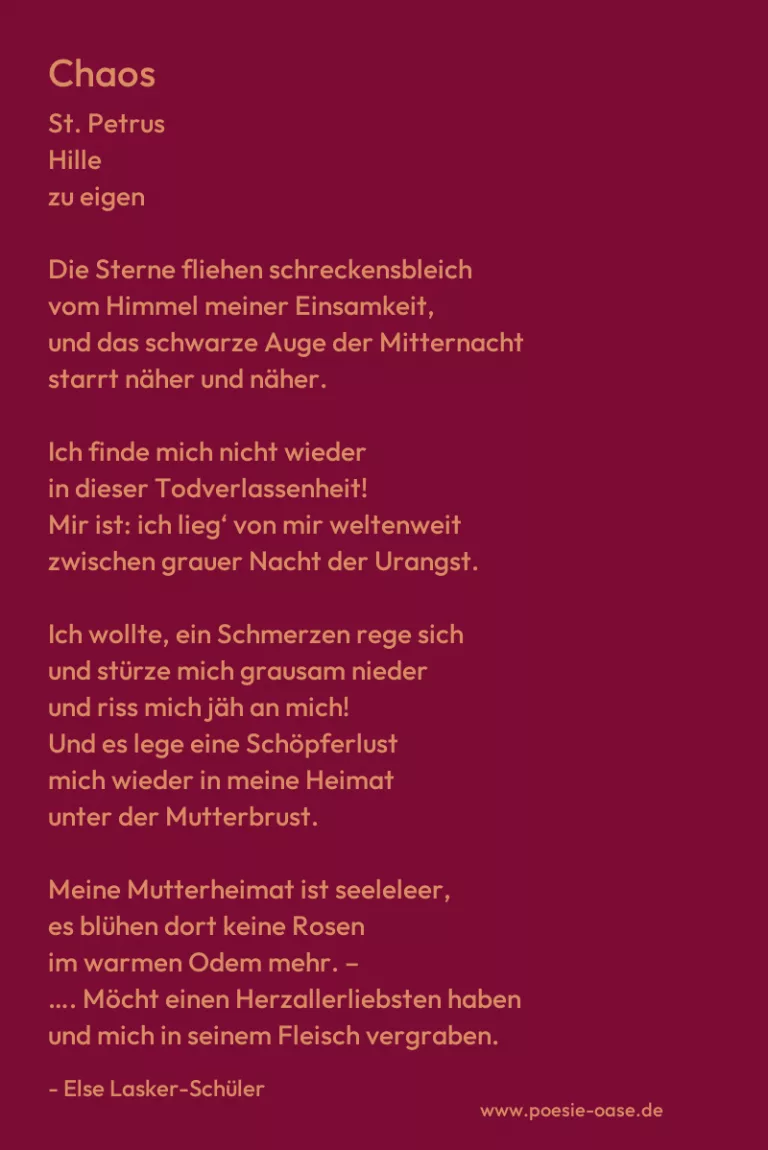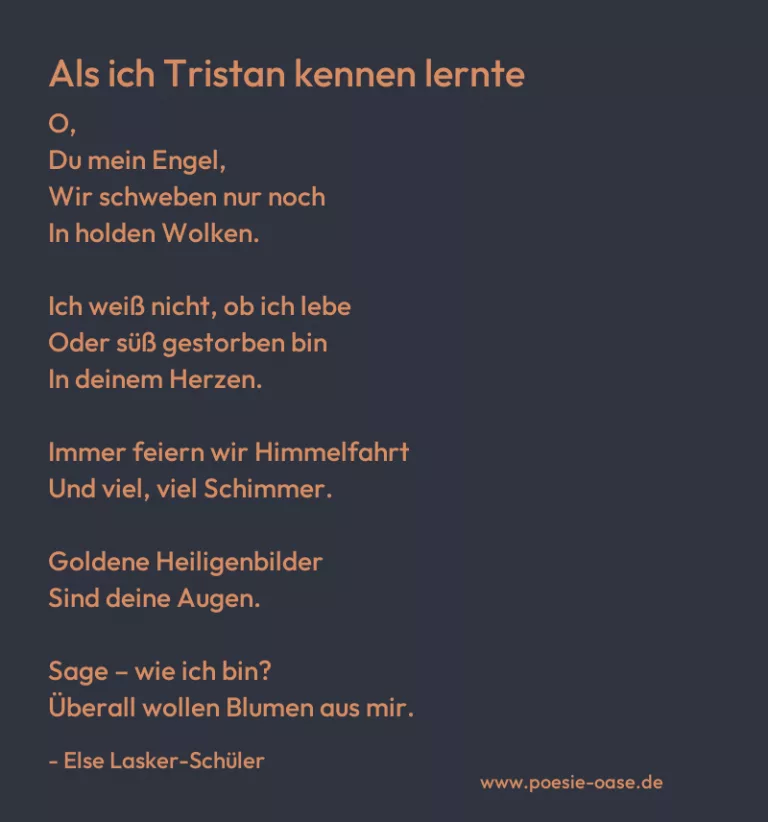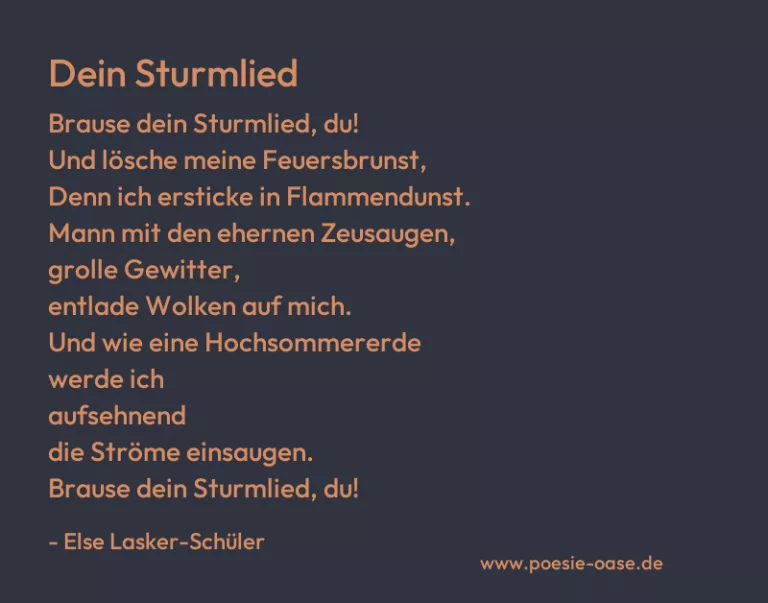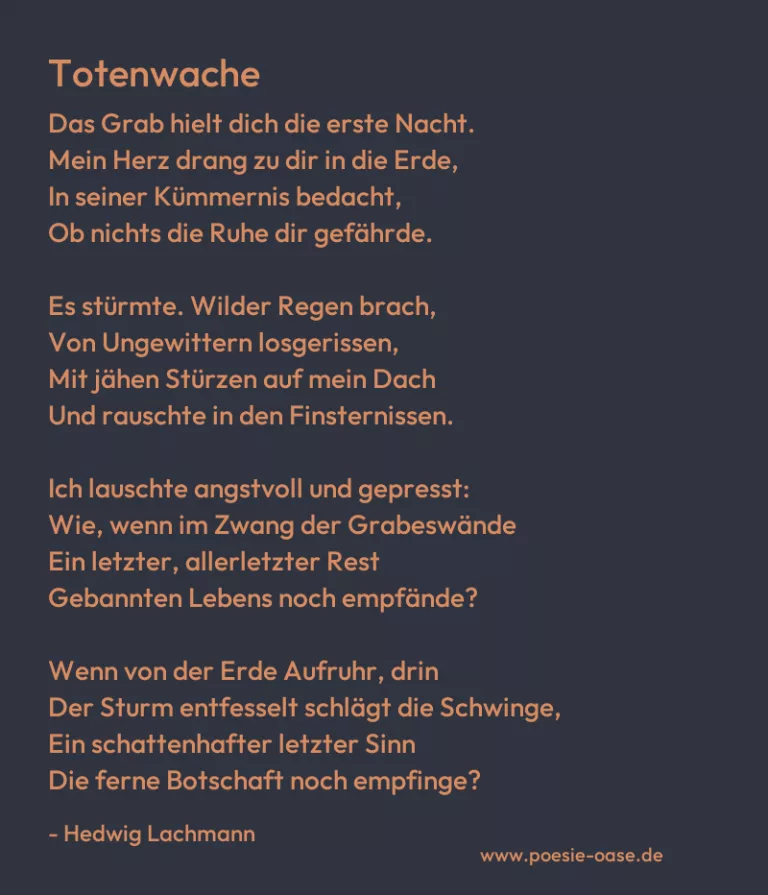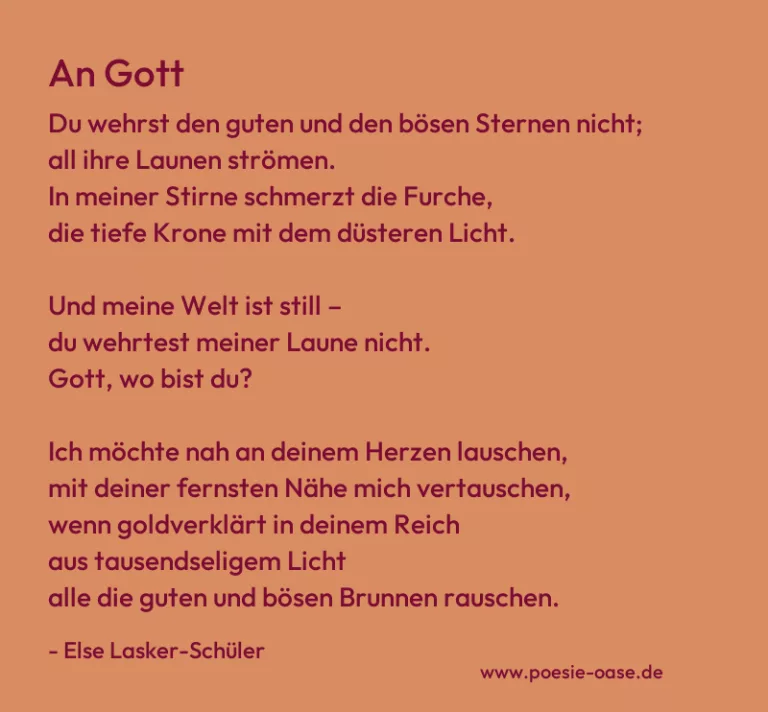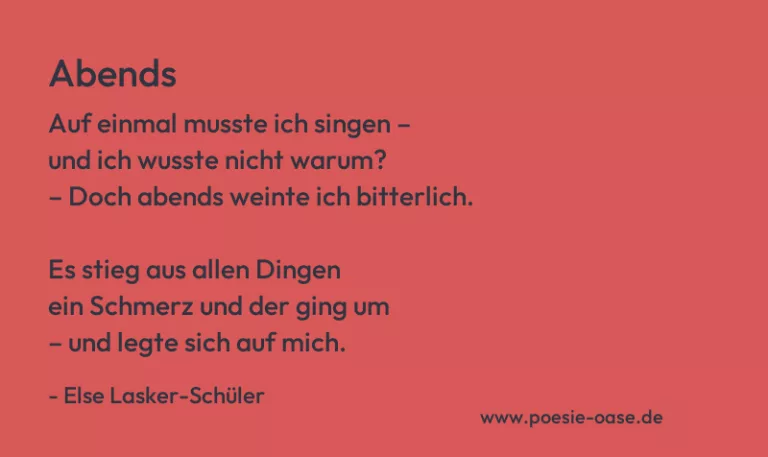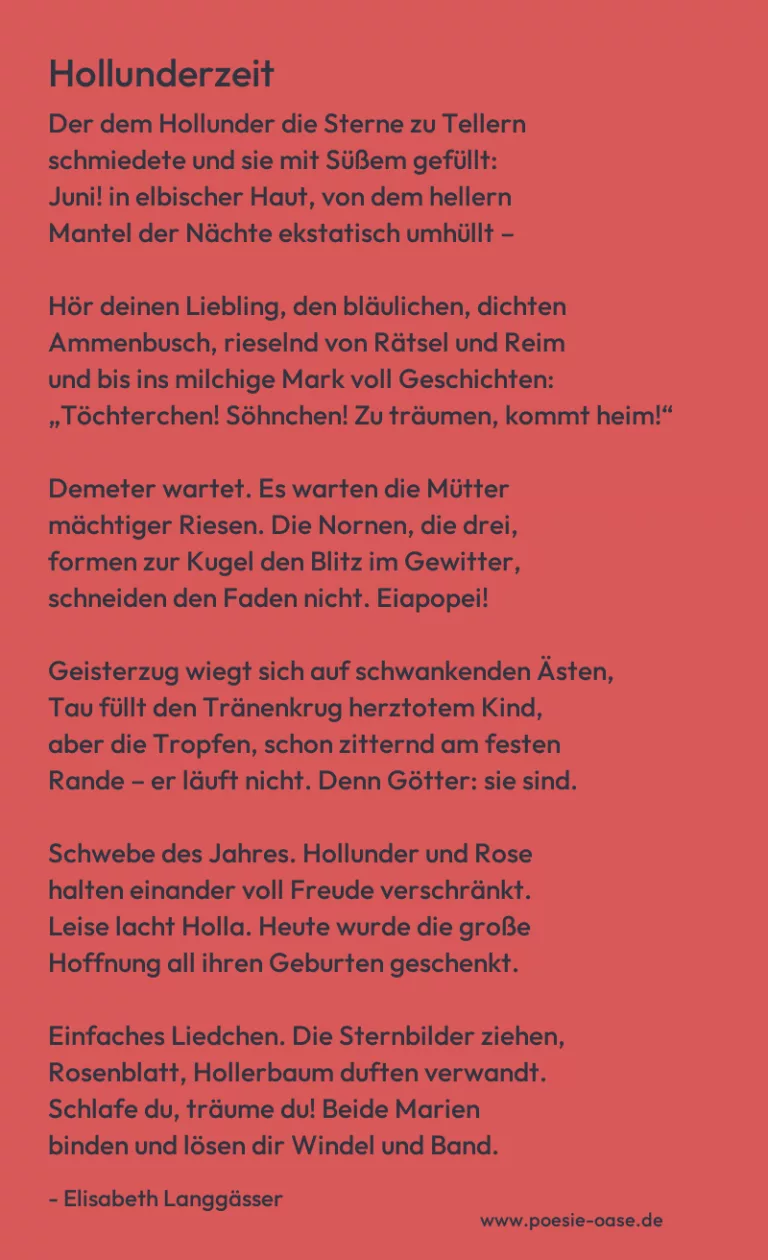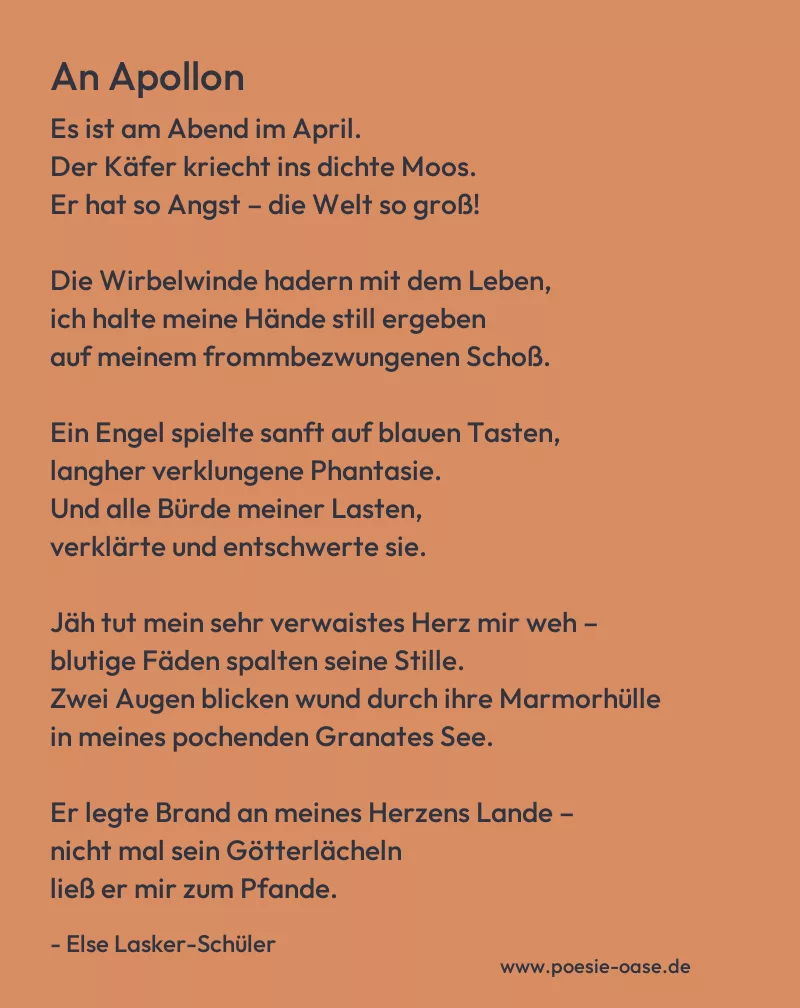An Apollon
Es ist am Abend im April.
Der Käfer kriecht ins dichte Moos.
Er hat so Angst – die Welt so groß!
Die Wirbelwinde hadern mit dem Leben,
ich halte meine Hände still ergeben
auf meinem frommbezwungenen Schoß.
Ein Engel spielte sanft auf blauen Tasten,
langher verklungene Phantasie.
Und alle Bürde meiner Lasten,
verklärte und entschwerte sie.
Jäh tut mein sehr verwaistes Herz mir weh –
blutige Fäden spalten seine Stille.
Zwei Augen blicken wund durch ihre Marmorhülle
in meines pochenden Granates See.
Er legte Brand an meines Herzens Lande –
nicht mal sein Götterlächeln
ließ er mir zum Pfande.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
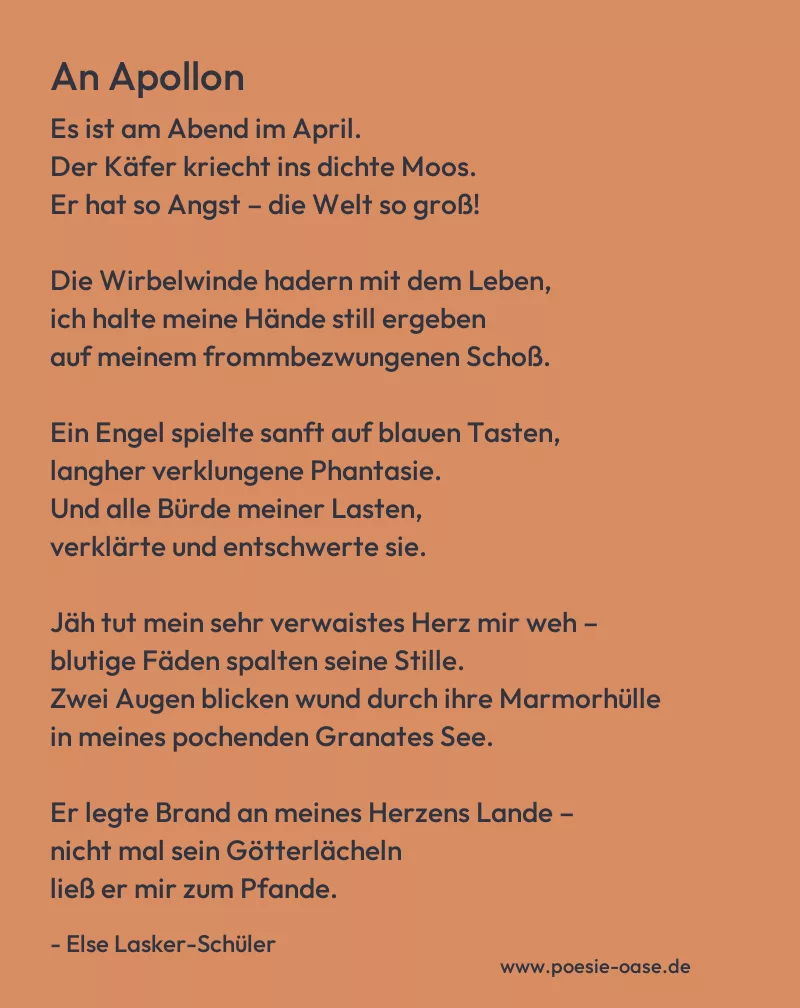
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Apollon“ von Else Lasker-Schüler ist von intensiven Gefühlen und einer tiefen Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Welt geprägt. Zu Beginn wird eine friedliche, beinahe melancholische Szenerie beschrieben: Es ist Abend im April, und ein Käfer kriecht ins „dichte Moos“. Dieses Bild von der kleinen Kreatur, die sich in einer großen, bedrohlichen Welt verirrt, wird zu einem Symbol für das Gefühl der Ohnmacht und der Angst des lyrischen Ichs. Der Käfer steht hier für das verletzliche Wesen des Menschen, das sich in der Weite und Komplexität der Welt verloren fühlt.
In der nächsten Strophe wird eine Szene von innerer Ruhe und Resignation beschrieben, als das lyrische Ich die „Hände still ergeben auf meinem frommbezwungenen Schoß“ hält. Die „Wirbelwinde“, die mit dem Leben hadern, symbolisieren den inneren Konflikt und die äußeren Herausforderungen, denen sich die Person stellen muss. Doch in der Ruhe der Haltung wird eine gewisse Akzeptanz und Selbstbeherrschung offenbar, eine „frommbezwungene“ Haltung, die die inneren Kämpfe mit Geduld und Bescheidenheit begegnet.
Der Abschnitt, in dem ein Engel auf „blauen Tasten“ spielt, verweist auf eine ätherische, fast himmlische Dimension. Die „langher verklungene Phantasie“ lässt eine entfernte, träumerische Erinnerung an frühere Ideale und Hoffnungen aufleben. Die Musik, die der Engel spielt, hat die Fähigkeit, die Lasten des lyrischen Ichs zu „verklären“ und zu „entschweren“, was auf eine Art von emotionaler Befreiung hinweist – der Trost, den diese imaginäre Musik schenkt, lässt das Ich die Belastungen des Lebens für einen Moment vergessen.
Im darauffolgenden Abschnitt wechselt der Ton dramatisch: Das „verwaiste Herz“ tut plötzlich „weh“, und „blutige Fäden“ spalten die „Stille“ des Herzens. Diese plötzliche Wendung von Ruhe zu Schmerz verdeutlicht eine tiefe innere Zerrissenheit. Das Bild des Herzens, das in schmerzhaften „blutigen Fäden“ reißt, ist ein starkes Symbol für den emotionalen Schmerz, der das lyrische Ich überkommt. Die „wunden Augen“, die durch ihre „Marmorhülle“ blicken, könnten auf eine Person hinweisen, die vom lyrischen Ich als unnahbar und gleichzeitig verletzlich wahrgenommen wird, wobei die „Marmorhülle“ sowohl eine harte, unerreichbare Außenseite als auch eine innere Zerrissenheit symbolisiert.
Der abschließende Vers verstärkt die Konfrontation mit einer unbarmherzigen Liebe oder einem Verlust. „Er legte Brand an meines Herzens Lande“ deutet auf eine zerstörerische Kraft hin, die das Herz des lyrischen Ichs entzweite, ohne ihm irgendeine Form von Erlösung oder Trost zu lassen. Das „Götterlächeln“, das dem lyrischen Ich „nicht mal zum Pfande“ gelassen wurde, zeigt die Entfremdung und den Verlust von Hoffnung. Die Figur des Apollon, der in der griechischen Mythologie für Licht, Musik und Prophezeiung steht, erscheint hier als eine Quelle von Schmerz und Verlassenheit, die das lyrische Ich vergeblich zu erreichen versucht.
Insgesamt lässt sich das Gedicht als ein Ausdruck von Sehnsucht, innerem Schmerz und der Unerreichbarkeit von Trost und Heilung deuten. Lasker-Schüler verbindet in „An Apollon“ religiöse, mythologische und persönliche Elemente zu einer kraftvollen Meditation über Verlust, Liebe und die Zerrissenheit des Menschen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.