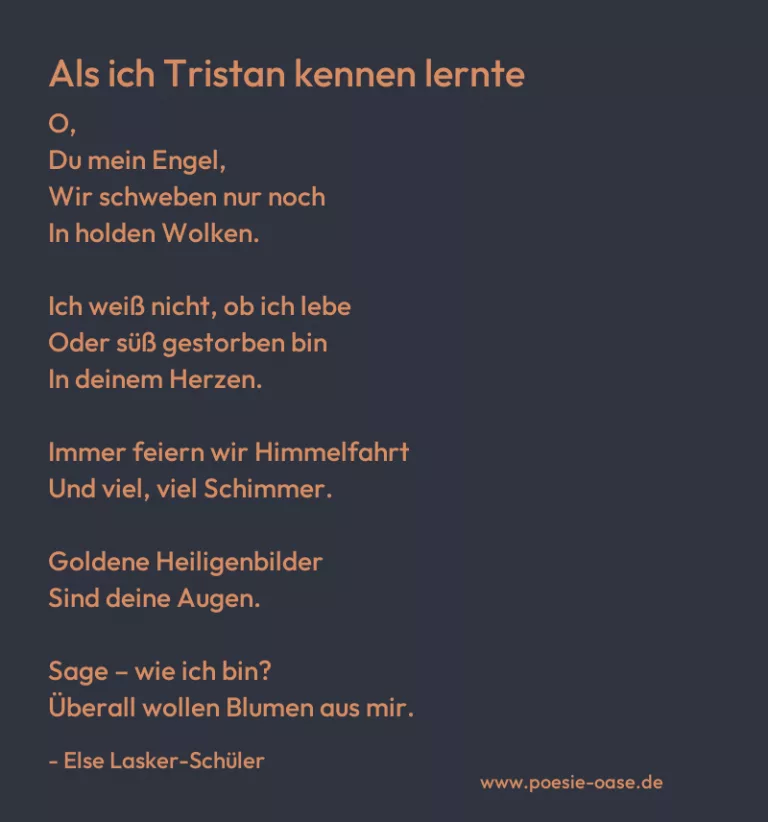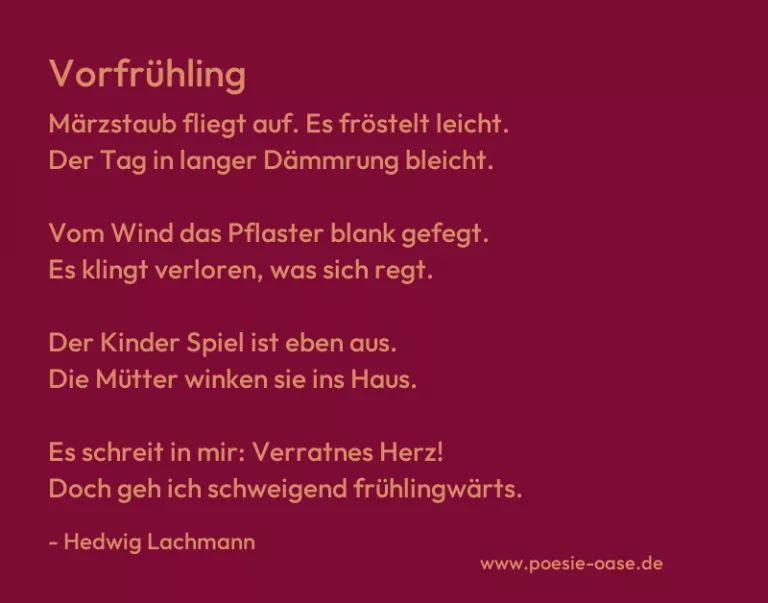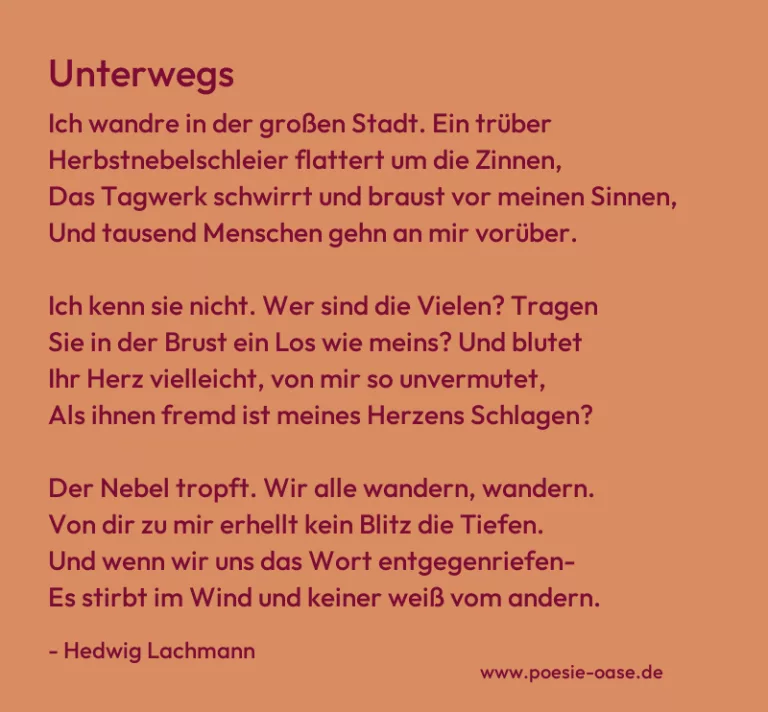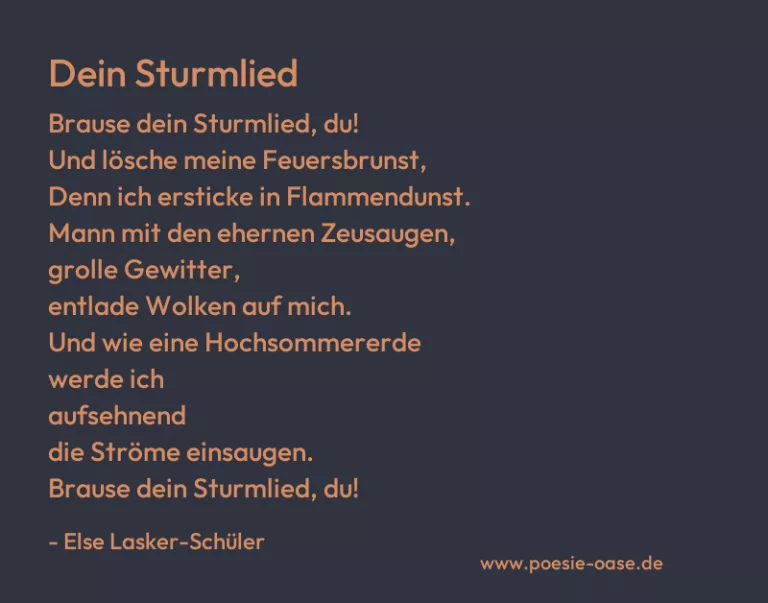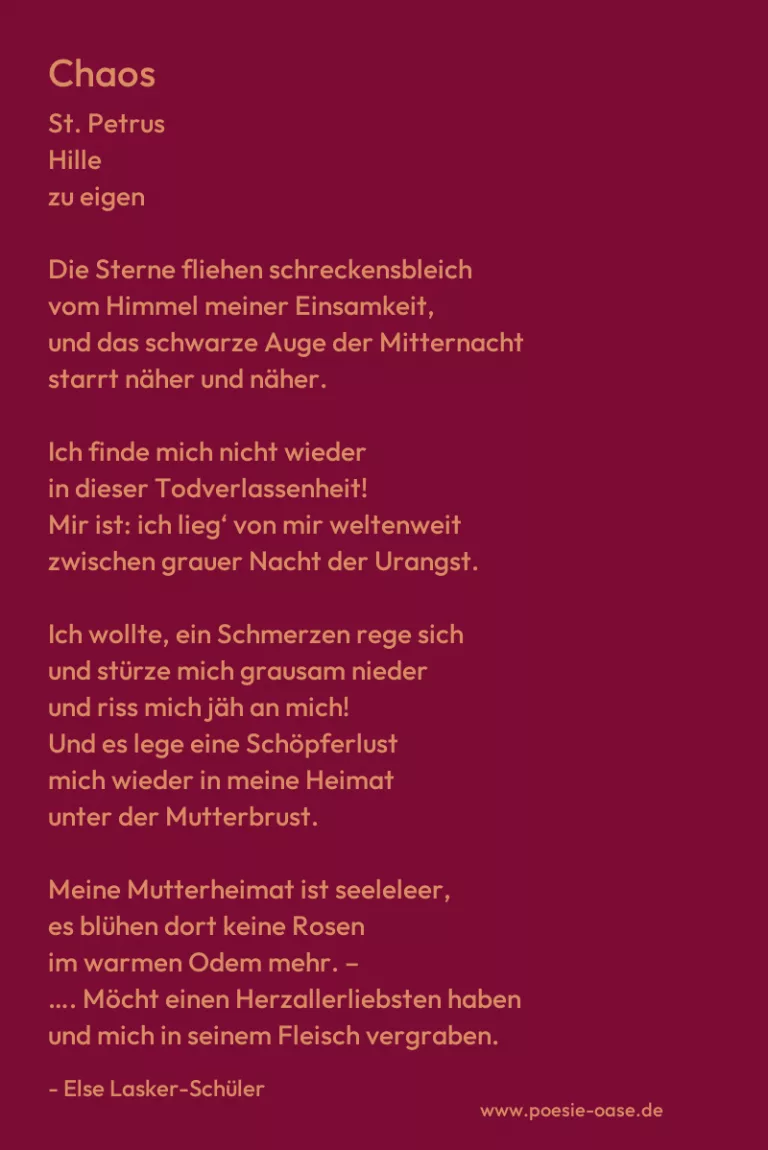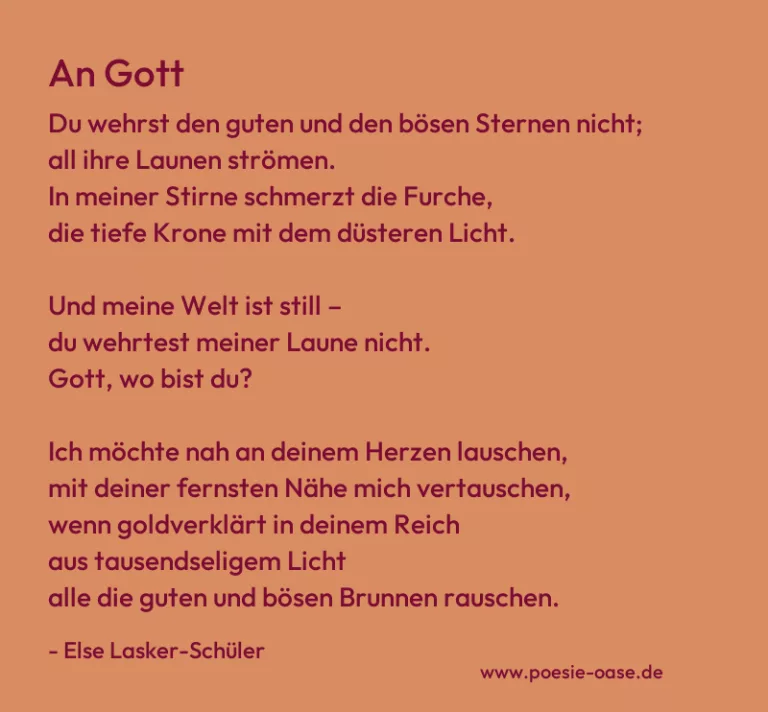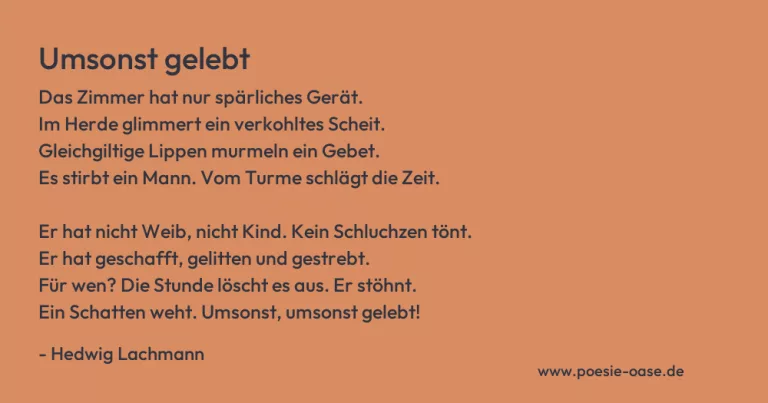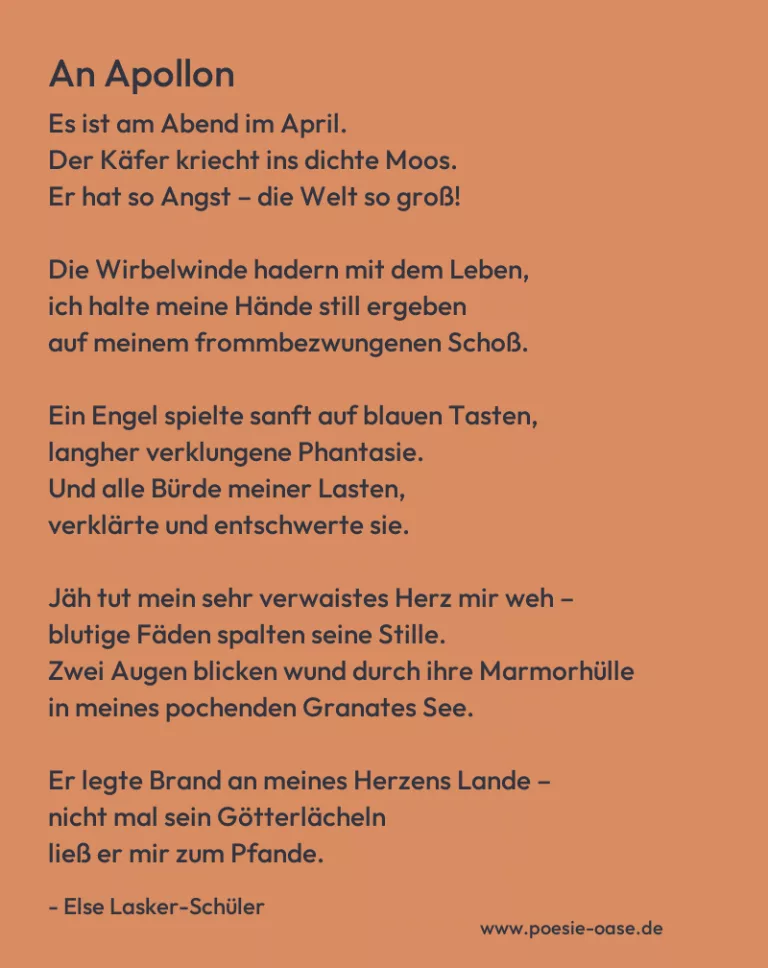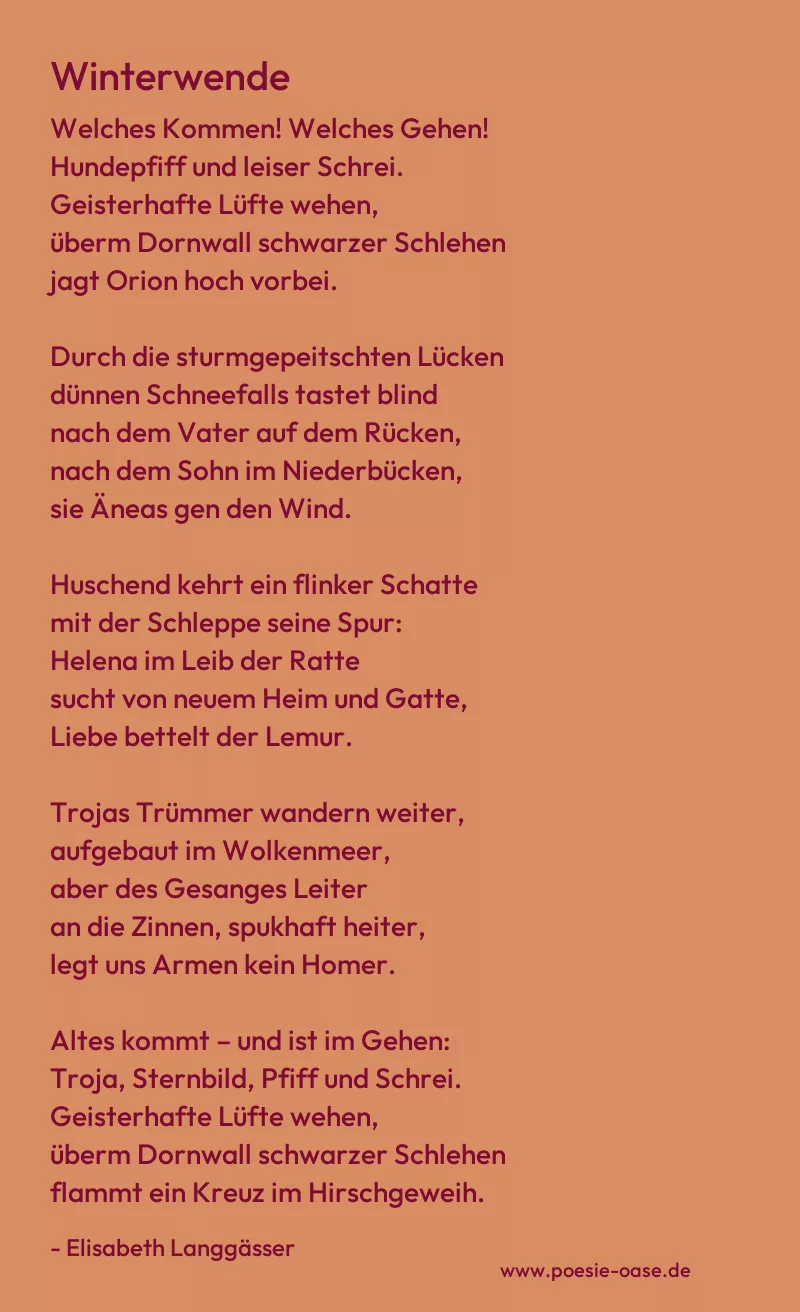Winterwende
Welches Kommen! Welches Gehen!
Hundepfiff und leiser Schrei.
Geisterhafte Lüfte wehen,
überm Dornwall schwarzer Schlehen
jagt Orion hoch vorbei.
Durch die sturmgepeitschten Lücken
dünnen Schneefalls tastet blind
nach dem Vater auf dem Rücken,
nach dem Sohn im Niederbücken,
sie Äneas gen den Wind.
Huschend kehrt ein flinker Schatte
mit der Schleppe seine Spur:
Helena im Leib der Ratte
sucht von neuem Heim und Gatte,
Liebe bettelt der Lemur.
Trojas Trümmer wandern weiter,
aufgebaut im Wolkenmeer,
aber des Gesanges Leiter
an die Zinnen, spukhaft heiter,
legt uns Armen kein Homer.
Altes kommt – und ist im Gehen:
Troja, Sternbild, Pfiff und Schrei.
Geisterhafte Lüfte wehen,
überm Dornwall schwarzer Schlehen
flammt ein Kreuz im Hirschgeweih.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
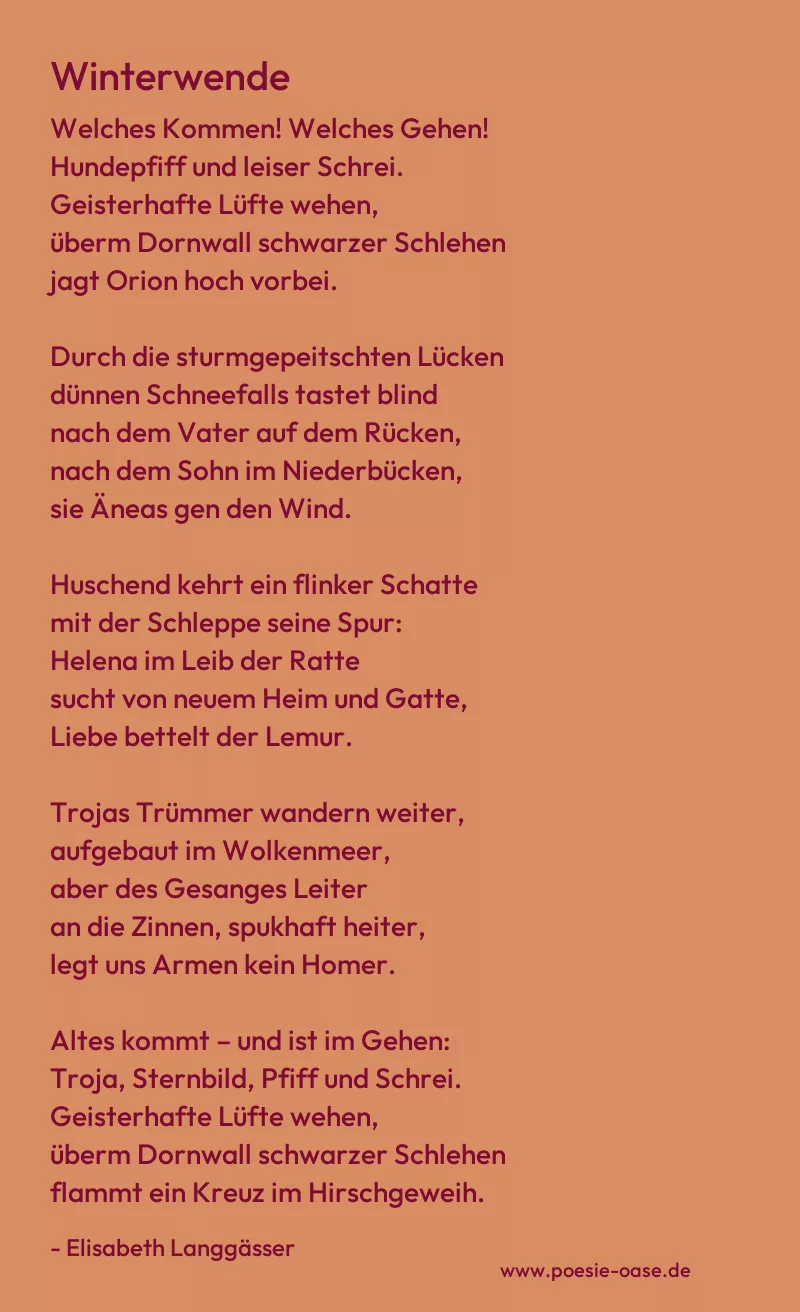
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Winterwende“ von Elisabeth Langgässer ist eine dichte, vielschichtige Meditation über Übergänge – zwischen Jahreszeiten, Epochen, Mythen und geistigen Zuständen. Es verwebt antike, christliche und naturnahe Motive zu einer düster-poetischen Landschaft, in der das Kommen und Gehen zugleich stattfindet. Der Titel verweist auf die Wintersonnenwende, einen Moment der Umkehr, der sowohl mit Tod als auch mit Hoffnung auf Wiederkehr verbunden ist.
Die erste Strophe eröffnet mit einem bewegten Wechselspiel: „Welches Kommen! Welches Gehen!“ – ein Ruf, der Übergang, Aufbruch und Verfall zugleich betont. Der Hundepfiff, der leise Schrei und die „geisterhaften Lüfte“ erzeugen eine gespenstische Atmosphäre. Die Natur erscheint nicht friedlich, sondern aufgewühlt. Das Sternbild Orion, Sinnbild für den Jäger und Krieger, jagt über den nächtlichen Himmel – ein Verweis auf das Mythische, das über die Menschen hinwegzieht.
Die zweite Strophe greift die antike Figur des Äneas auf, der den Vater auf dem Rücken und den Sohn an der Hand aus dem brennenden Troja führt. Diese Bewegung gegen den Wind, durch Schneefall und Sturm, verweist auf eine kollektive Erfahrung von Flucht, Rettung und Überleben. Der Mythos wird dabei nicht verklärt, sondern als schmerzhaftes Durchhalten in widrigen Umständen dargestellt.
Auch die dritte Strophe bleibt im mythischen Raum, nun aber mit groteskem Einschlag: Helena – Inbegriff weiblicher Schönheit und Auslöser des Trojanischen Kriegs – erscheint „im Leib der Ratte“, was eine drastische Entmystifizierung bedeutet. Die Suche nach Liebe, Heimat und Identität wird zu einem armseligen, beinahe dämonischen Akt – „Liebe bettelt der Lemur“. Der Lemur, ein Geisterwesen aus dem römischen Volksglauben, verstärkt das Bild einer entzauberten Welt, in der große Mythen auf die Ebene des Tierischen und Triebhaften gesunken sind.
In der vierten Strophe wird die Zerstörung Trojas als ewiges Motiv dargestellt: „Trojas Trümmer wandern weiter“ – ein Bild für das wiederkehrende Scheitern von Hochkulturen, von Idealen, von Sinn. Der Gesang, der einst durch Homer Sinn und Form verlieh, bleibt aus. Der Mythos wird nicht mehr erzählt, zumindest nicht mit der Klarheit vergangener Zeiten. Die „Gesanges Leiter“, die zur Transzendenz führen könnte, bleibt den „Armen“ verwehrt – eine poetische Klage über die Sprachlosigkeit der Gegenwart.
Das Gedicht endet mit einer Spiegelung der Anfangsstrophe. Wieder wehen „geisterhafte Lüfte“, wieder stehen „Pfiff und Schrei“ im Raum. Doch am Ende flammt etwas auf: „ein Kreuz im Hirschgeweih“. Dieses finale Bild verbindet Natur (das Geweih), Mythos (der Hirsch als altes Totemtier) und Christentum (das Kreuz) in einer rätselhaften Vision von Hoffnung, Opfertod oder vielleicht Erlösung. Die „Winterwende“ markiert hier nicht nur den kalendarischen, sondern auch den geistigen Wendepunkt – zwischen Untergang und möglichem Neubeginn.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.