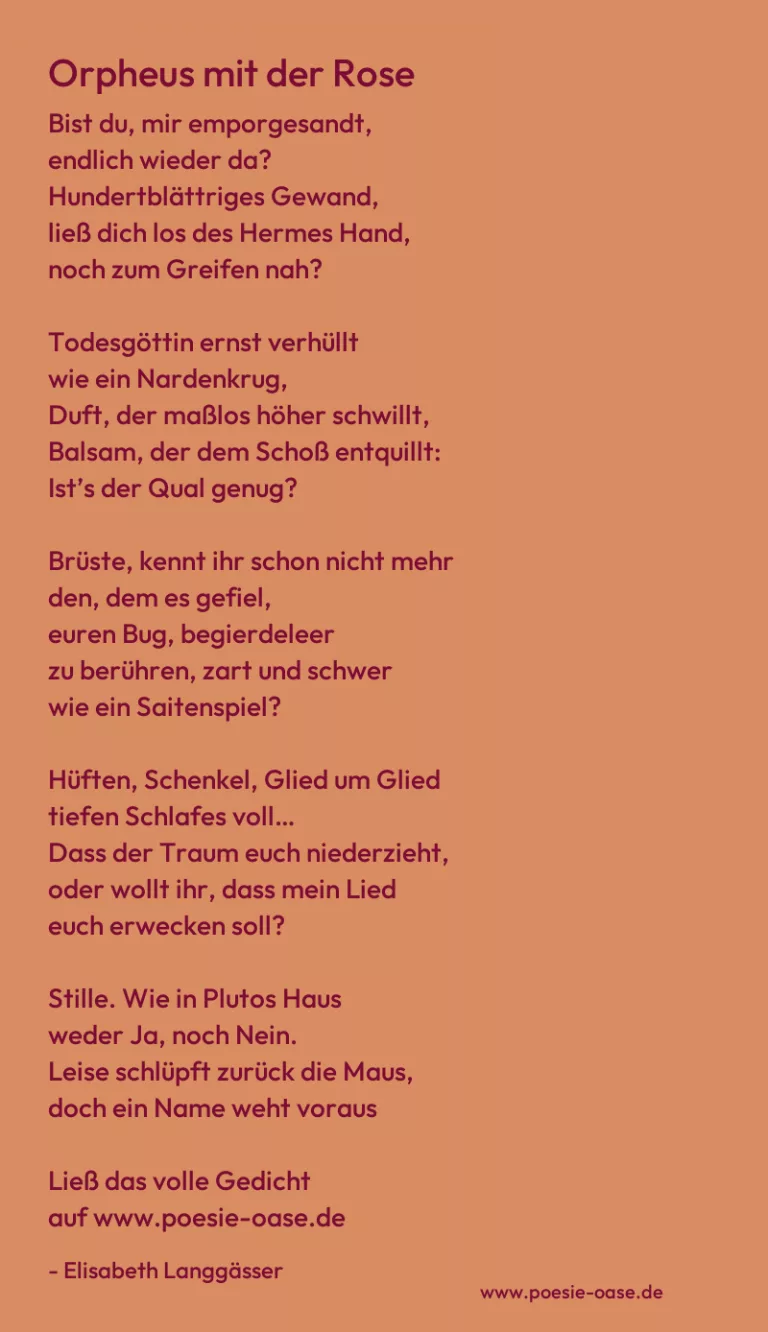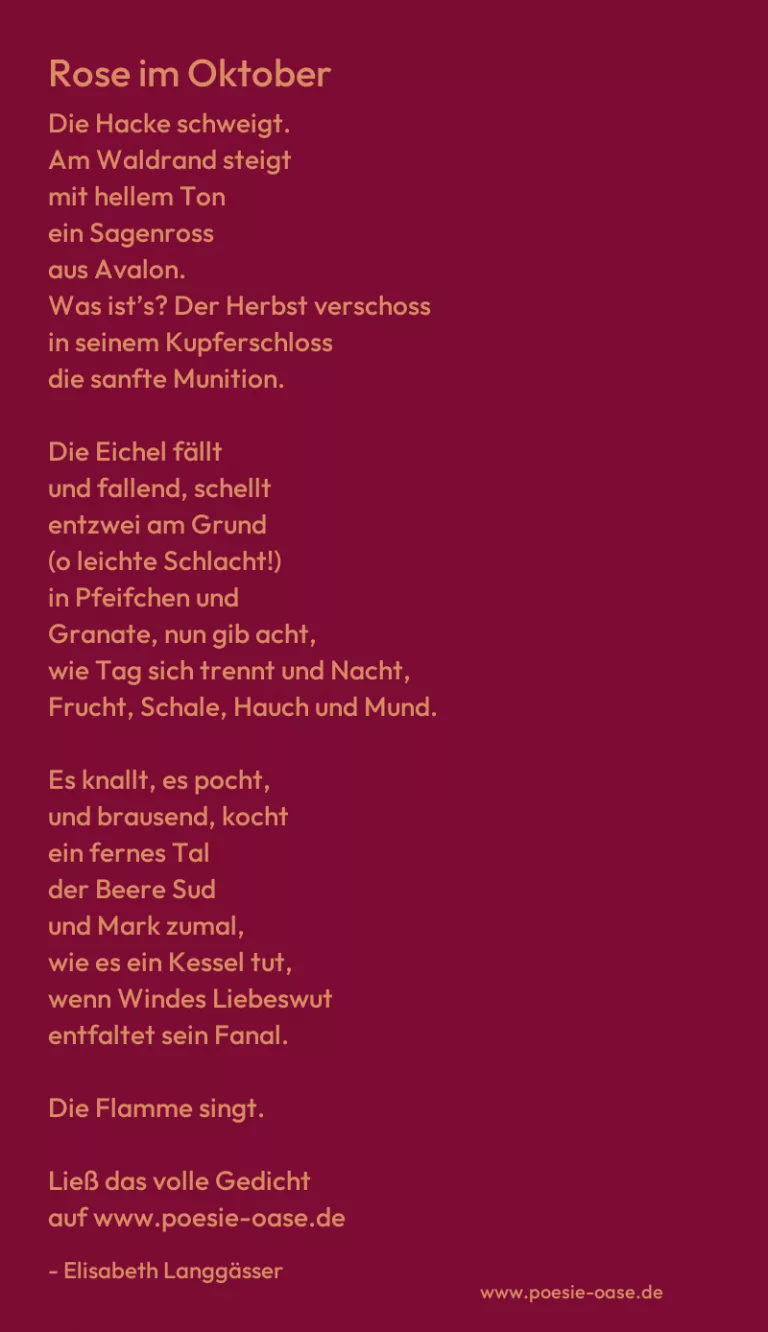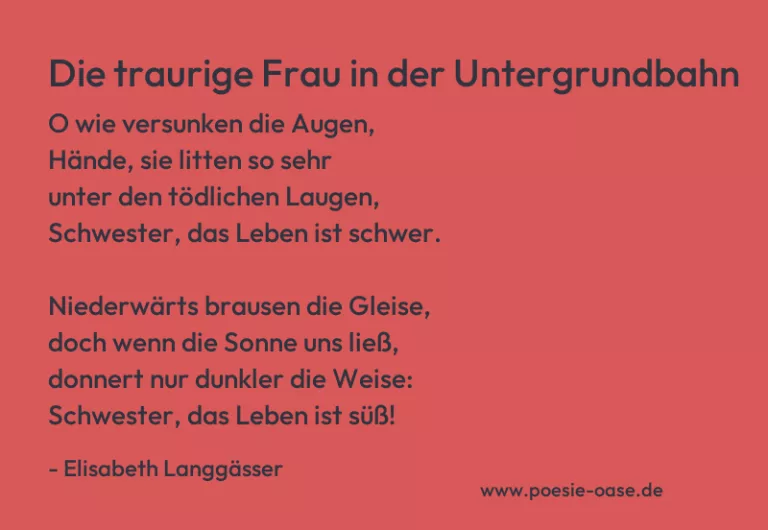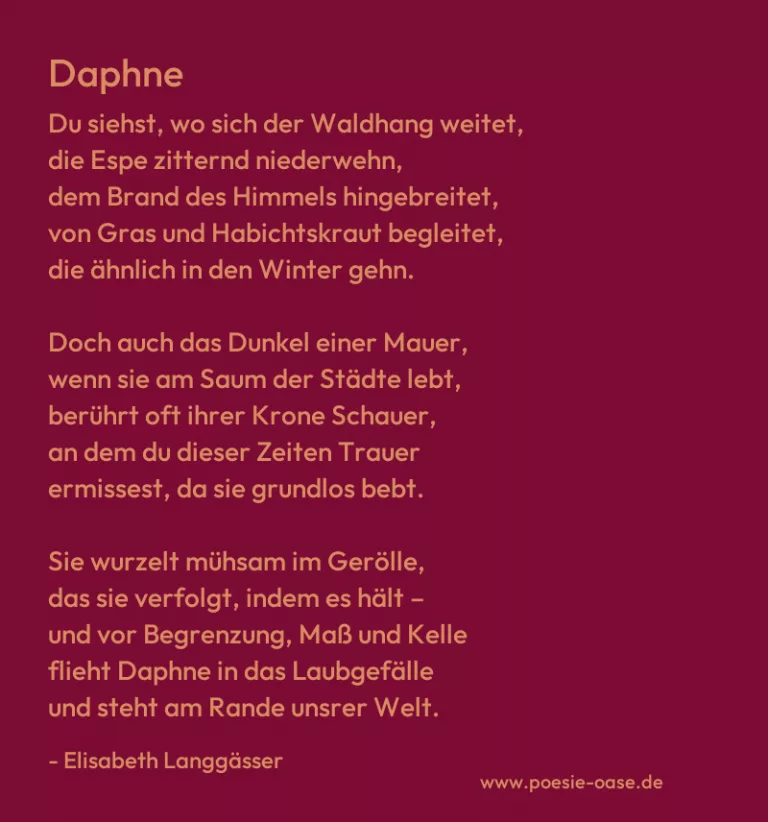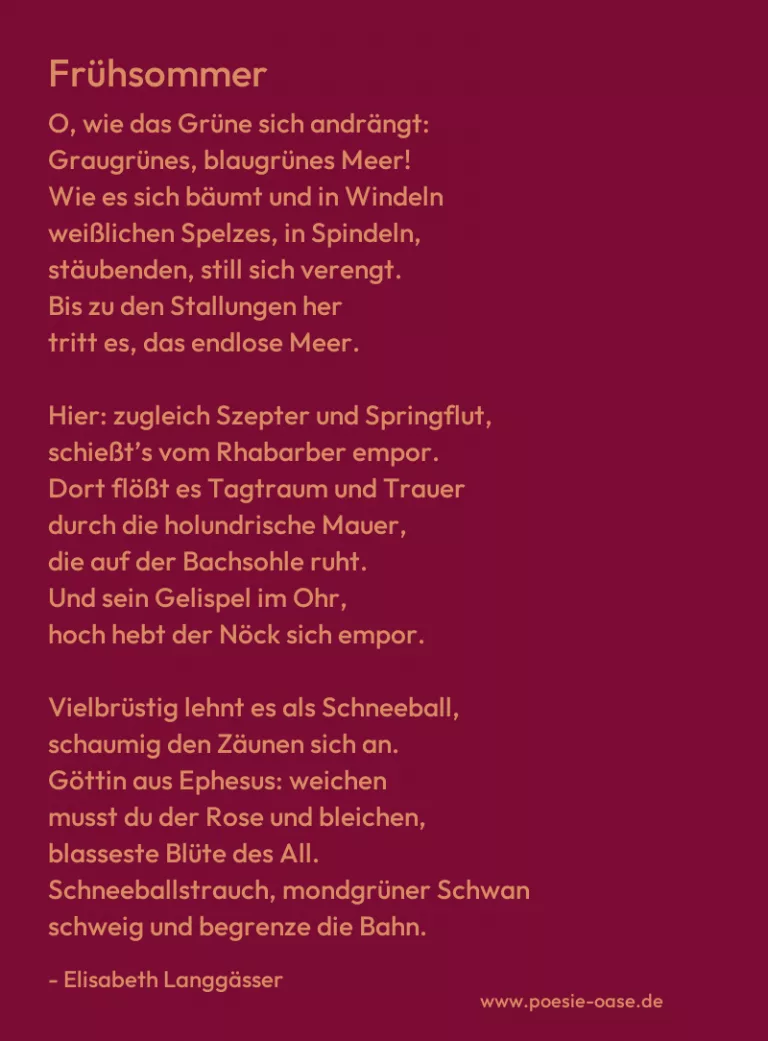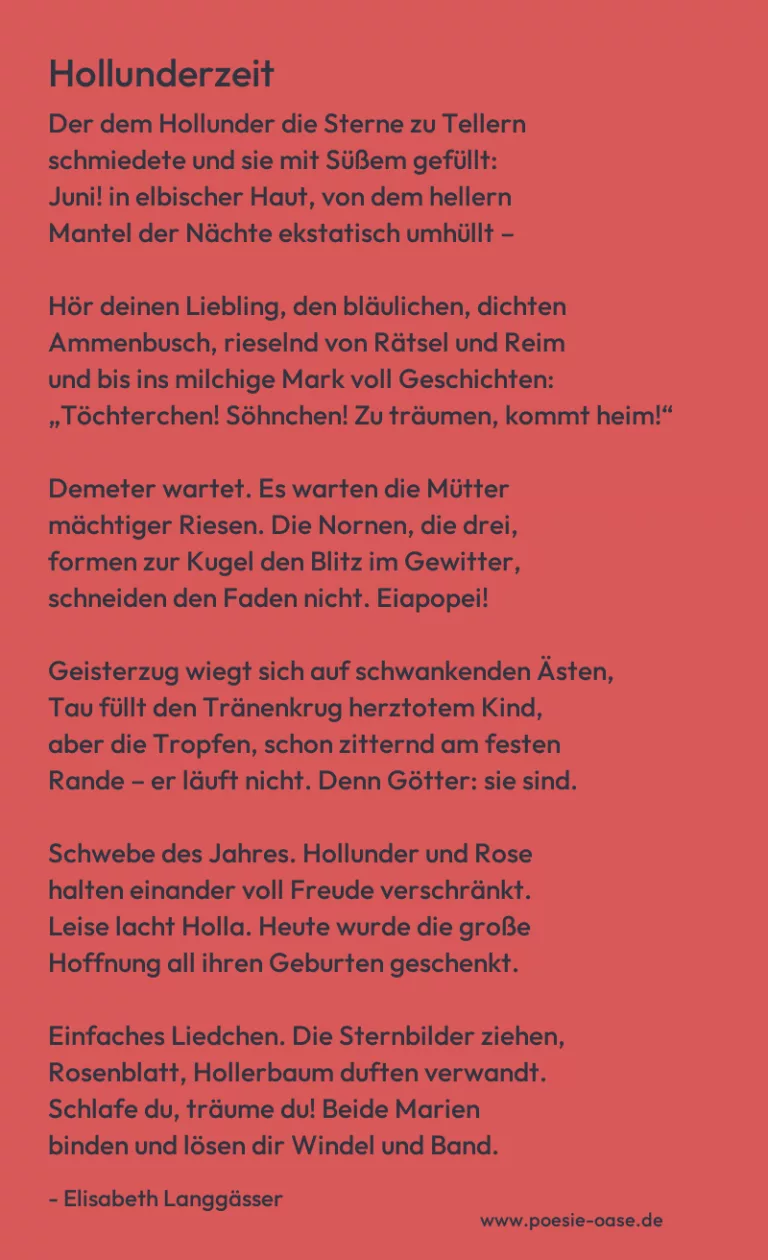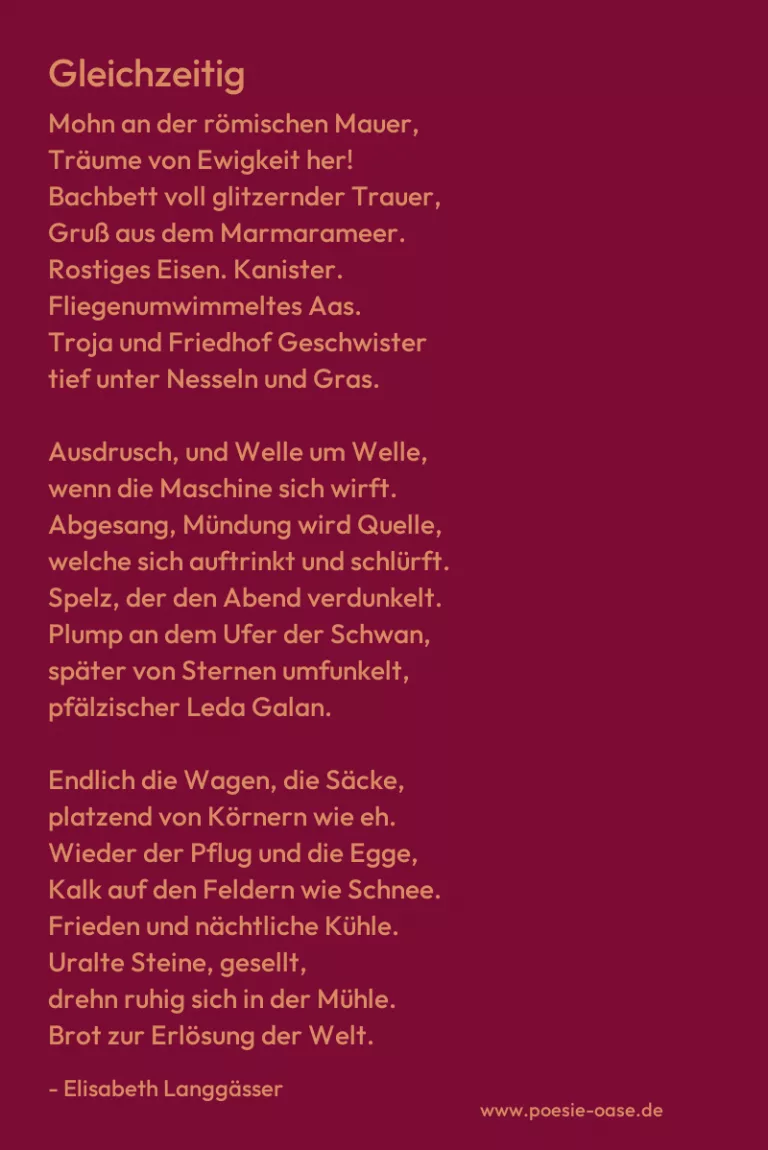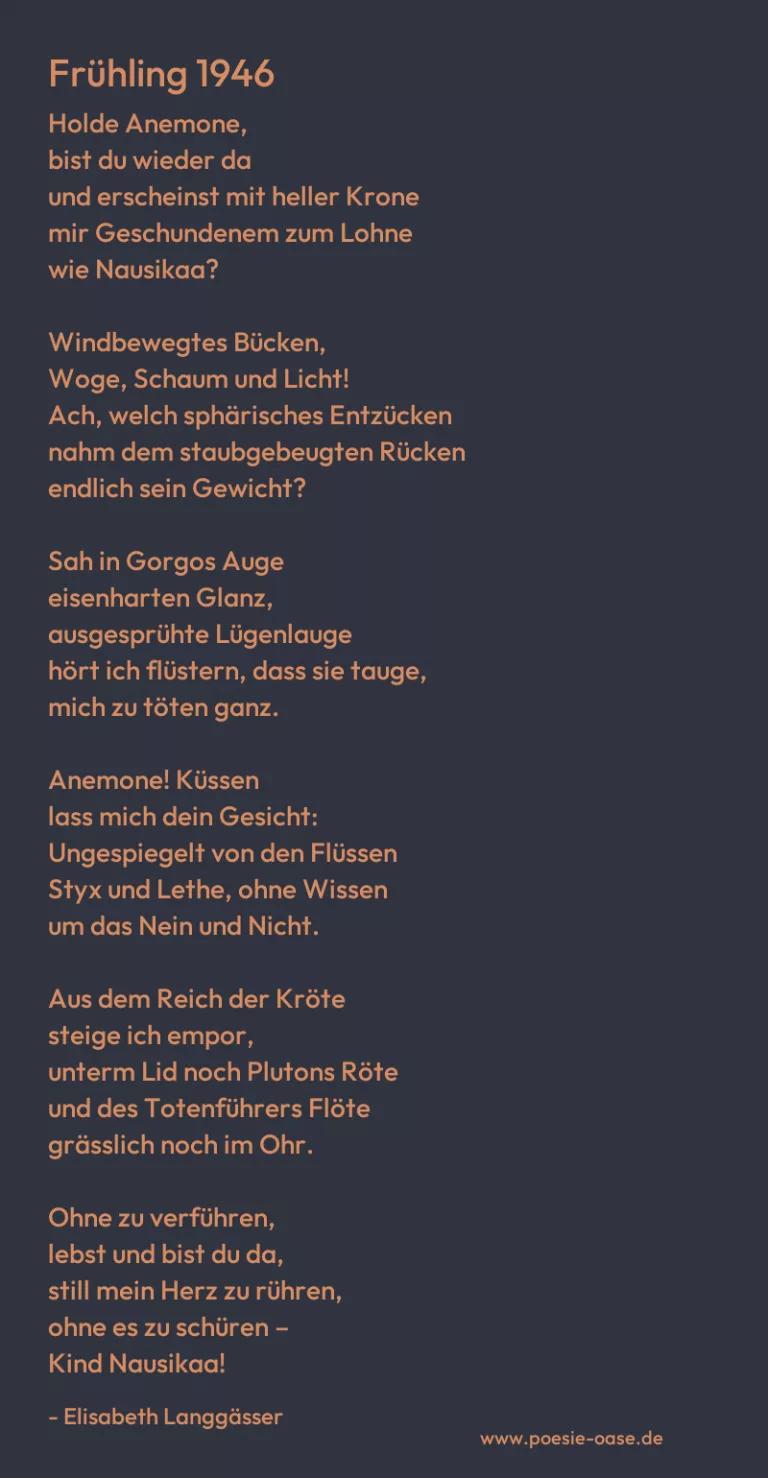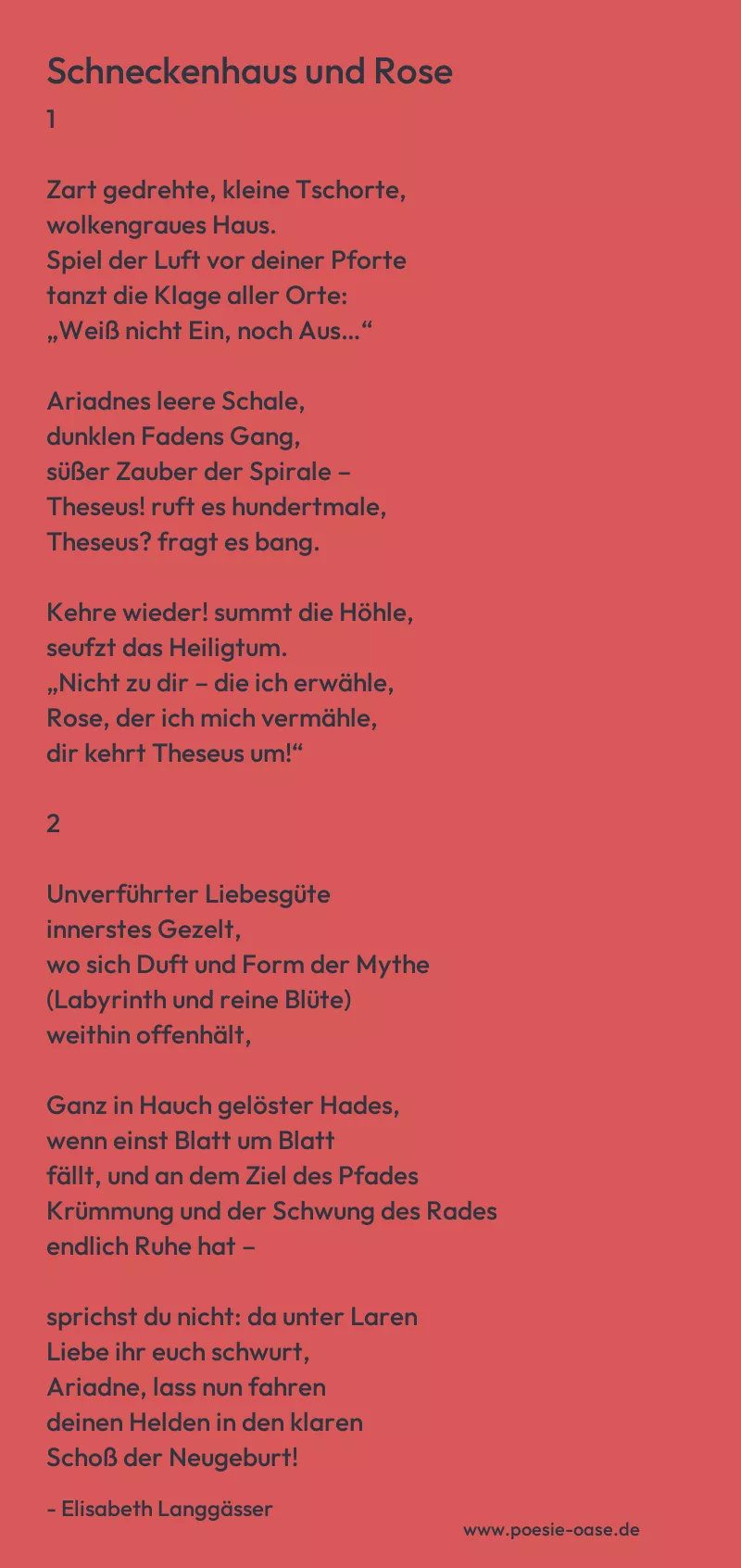Emotionen & Gefühle, Feiertage, Fortschritt, Freiheit & Sehnsucht, Frühling, Gemeinfrei, Griechenland, Herzschmerz, Kriegsgeschichte, Leichtigkeit, Liebe & Romantik, Sagen
Schneckenhaus und Rose
1
Zart gedrehte, kleine Tschorte,
wolkengraues Haus.
Spiel der Luft vor deiner Pforte
tanzt die Klage aller Orte:
„Weiß nicht Ein, noch Aus…“
Ariadnes leere Schale,
dunklen Fadens Gang,
süßer Zauber der Spirale –
Theseus! ruft es hundertmale,
Theseus? fragt es bang.
Kehre wieder! summt die Höhle,
seufzt das Heiligtum.
„Nicht zu dir – die ich erwähle,
Rose, der ich mich vermähle,
dir kehrt Theseus um!“
2
Unverführter Liebesgüte
innerstes Gezelt,
wo sich Duft und Form der Mythe
(Labyrinth und reine Blüte)
weithin offenhält,
Ganz in Hauch gelöster Hades,
wenn einst Blatt um Blatt
fällt, und an dem Ziel des Pfades
Krümmung und der Schwung des Rades
endlich Ruhe hat –
sprichst du nicht: da unter Laren
Liebe ihr euch schwurt,
Ariadne, lass nun fahren
deinen Helden in den klaren
Schoß der Neugeburt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
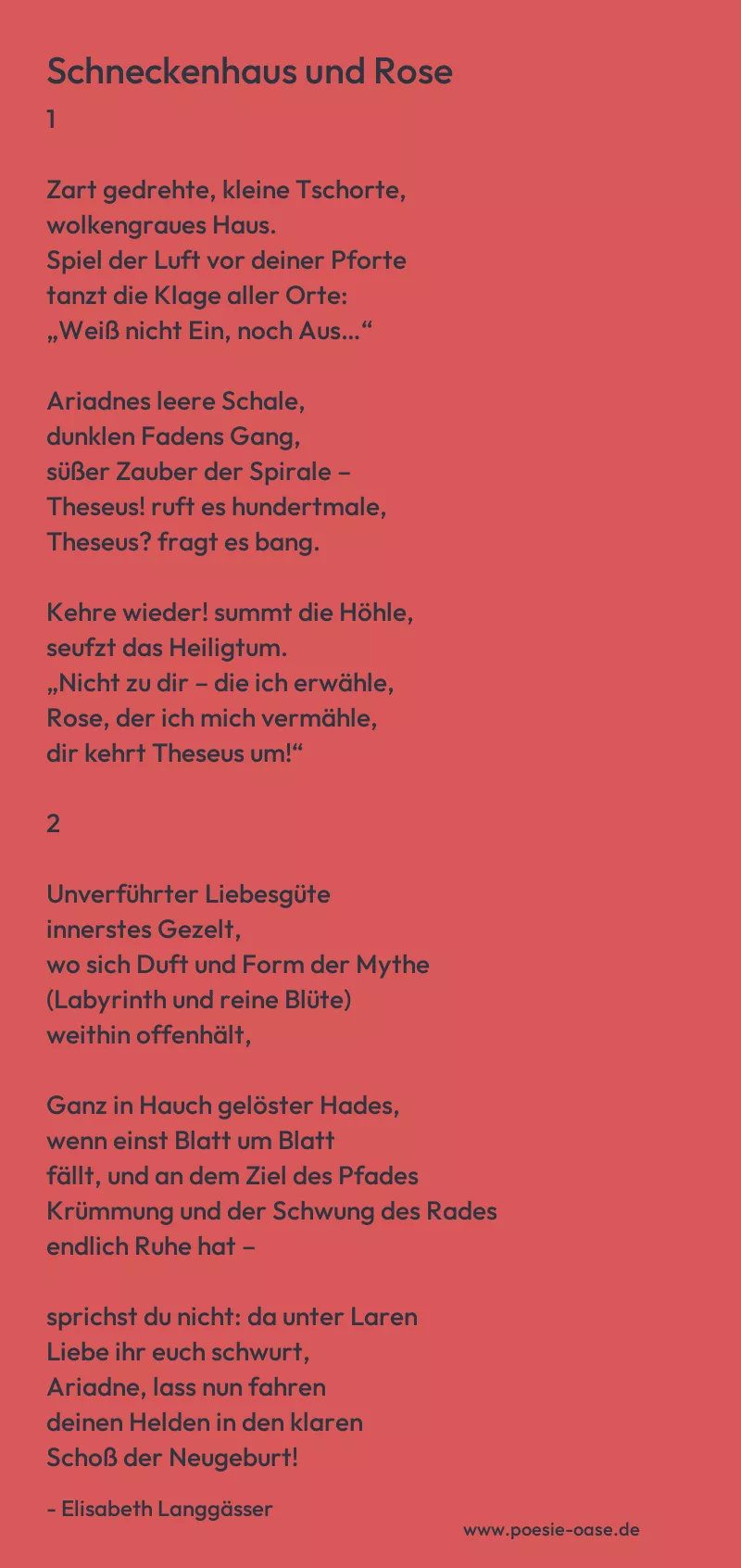
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schneckenhaus und Rose“ von Elisabeth Langgässer spielt mit mythologischen und poetischen Motiven und thematisiert die Themen Liebe, Sehnsucht und das Spannungsverhältnis zwischen Vergangenem und Neuem. In der ersten Strophe wird das Bild des Schneckenhauses eingeführt, das als „wolkengraues Haus“ und als „Zart gedrehte, kleine Tschorte“ beschrieben wird. Diese zarte Spiralform, die sich immer weiter in sich selbst windet, wird mit Ariadnes Schale und dem Faden von Theseus in Verbindung gebracht. Das „Haus“ des Schneckenhauses wird zu einer Metapher für das Labyrinth der griechischen Mythologie, in dem Theseus und Ariadne eine entscheidende Rolle spielen. Der Faden, den Ariadne Theseus gibt, um aus dem Labyrinth zu entkommen, ist gleichzeitig ein Symbol für Verstrickung und die Unmöglichkeit, „Ein“ oder „Aus“ zu erkennen – eine Metapher für den inneren Konflikt und das Unentschieden.
Die Wiederholung des Namens „Theseus“ in der zweiten Zeile sowie die Frage „Theseus? fragt es bang“ verdeutlicht die Unsicherheit und die Sehnsucht nach einer Antwort. Ariadne, die mit ihrem Schicksal in Verbindung steht, ruft nach Theseus, doch die Antwort bleibt unklar und voller Zweifel. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch im „Spiel der Luft“ vor dem Haus wider, das als Metapher für die flüchtige Natur von Liebe und Entscheidung steht. Der Ruf „Kehre wieder!“ und die Erwähnung der „Rose“ deutet darauf hin, dass eine andere Liebe oder Bestimmung auf Ariadne wartet – eine Wahl, die den Verlust von Theseus impliziert. Die „Rose“ wird hier als Symbol für eine neue, reinere Liebe verwendet, die das Alte ablöst.
In der zweiten Strophe wandelt sich die Atmosphäre und weitet sich von einer individuellen Liebesgeschichte zu einer universellen Reflexion über Liebe und Transformation. Die „unverführte Liebesgüte“ und das „innere Gezelt“ des Duftes und der Form der Mythe sprechen von einer tieferen, fast heiligen Dimension der Liebe, die über die menschlichen Beziehungen hinausgeht. Die „Krümmung und der Schwung des Rades“ deuten auf den Kreislauf des Lebens und die unvermeidliche Veränderung hin. Hier wird der Tod und das Vergehen von Zeit thematisiert, die durch die Metapher des „Blatt um Blatt“ fallenden Blattes und des „Hades“ als Ort der Transformation angedeutet werden. Der „Hades“ ist der Ort, an dem das Alte stirbt, aber auch der Raum für Erneuerung und „Neugeburt“.
Am Ende fordert das Gedicht Ariadne dazu auf, sich von ihrer alten Liebe zu lösen und „ihren Helden“ in den „klaren Schoß der Neugeburt“ zu entlassen. Die „Neugeburt“ symbolisiert den Beginn eines neuen Lebens, einer neuen Liebe oder einer neuen Erfüllung. Langgässer verbindet hier antike Mythologie mit einer tiefen, spirituellen Vision der Erneuerung und des Loslassens. Das Gedicht spricht von der Notwendigkeit, das Vergangene zu verabschieden, um Platz für das Neue zu schaffen, sei es in der Liebe, im Leben oder in der geistigen Entwicklung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.