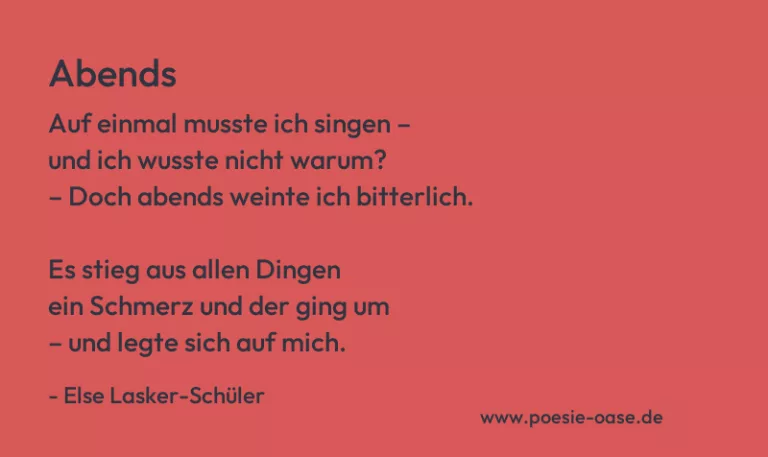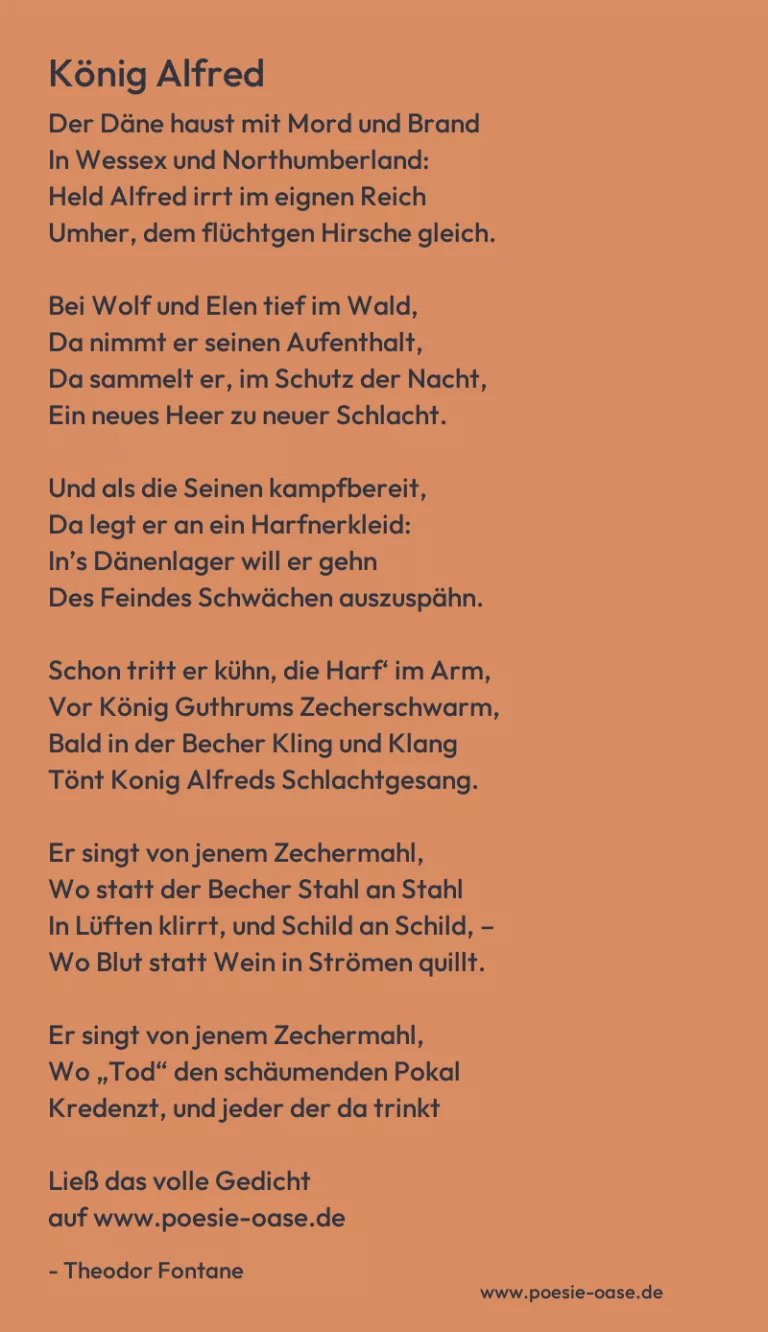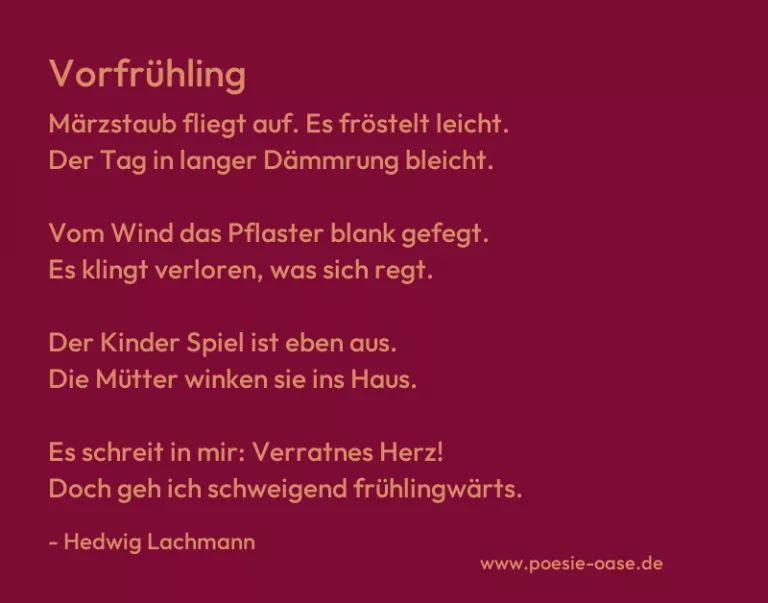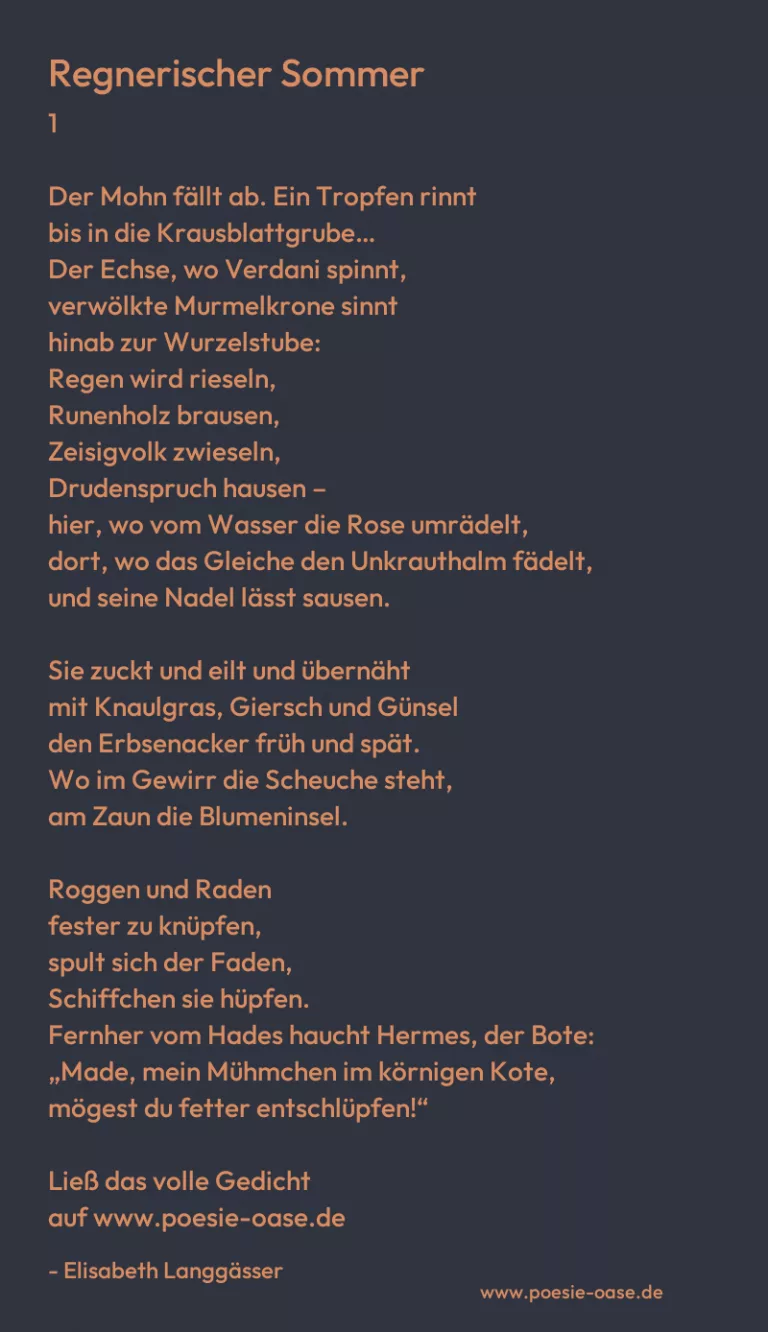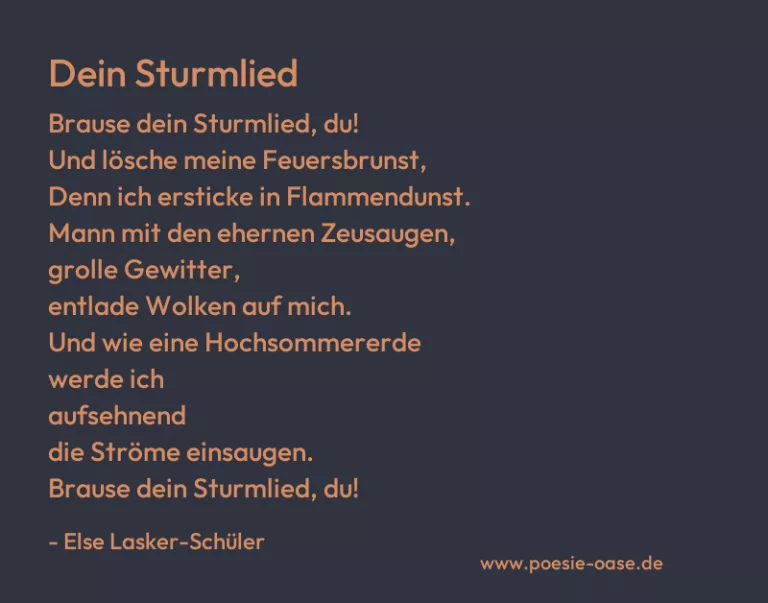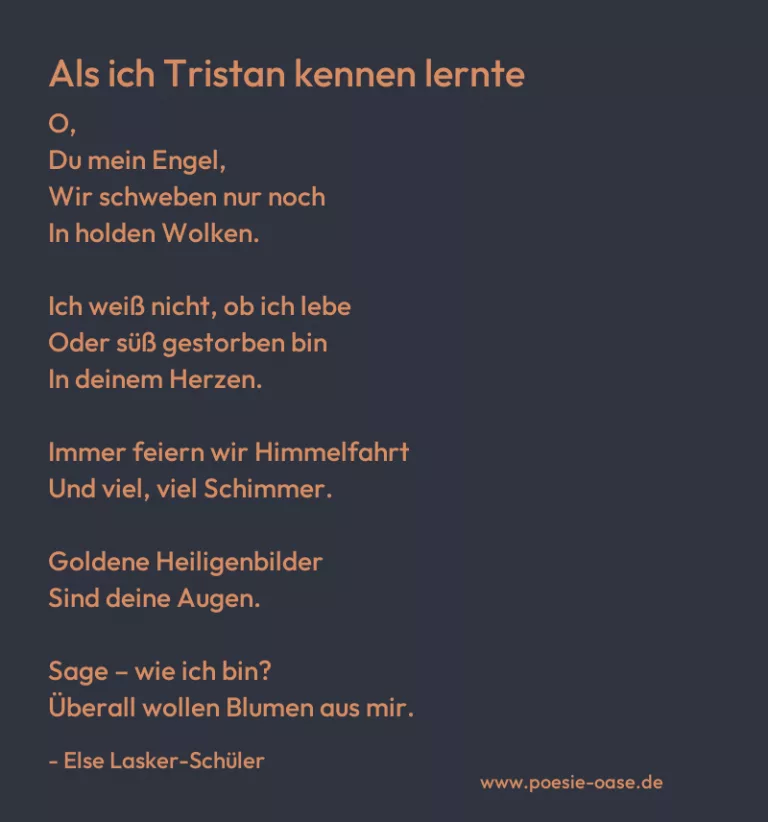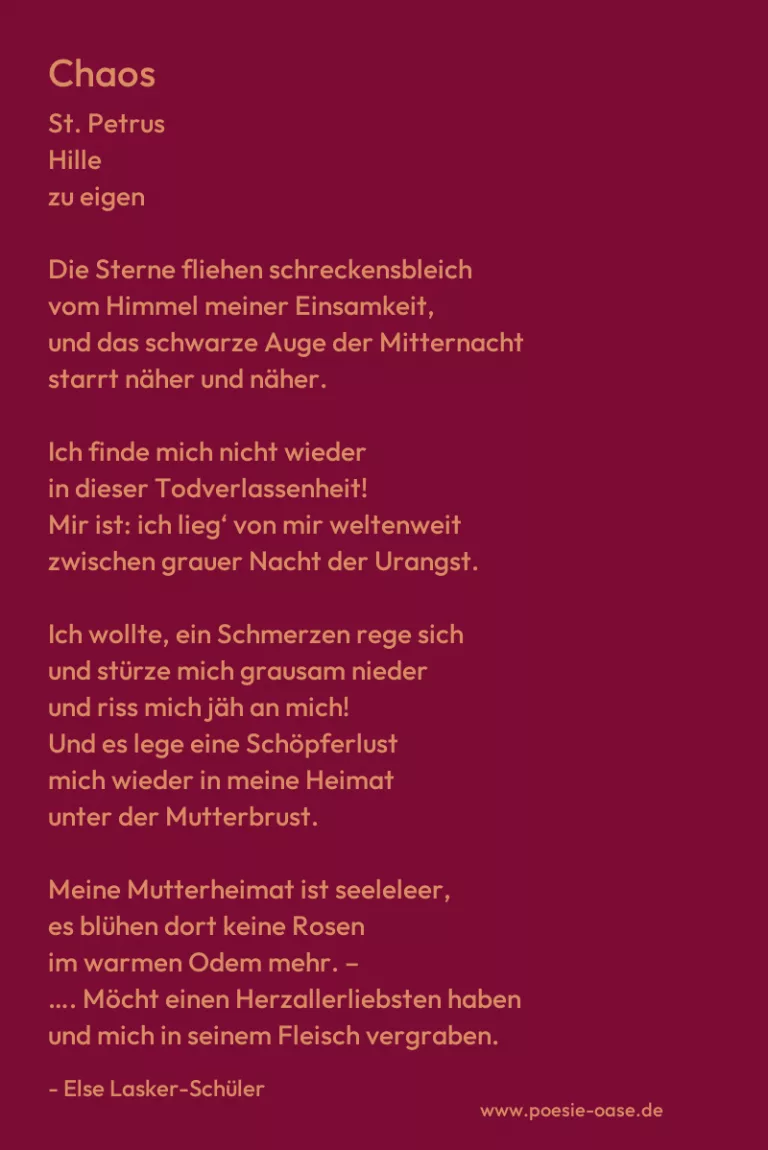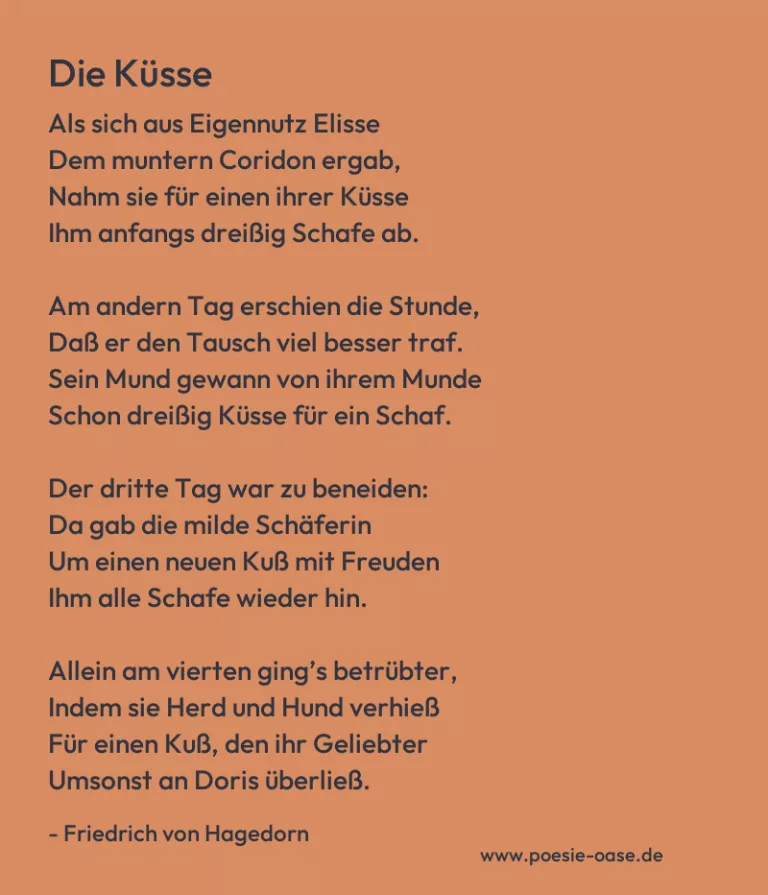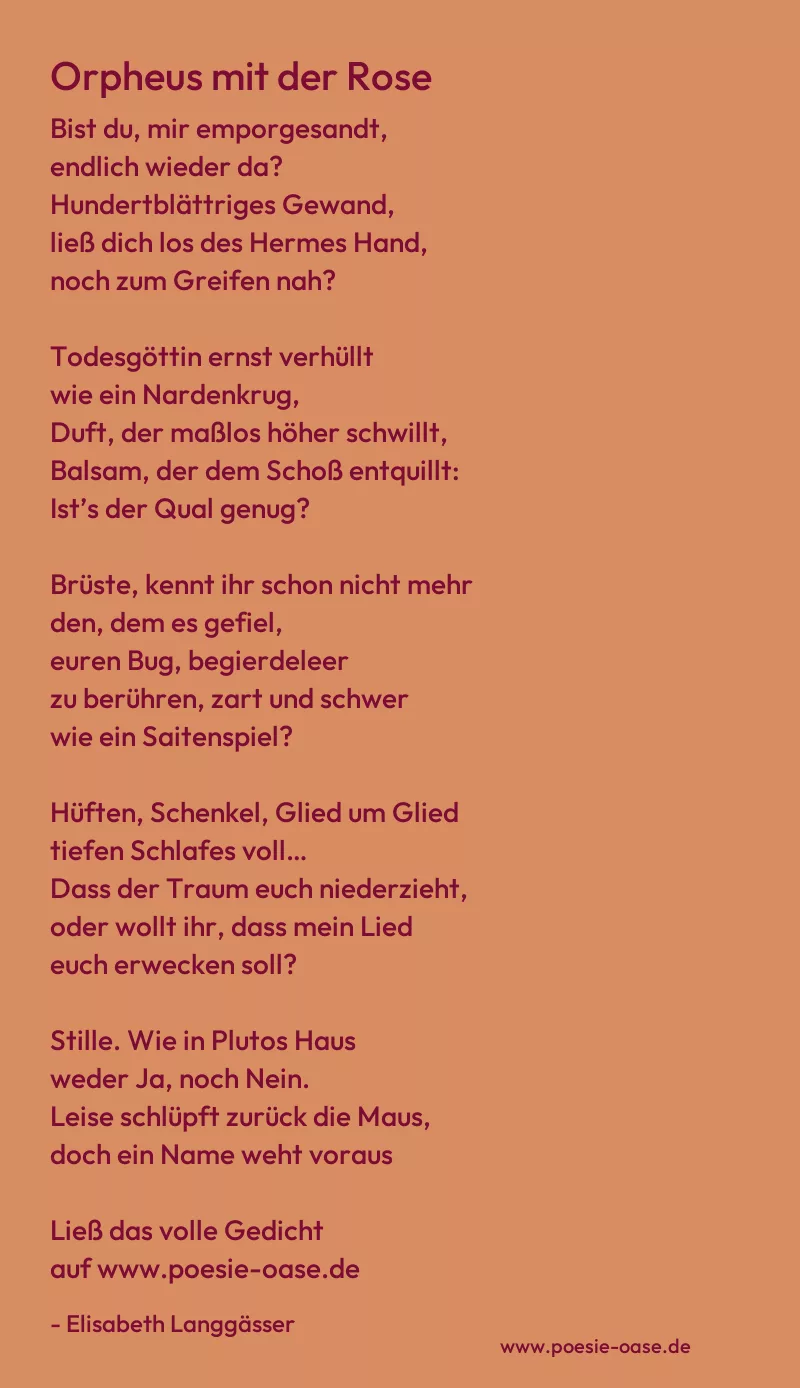Bist du, mir emporgesandt,
endlich wieder da?
Hundertblättriges Gewand,
ließ dich los des Hermes Hand,
noch zum Greifen nah?
Todesgöttin ernst verhüllt
wie ein Nardenkrug,
Duft, der maßlos höher schwillt,
Balsam, der dem Schoß entquillt:
Ist’s der Qual genug?
Brüste, kennt ihr schon nicht mehr
den, dem es gefiel,
euren Bug, begierdeleer
zu berühren, zart und schwer
wie ein Saitenspiel?
Hüften, Schenkel, Glied um Glied
tiefen Schlafes voll…
Dass der Traum euch niederzieht,
oder wollt ihr, dass mein Lied
euch erwecken soll?
Stille. Wie in Plutos Haus
weder Ja, noch Nein.
Leise schlüpft zurück die Maus,
doch ein Name weht voraus
wie des Morgens Schein.
Sein Gewölbe sphärisch legt
sich um meinen Leib:
Mutter, die mich mystisch hegt,
ungeboren mich, trägt,
heute sagst du: „Bleib!“
In dem Hauch der Rose ruht
wunschlos mein Geschlecht.
Wenn einst der Mänade Wut
mir zerstücket Fleisch und Blut,
ist es Orpheus recht.
Haupt und Leier schwimmen dann
auf dem Samenstrom.
Beides ward ich: Weib und Mann,
Allnatur, erlöst vom Bann,
Wurzel und Arom…