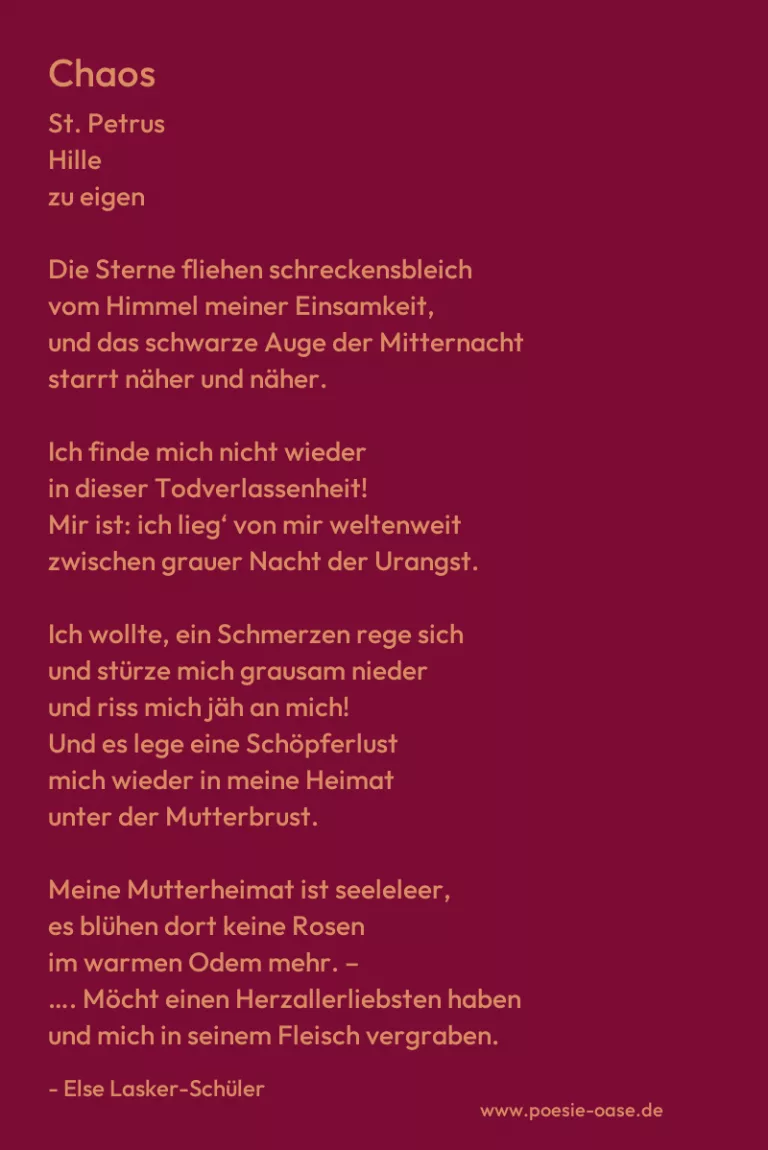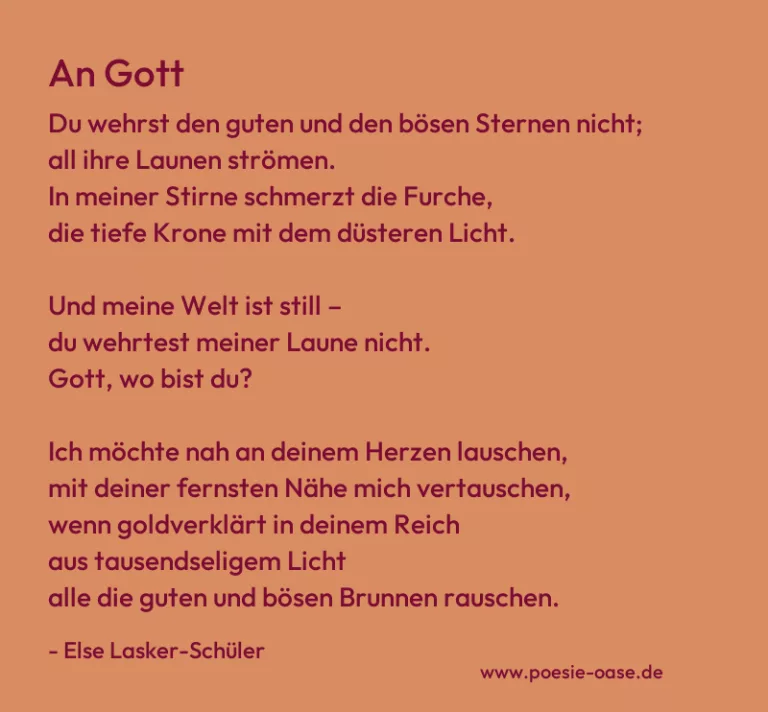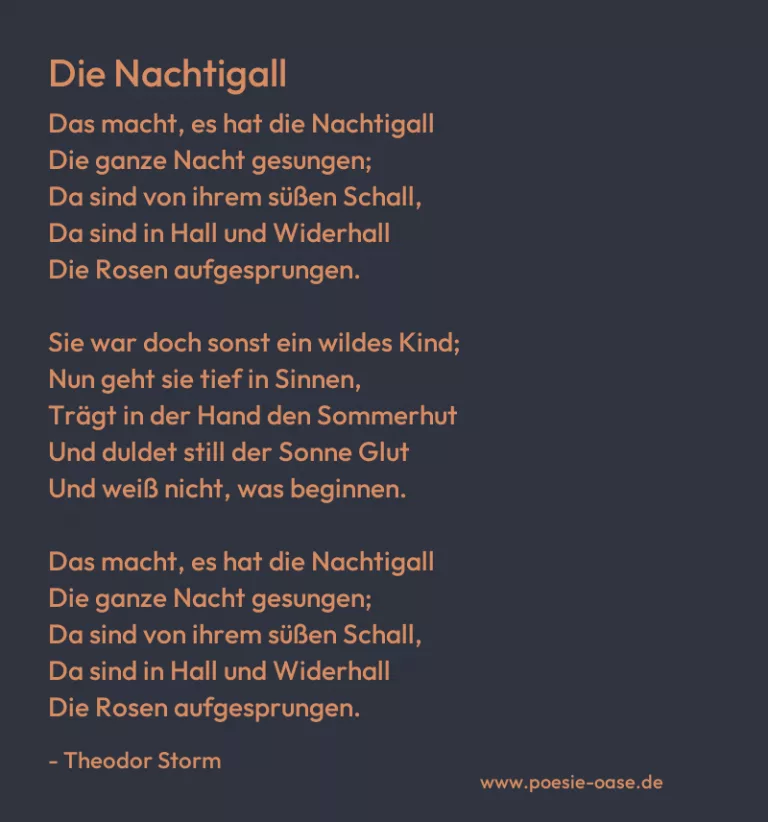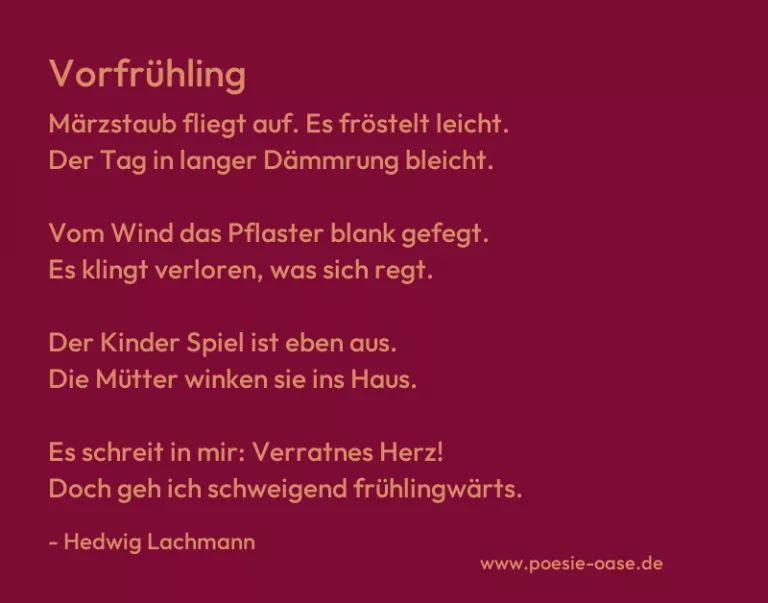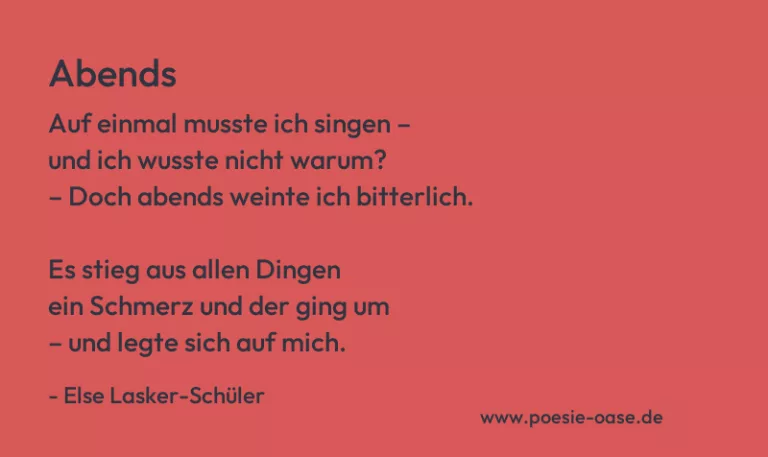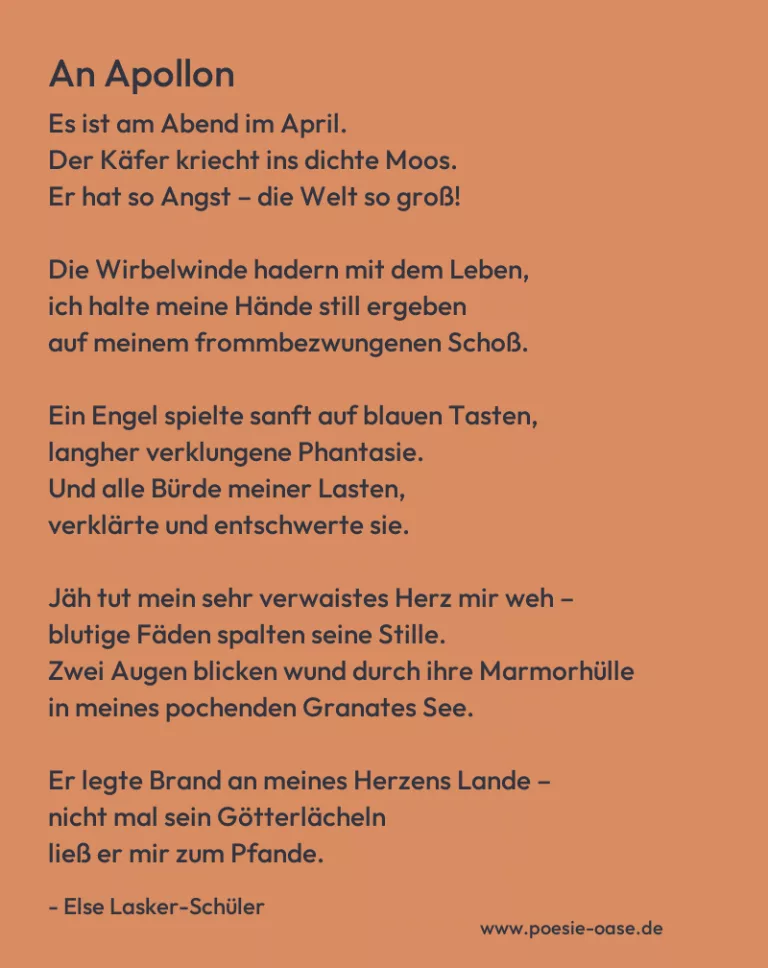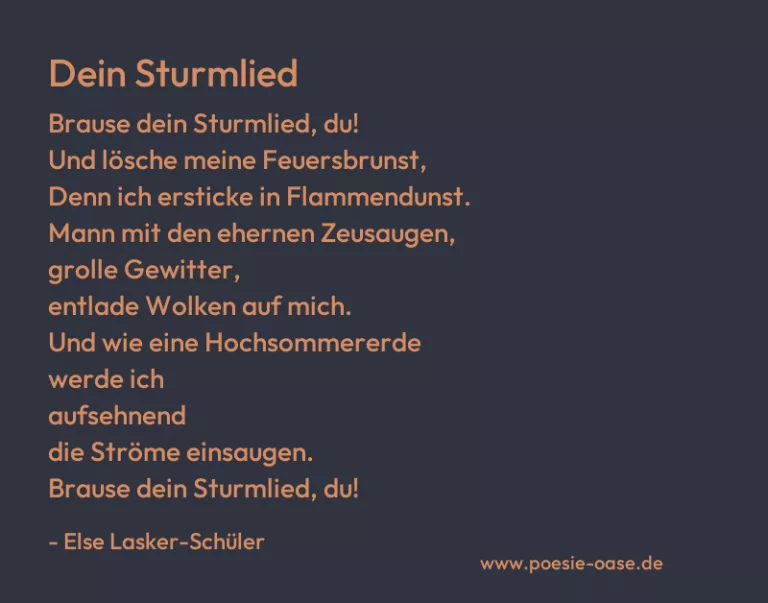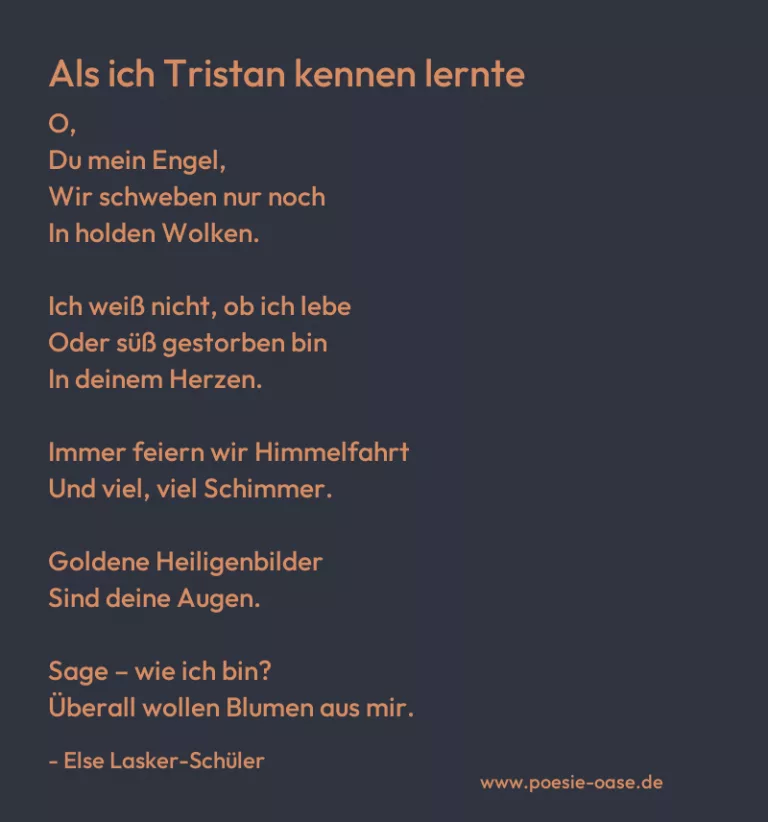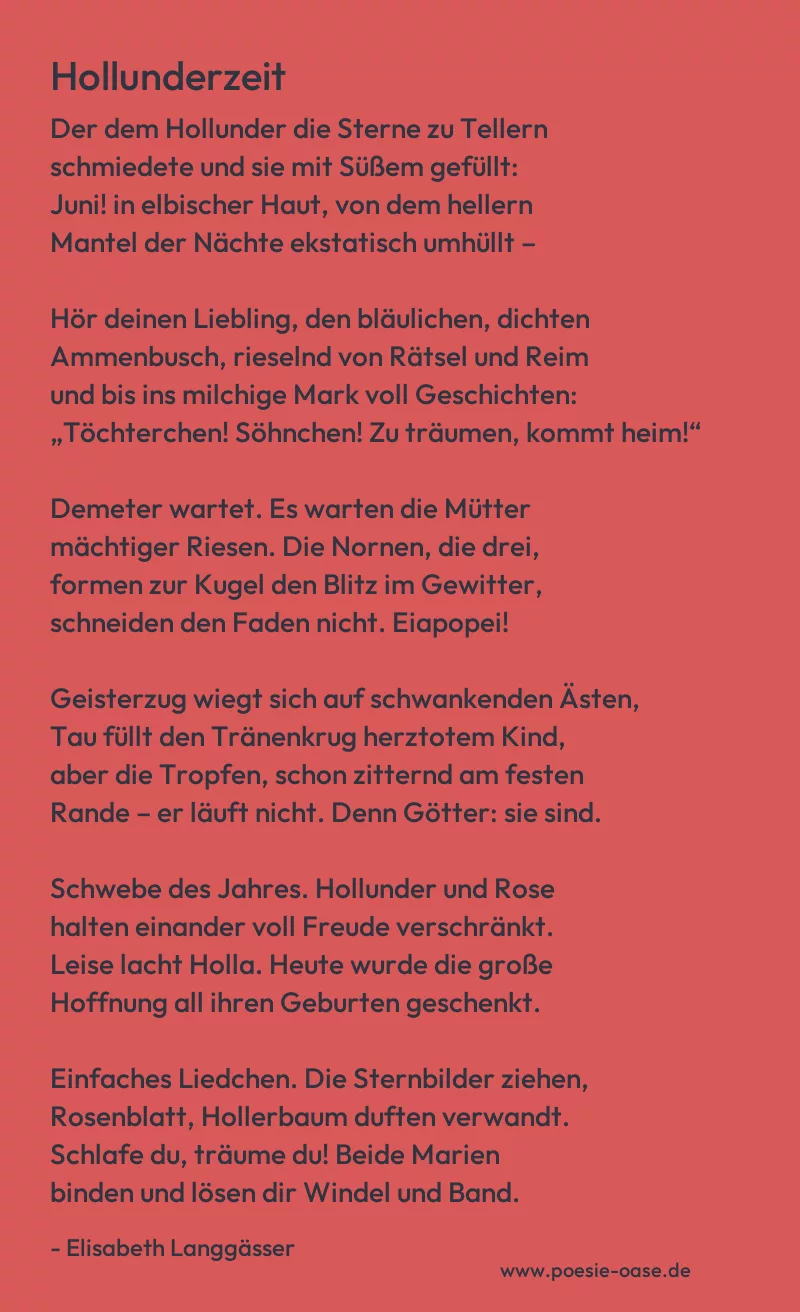Hollunderzeit
Der dem Hollunder die Sterne zu Tellern
schmiedete und sie mit Süßem gefüllt:
Juni! in elbischer Haut, von dem hellern
Mantel der Nächte ekstatisch umhüllt –
Hör deinen Liebling, den bläulichen, dichten
Ammenbusch, rieselnd von Rätsel und Reim
und bis ins milchige Mark voll Geschichten:
„Töchterchen! Söhnchen! Zu träumen, kommt heim!“
Demeter wartet. Es warten die Mütter
mächtiger Riesen. Die Nornen, die drei,
formen zur Kugel den Blitz im Gewitter,
schneiden den Faden nicht. Eiapopei!
Geisterzug wiegt sich auf schwankenden Ästen,
Tau füllt den Tränenkrug herztotem Kind,
aber die Tropfen, schon zitternd am festen
Rande – er läuft nicht. Denn Götter: sie sind.
Schwebe des Jahres. Hollunder und Rose
halten einander voll Freude verschränkt.
Leise lacht Holla. Heute wurde die große
Hoffnung all ihren Geburten geschenkt.
Einfaches Liedchen. Die Sternbilder ziehen,
Rosenblatt, Hollerbaum duften verwandt.
Schlafe du, träume du! Beide Marien
binden und lösen dir Windel und Band.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
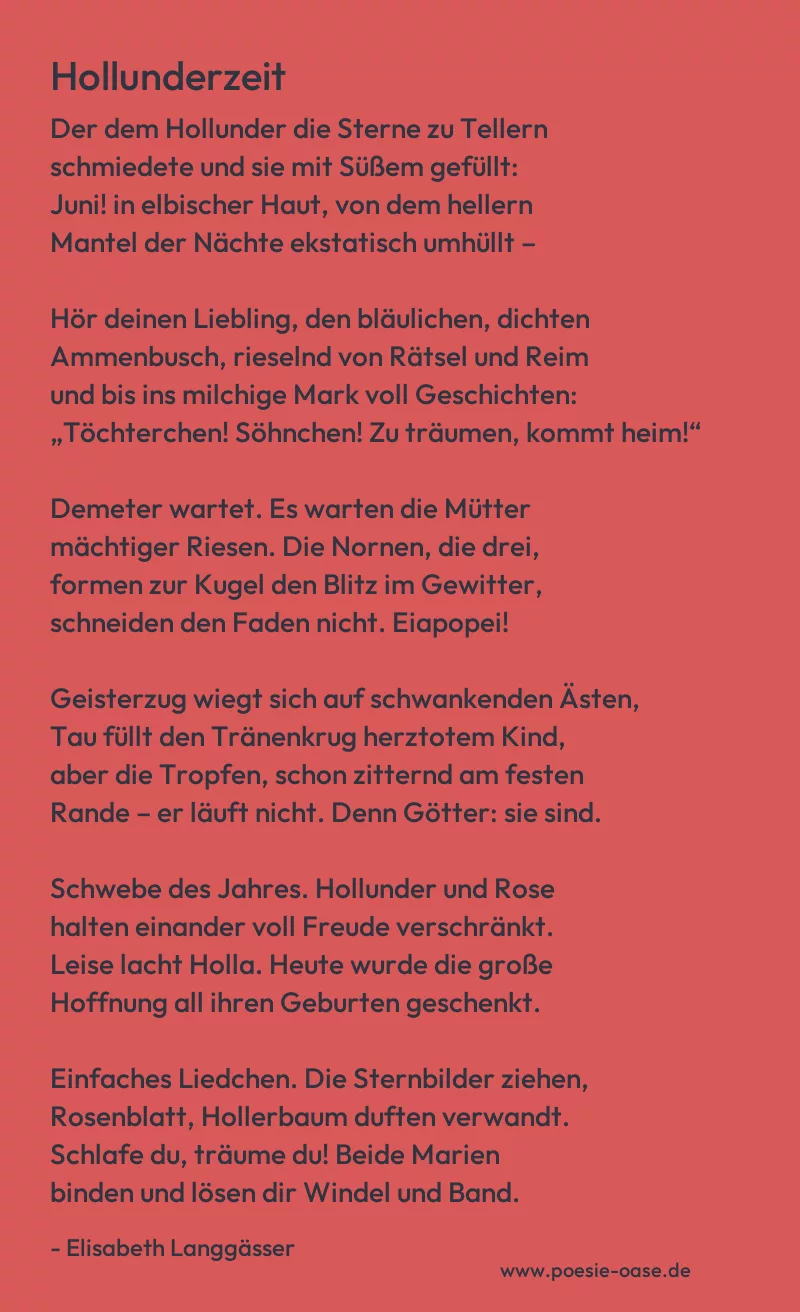
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hollunderzeit“ von Elisabeth Langgässer entfaltet eine reiche Symbolik, die tief in mythologischen und natürlichen Elementen verwurzelt ist. Zu Beginn wird der Hollunder als eine fast magische Pflanze beschrieben, die mit den „Sternen zu Tellern“ geschmückt ist. Diese Verbindung von Himmel und Erde, von dem Unfassbaren mit dem Alltäglichen, deutet auf die mystische Bedeutung des Juni, eines Monats, der in seiner Fülle sowohl mit dem Leben als auch mit einer gewissen Spiritualität und Ekstase aufgeladen ist. Der „hellere Mantel der Nächte“ unterstreicht eine mystische Atmosphäre, in der die Übergänge zwischen Tag und Nacht fließend und bezaubernd sind.
Die zweite Strophe stellt den „bläulichen, dichten Ammenbusch“ in den Mittelpunkt, der „rieselnd von Rätsel und Reim“ ist und die Kinder zum Träumen ruft. Die Figur des Ammenbusches ist hier eine Mischung aus schützender Mutterfigur und einer Quelle des Wissens und der Geschichten. Diese Geschichten scheinen tief in der Natur verankert zu sein, mit der Verbindung zu Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit und Ernte, sowie den Nornen, den Schicksalsgöttinnen der nordischen Mythologie, die den Lebensfaden der Menschen spinnen. Die „Töchterchen“ und „Söhnchen“ könnten als Symbole für das Leben, die Unschuld und das Versprechen des Wachstums und der Entwicklung verstanden werden.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird das Bild eines „Geisterzugs“ eingeführt, der sich „auf schwankenden Ästen“ wiegt, und die tropfenden „Tränenkrüge“ deuten auf die vergängliche Natur des Lebens und der Emotionen hin. Doch trotz des fließenden Wassers und der drohenden Geister bleibt der Glaube an die Götter erhalten: „Denn Götter: sie sind.“ Diese Zeile könnte als ein Hinweis auf das Überdauern des Göttlichen und die Unaufhaltsamkeit des natürlichen Zyklus interpretiert werden, der selbst durch die Dunkelheit und das Leid hindurchgeht.
Die letzten Verse des Gedichts bringen ein Bild der Vereinigung und des Friedens, in dem der „Hollunder und die Rose“ sich „voll Freude verschränkt“ halten. Diese Pflanzen, die in vielen Kulturen mit Liebe und Heilung in Verbindung stehen, symbolisieren hier eine harmonische Koexistenz von verschiedenen Aspekten des Lebens. Die „große Hoffnung“ wird den „Geburten“ geschenkt, was auf die Erneuerung und das Versprechen des Lebens hinweist, das in jedem Zyklus von Natur und Mythos erneuert wird.
Schließlich ruft das Gedicht mit einem sanften „einfachen Liedchen“ und der Beschwörung von „Marien“, die sowohl als schützende Mutterfiguren als auch als heilige Gestalten erscheinen, zu Ruhe und Träumen auf. Die natürliche Welt, in ihrer vollen Pracht und Komplexität, umhüllt den Leser wie eine beruhigende Wiege, die sowohl den Trost als auch das Geheimnis des Lebens trägt. Langgässer verknüpft in „Hollunderzeit“ Natur, Mythologie und spirituelle Elemente zu einem Bild des Lebenszyklus, das von Hoffnung, Geborgenheit und gleichzeitig von der Unausweichlichkeit des Schicksals geprägt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.