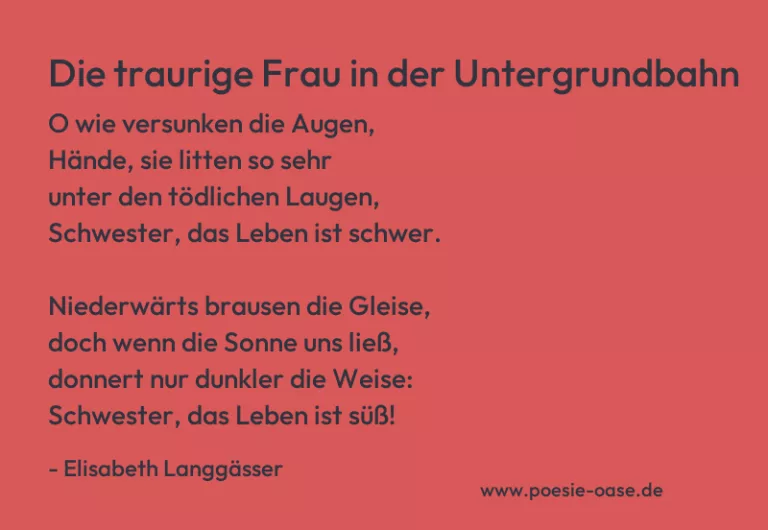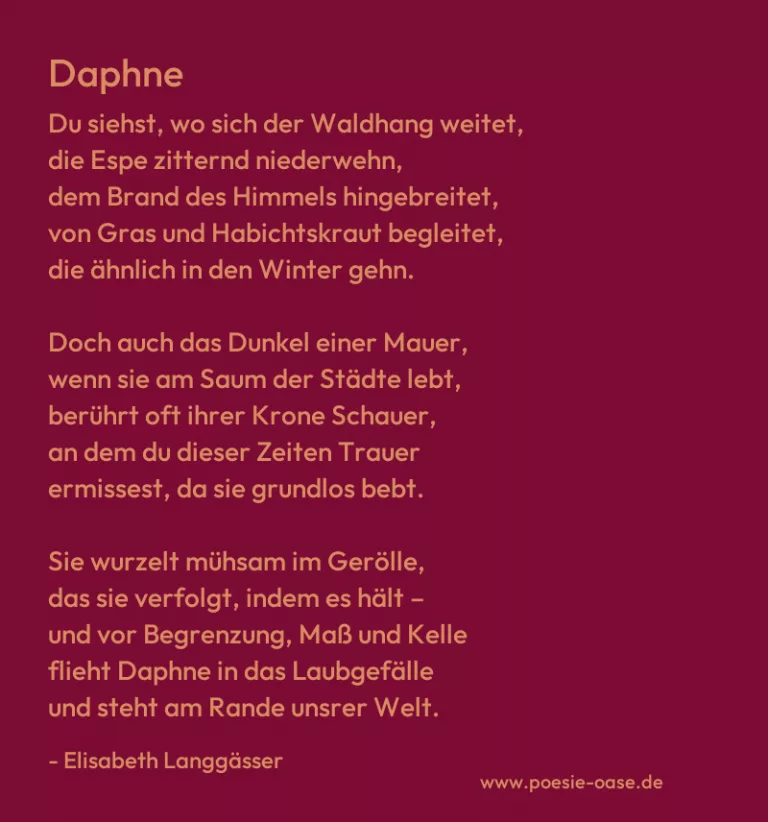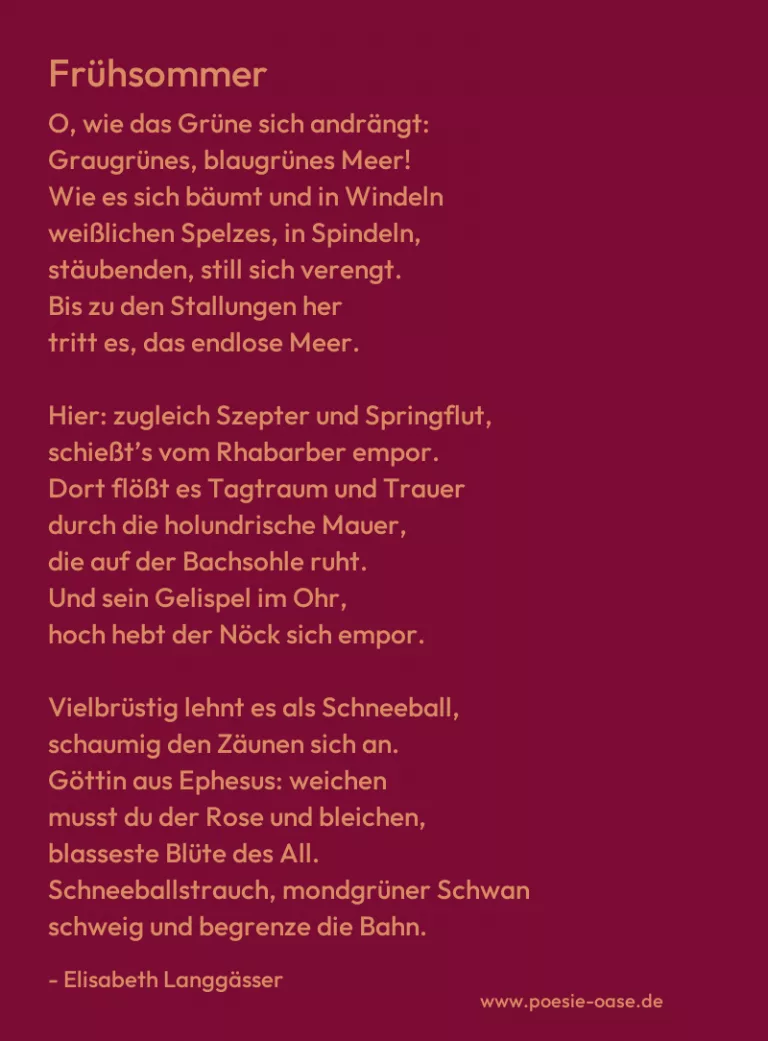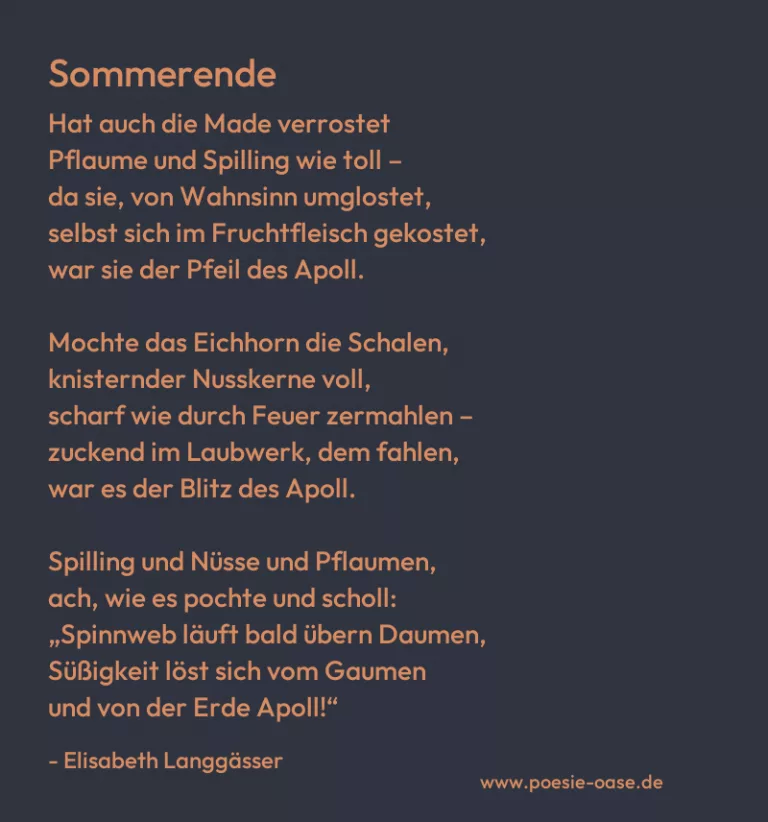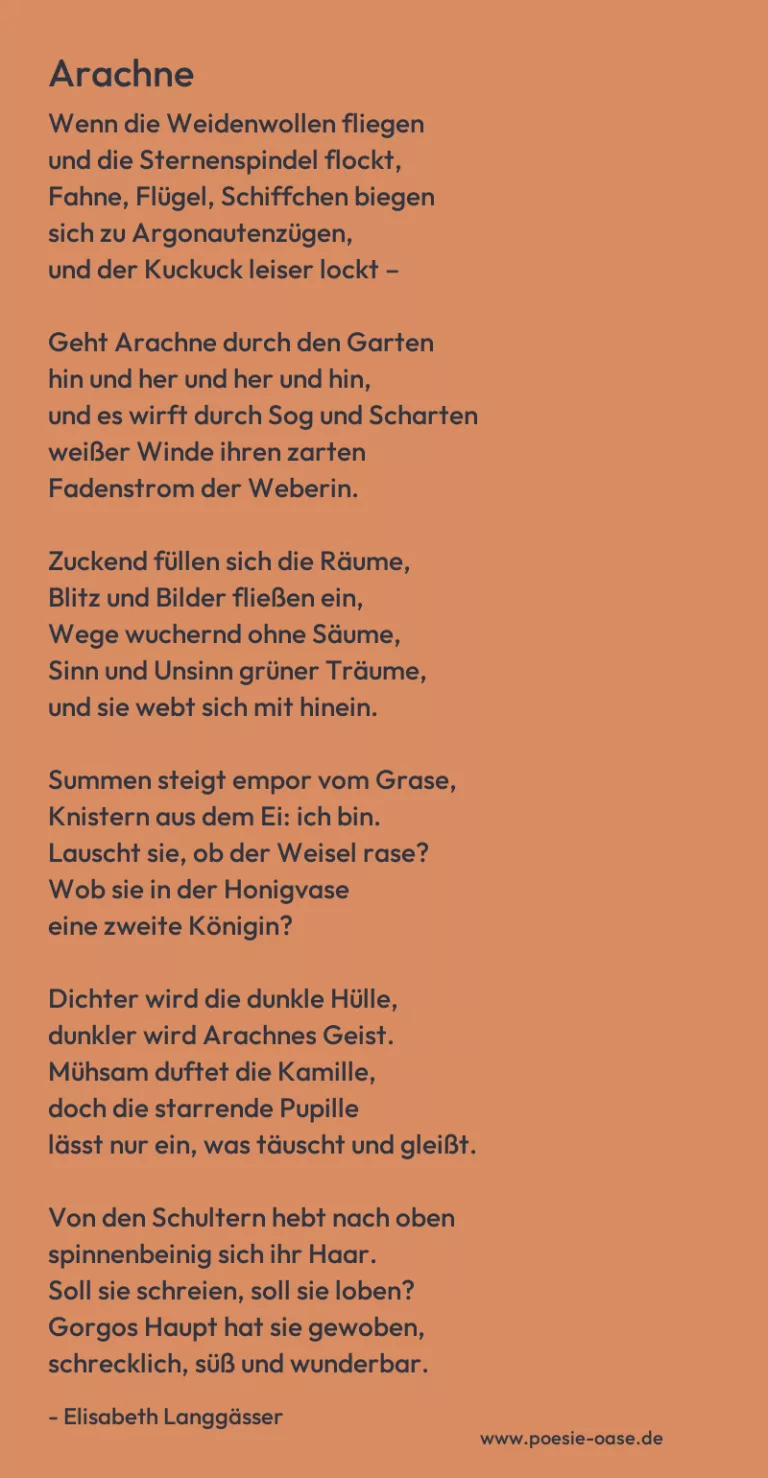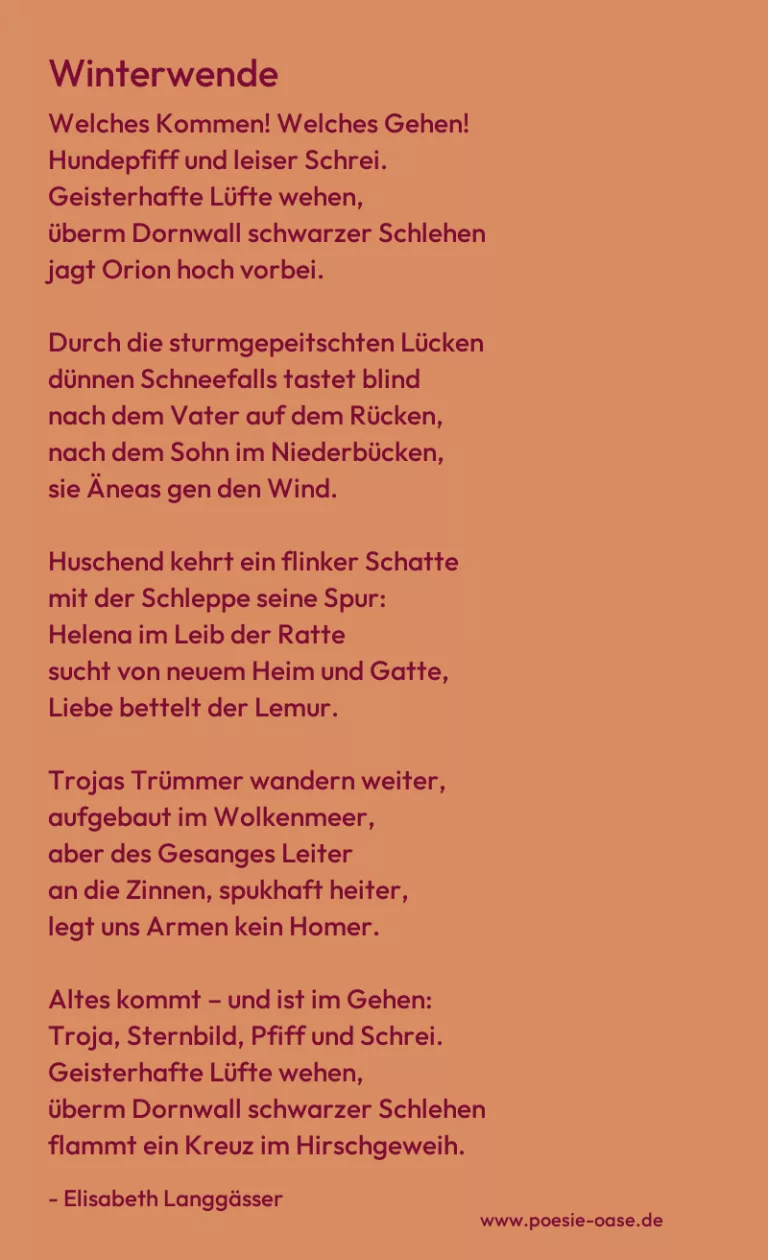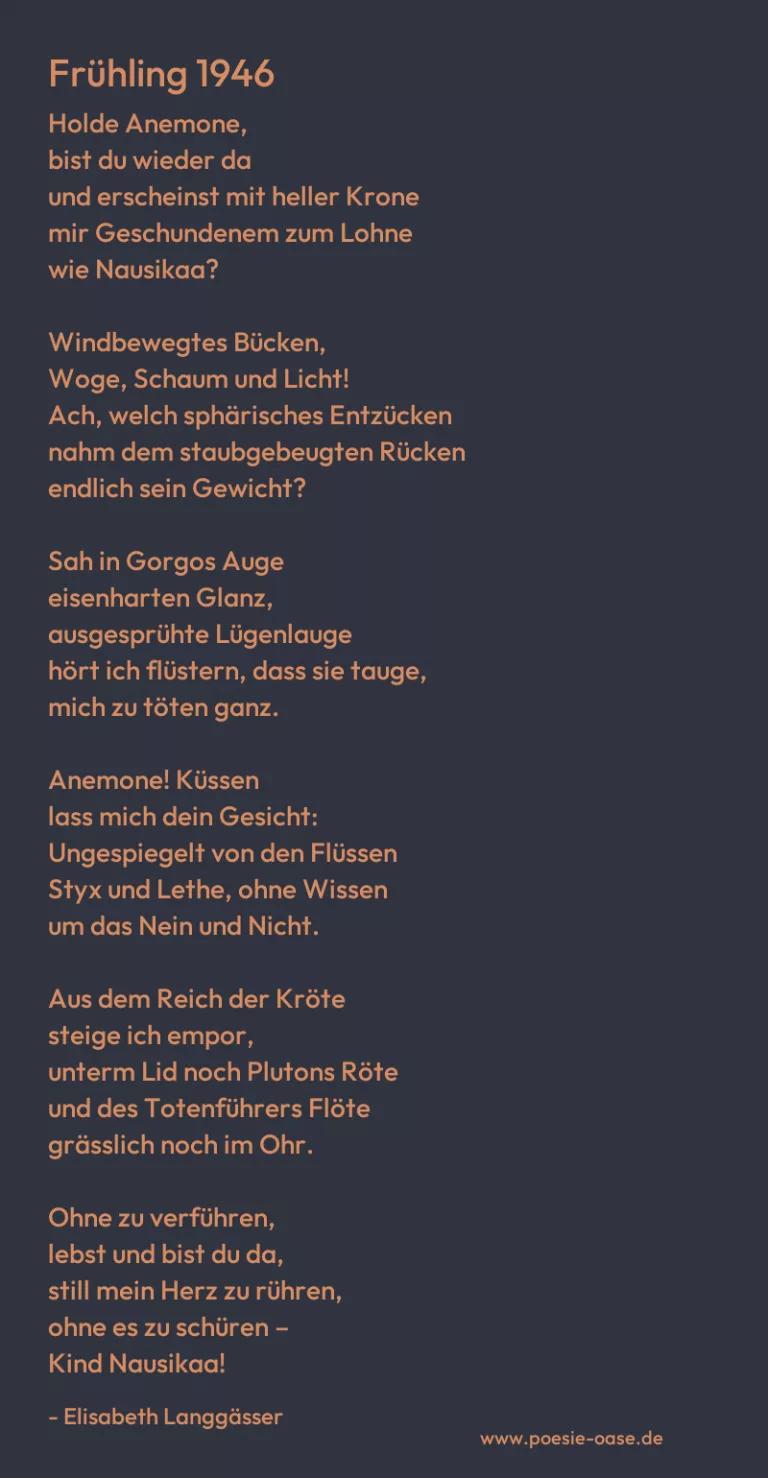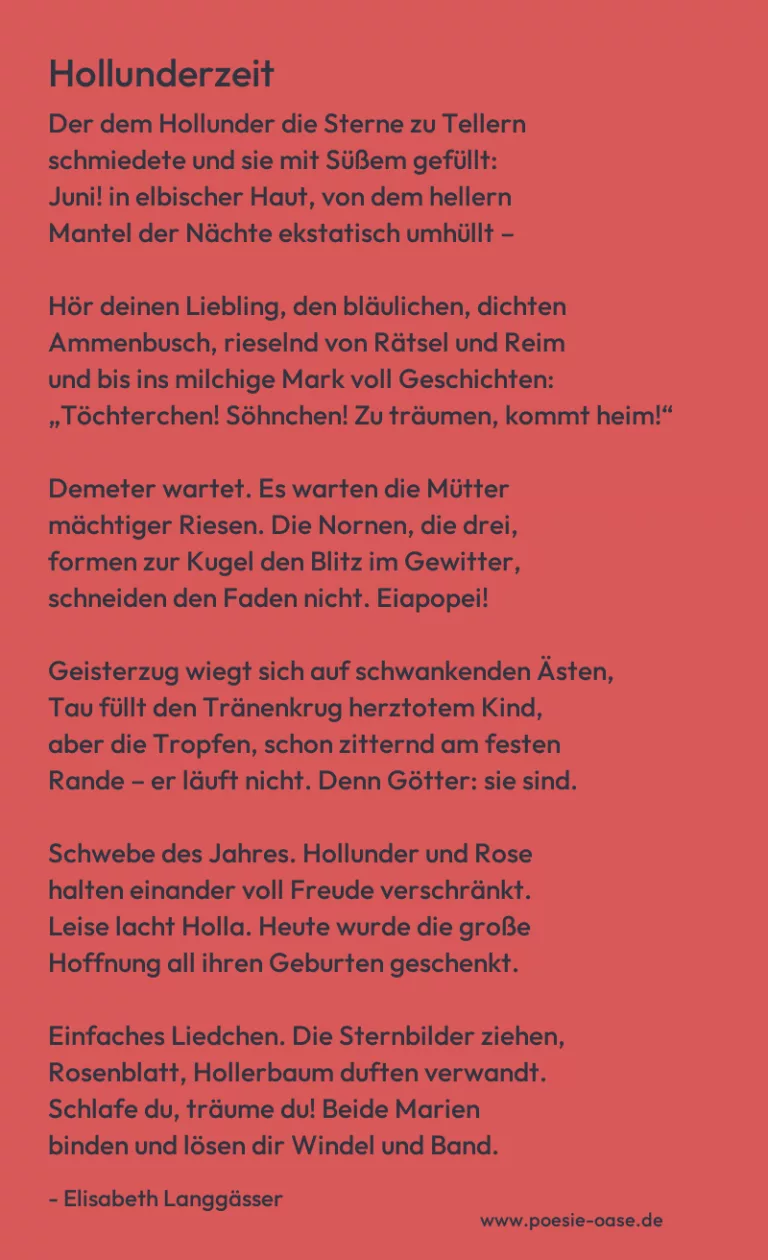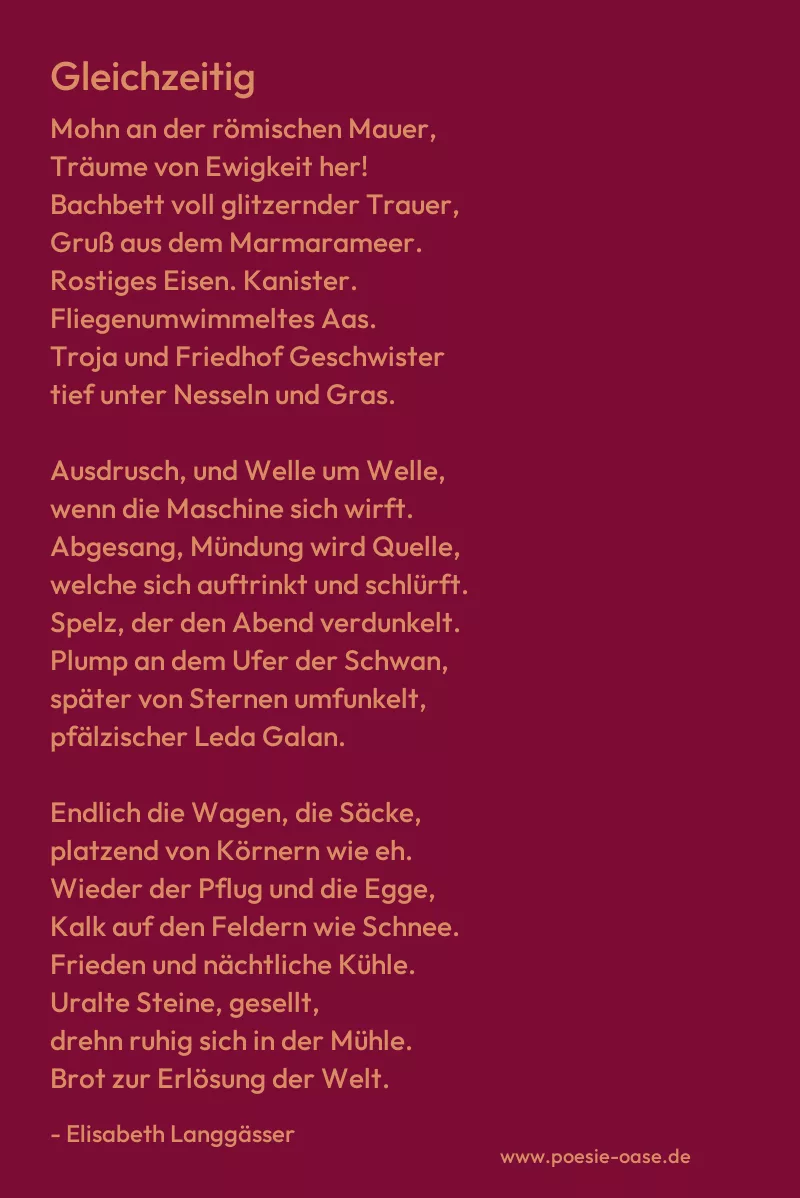Gleichzeitig
Mohn an der römischen Mauer,
Träume von Ewigkeit her!
Bachbett voll glitzernder Trauer,
Gruß aus dem Marmarameer.
Rostiges Eisen. Kanister.
Fliegenumwimmeltes Aas.
Troja und Friedhof Geschwister
tief unter Nesseln und Gras.
Ausdrusch, und Welle um Welle,
wenn die Maschine sich wirft.
Abgesang, Mündung wird Quelle,
welche sich auftrinkt und schlürft.
Spelz, der den Abend verdunkelt.
Plump an dem Ufer der Schwan,
später von Sternen umfunkelt,
pfälzischer Leda Galan.
Endlich die Wagen, die Säcke,
platzend von Körnern wie eh.
Wieder der Pflug und die Egge,
Kalk auf den Feldern wie Schnee.
Frieden und nächtliche Kühle.
Uralte Steine, gesellt,
drehn ruhig sich in der Mühle.
Brot zur Erlösung der Welt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
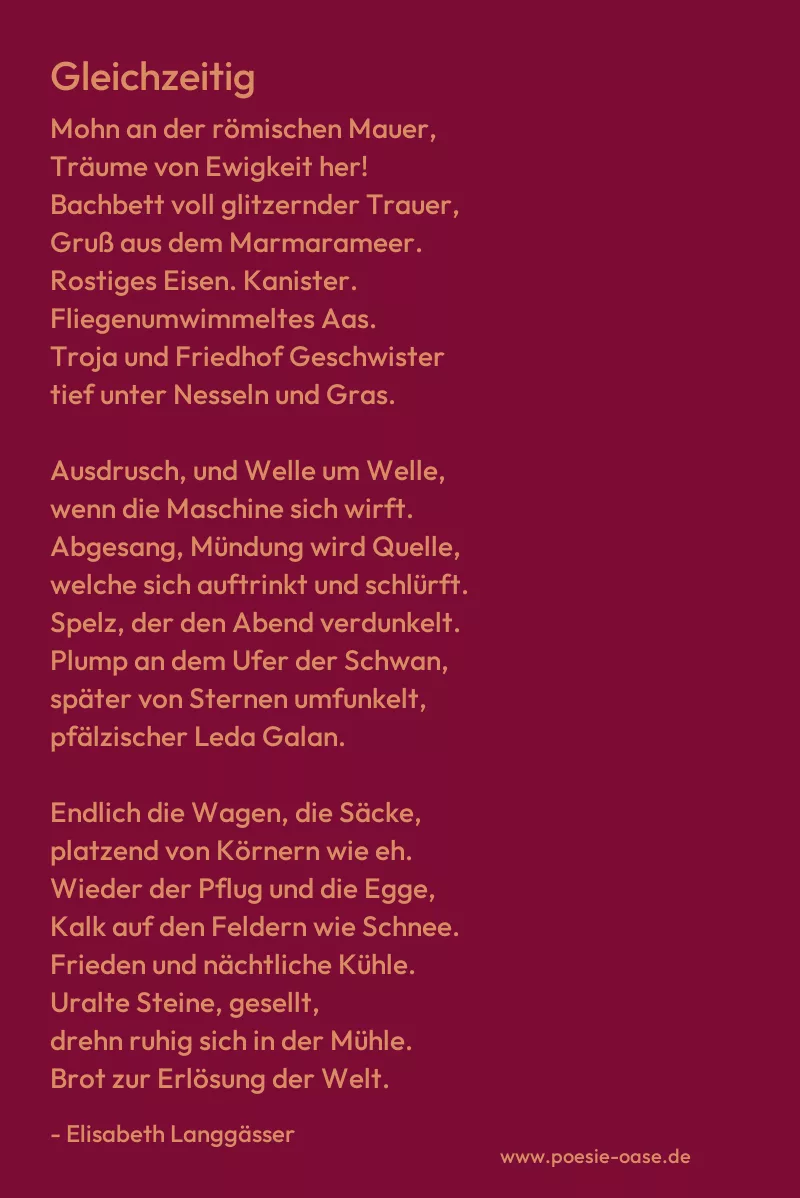
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gleichzeitig“ von Elisabeth Langgässer entfaltet eine eindrucksvolle Bildersprache, die verschiedene Epochen, Orte und Ereignisse miteinander verbindet und eine tiefgründige Reflexion über die Zeit, den Tod und die Erlösung anstellt. Zu Beginn wird die Szene eines „Mohns an der römischen Mauer“ gesetzt, die auf die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart hinweist. Der Mohn, ein Symbol für Vergänglichkeit und Tod, wird hier in einem antiken Kontext platziert, was die Unaufhaltsamkeit des Wandels und die Weiterführung der Geschichte trotz der Zerstörung betont.
Der Übergang von den historischen Bildern – „Troja“ und „Friedhof Geschwister“ – zu den düsteren Elementen wie „rostigem Eisen“, „Fliegenumwimmeltem Aas“ und der Darstellung von Krieg und Tod spricht von der Untrennbarkeit der verschiedenen Zeiten und ihre gleichzeitige Existenz. Die alten Ruinen, die in der Natur verwachsen sind, verbinden Vergangenheit und Gegenwart und zeigen, dass das Erbe von Zerstörung und Leid fortbesteht, selbst wenn es von der Natur überdeckt wird. Diese Verschmelzung von Antike und Gegenwart vermittelt ein Gefühl der zeitlosen Tragik.
Der zweite Abschnitt des Gedichts ist geprägt von bewegten, fast chaotischen Bildern. Die „Maschine“, die sich wirft, und die „Mündung, die Quelle wird“, scheinen den Fluss der Zeit und die ständige Transformation von Ereignissen zu symbolisieren. Diese Umkehrung von Zerstörung zu Neubeginn – „Abgesang“ und „Quelle“ – könnte auf die zyklische Natur von Krieg und Frieden hinweisen, die sich ständig abwechseln. Die Metapher des „Spelz, der den Abend verdunkelt“ und der „plumpe Schwan“ verweist auf die Unvollkommenheit und die dunklen Seiten des Lebens, auch wenn der „Abend“ durch Sterne „umfunkelt“ wird, was einen Hauch von Hoffnung und Schönheit inmitten der Dunkelheit andeutet.
Im letzten Abschnitt des Gedichts finden sich Bilder von Landwirtschaft und Frieden, die in starkem Kontrast zu den vorhergehenden Darstellungen von Krieg und Zerstörung stehen. Der „Pflug“ und die „Egge“ symbolisieren den Zyklus des Lebens, der trotz der zuvor beschriebenen Gewalt weitergeht. Die „ruhig drehenden Steine der Mühle“ und das „Brot zur Erlösung der Welt“ deuten auf den menschlichen Versuch hin, aus den Trümmern des Leidens etwas Nahrhaftes und Erlösendes zu schaffen. Hier wird der Akt der Arbeit und des Friedens als eine Möglichkeit der Versöhnung und der Heilung präsentiert.
Zusammengefasst spiegelt das Gedicht die Ambivalenz menschlicher Erfahrungen wider: Krieg und Frieden, Zerstörung und Schöpfung, Tod und Leben existieren nebeneinander, und der Versuch, Erlösung zu finden, wird durch den Zyklus der Natur und die mühsame Arbeit des Menschen dargestellt. Langgässer nutzt historische, mythologische und alltägliche Elemente, um zu zeigen, dass all diese Aspekte des Lebens gleichzeitig in der Welt und im menschlichen Bewusstsein präsent sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.