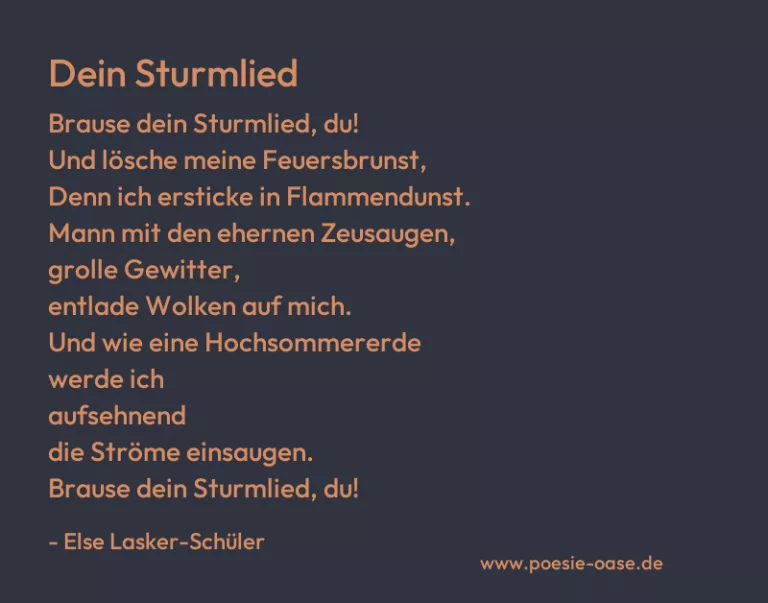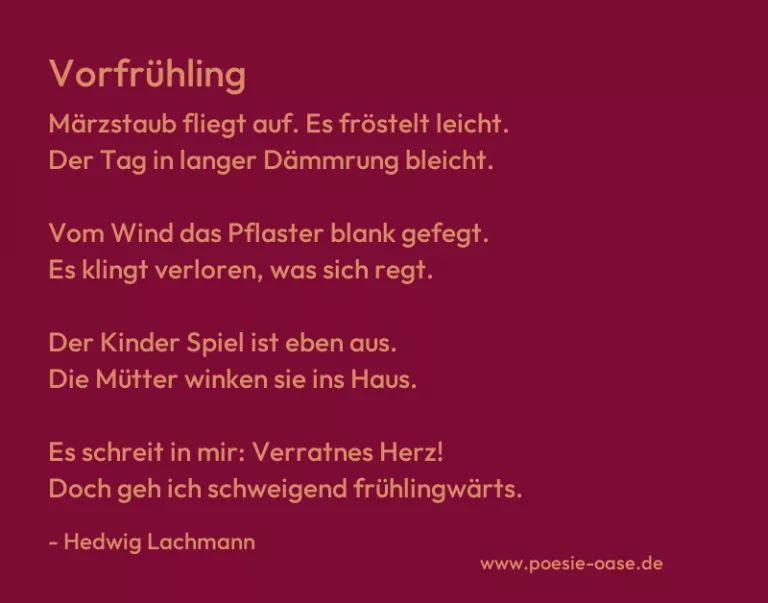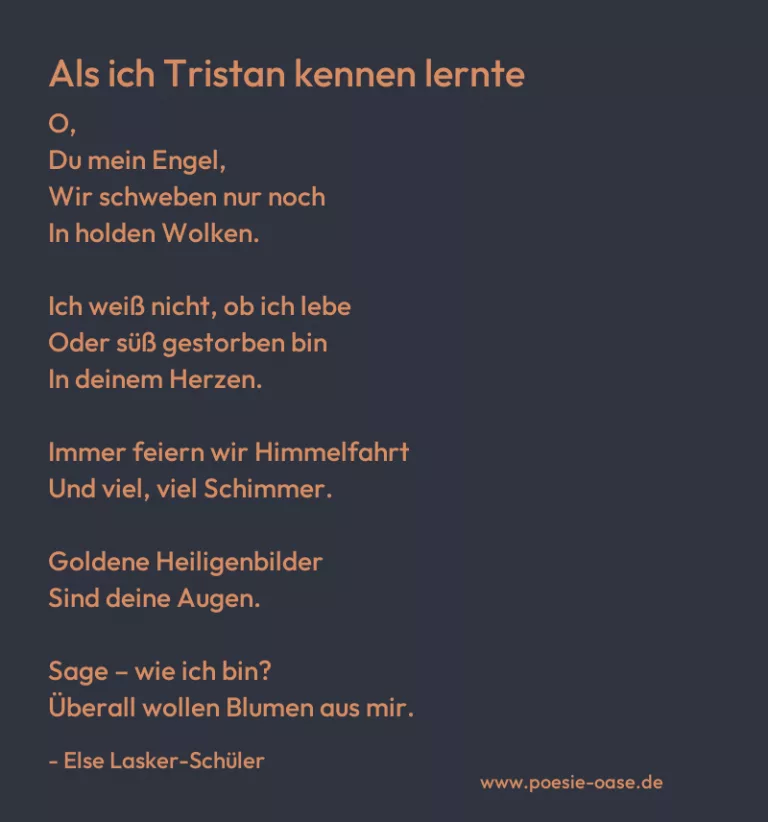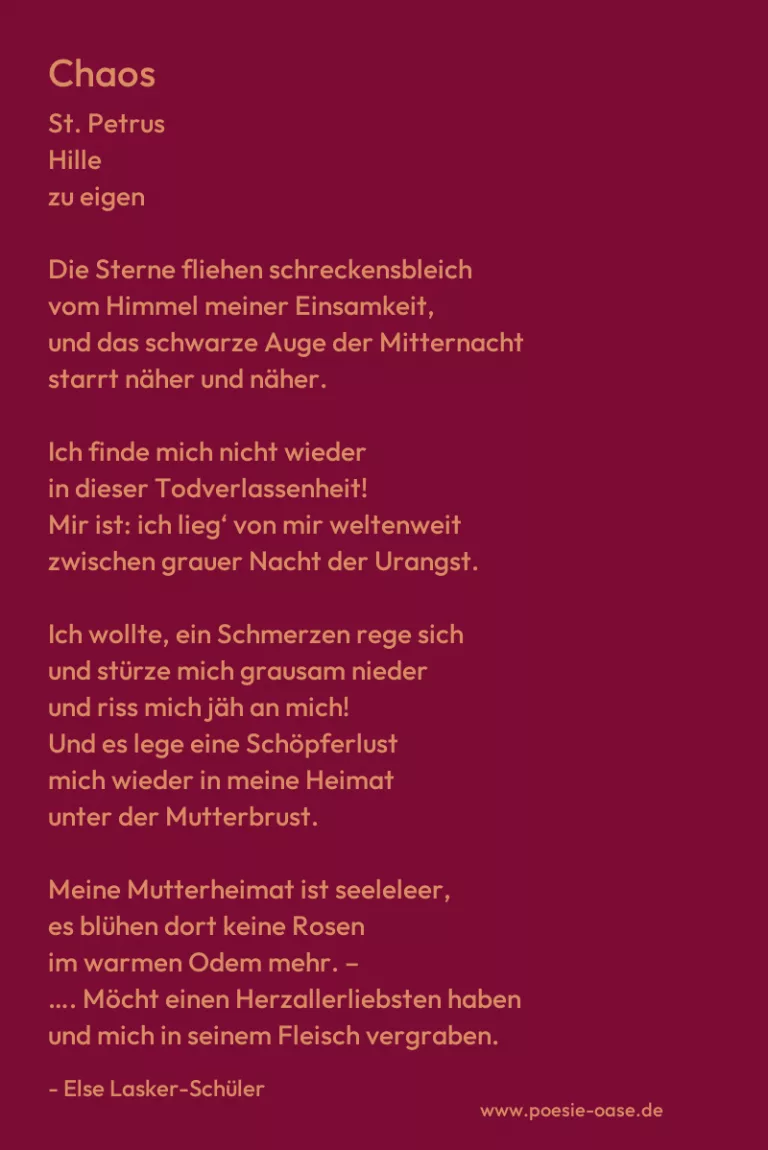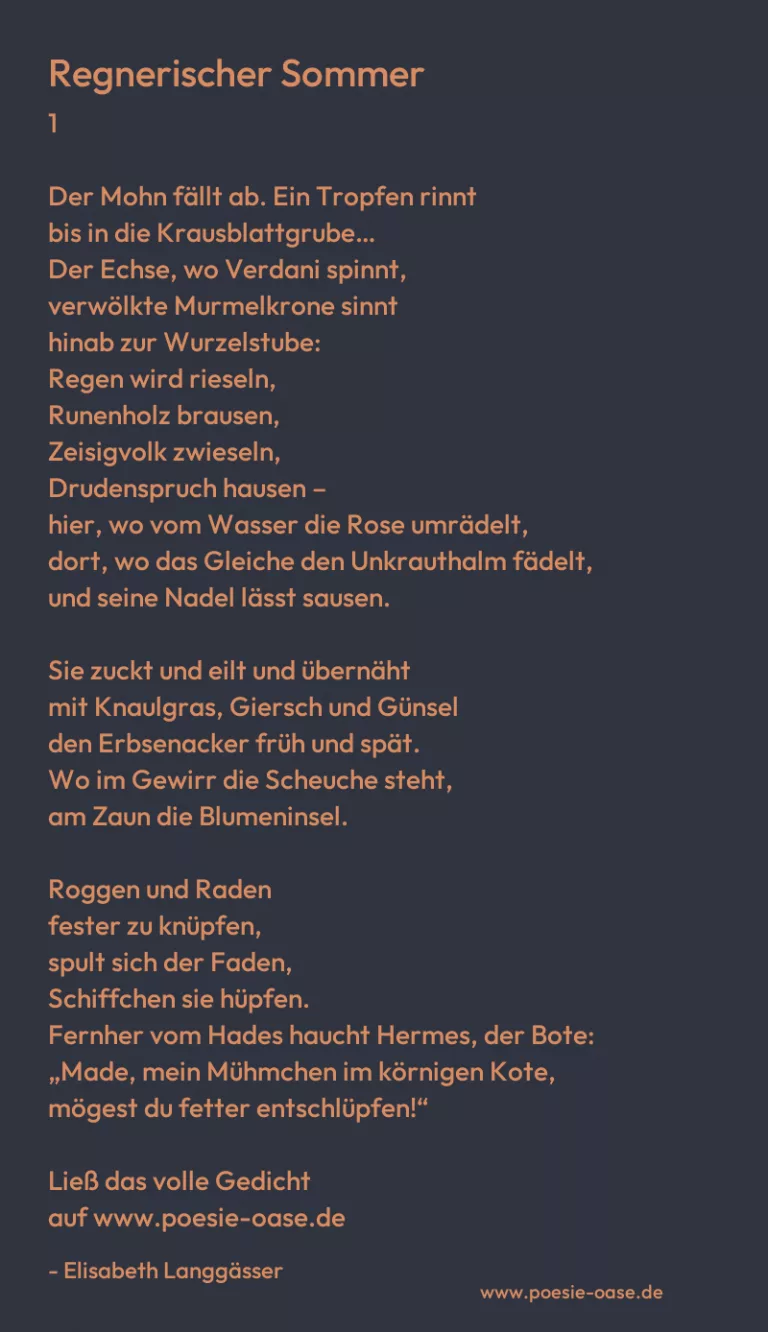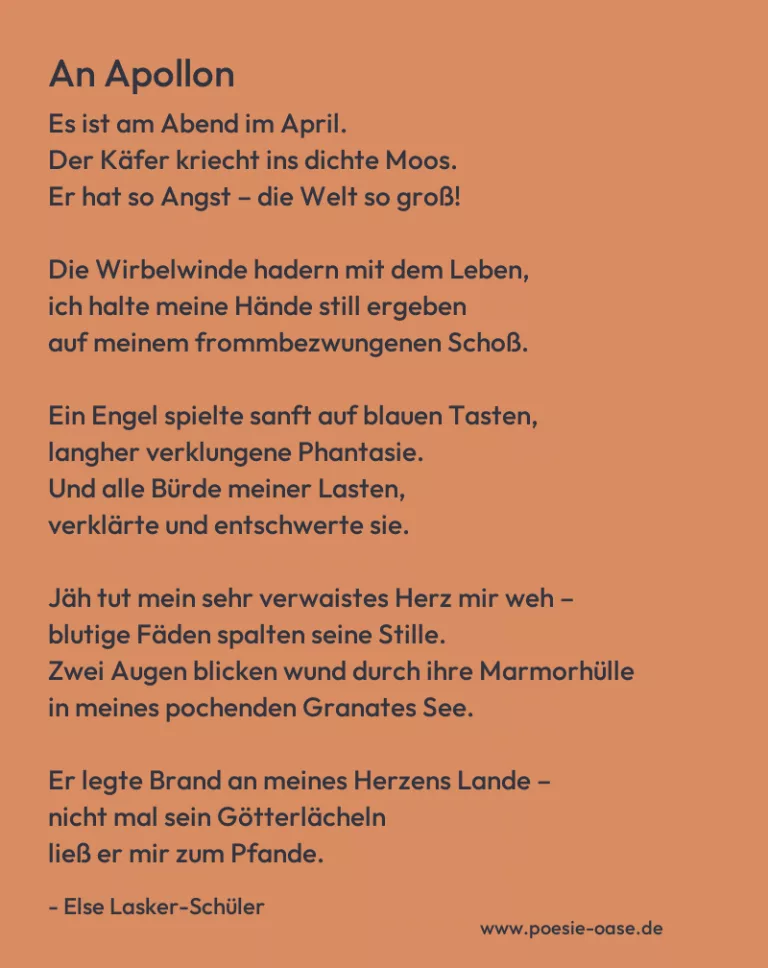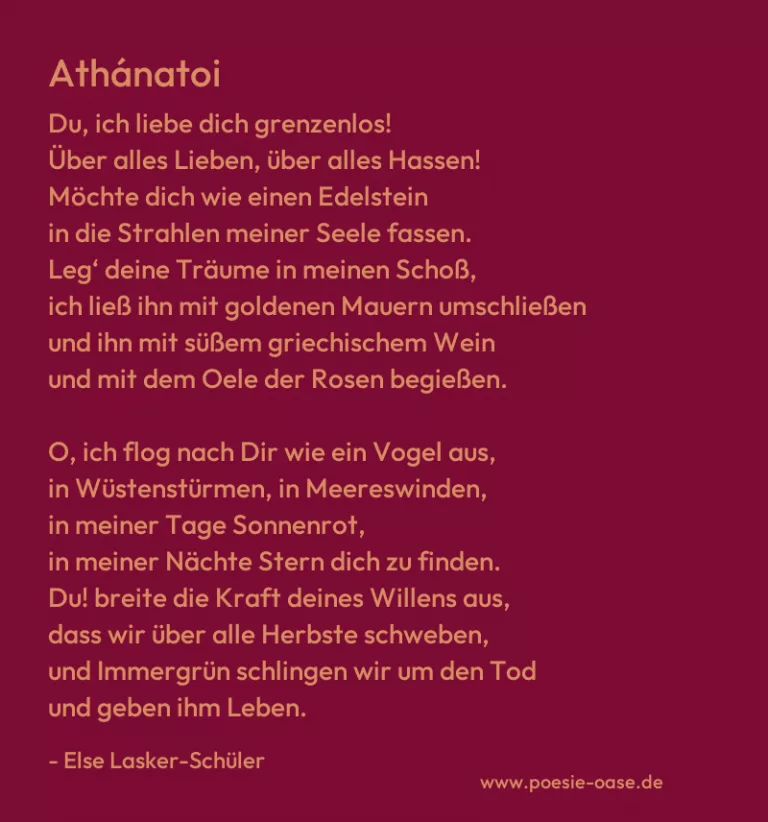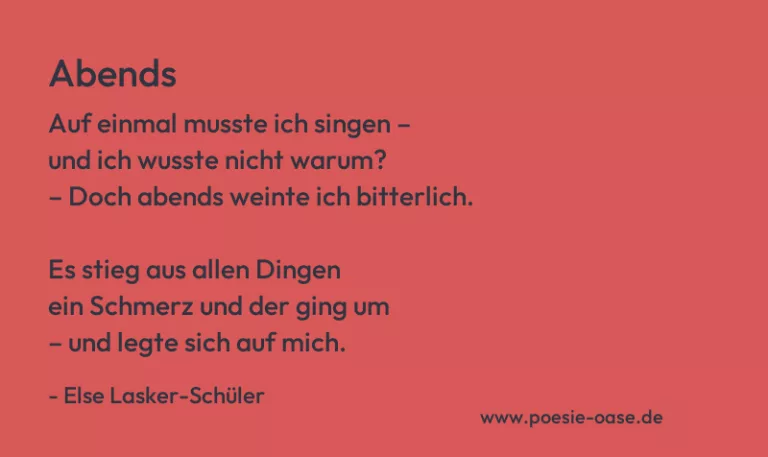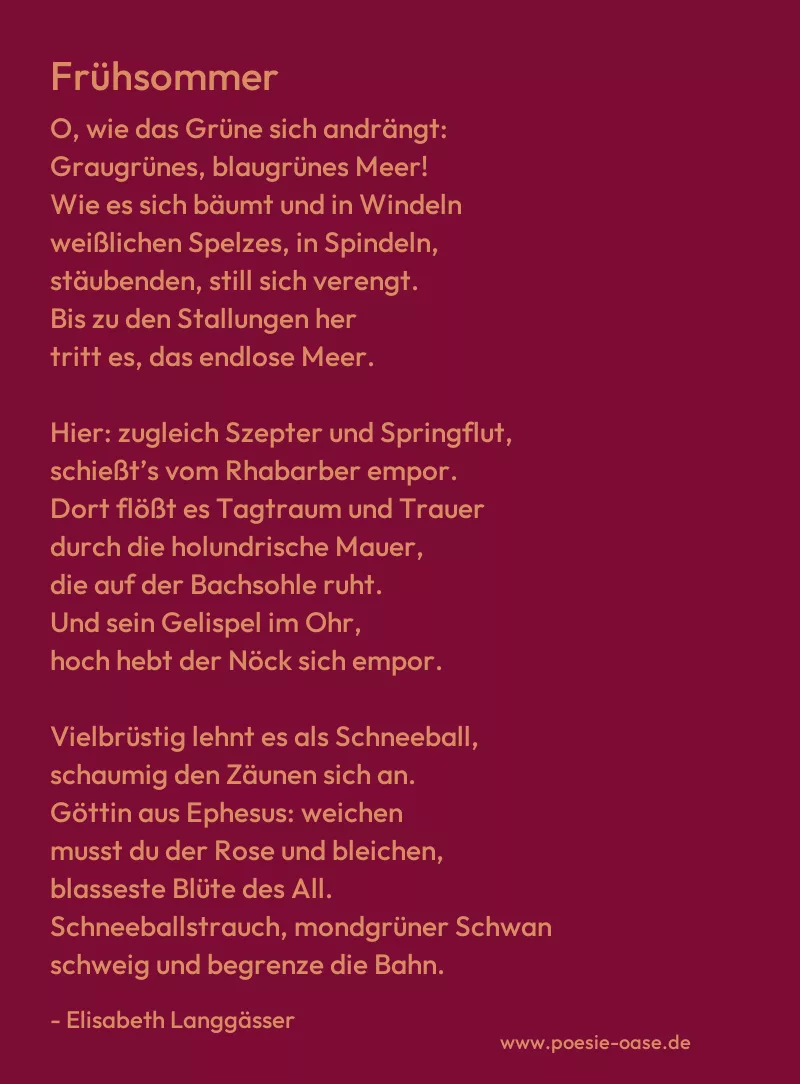Frühsommer
O, wie das Grüne sich andrängt:
Graugrünes, blaugrünes Meer!
Wie es sich bäumt und in Windeln
weißlichen Spelzes, in Spindeln,
stäubenden, still sich verengt.
Bis zu den Stallungen her
tritt es, das endlose Meer.
Hier: zugleich Szepter und Springflut,
schießt’s vom Rhabarber empor.
Dort flößt es Tagtraum und Trauer
durch die holundrische Mauer,
die auf der Bachsohle ruht.
Und sein Gelispel im Ohr,
hoch hebt der Nöck sich empor.
Vielbrüstig lehnt es als Schneeball,
schaumig den Zäunen sich an.
Göttin aus Ephesus: weichen
musst du der Rose und bleichen,
blasseste Blüte des All.
Schneeballstrauch, mondgrüner Schwan
schweig und begrenze die Bahn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
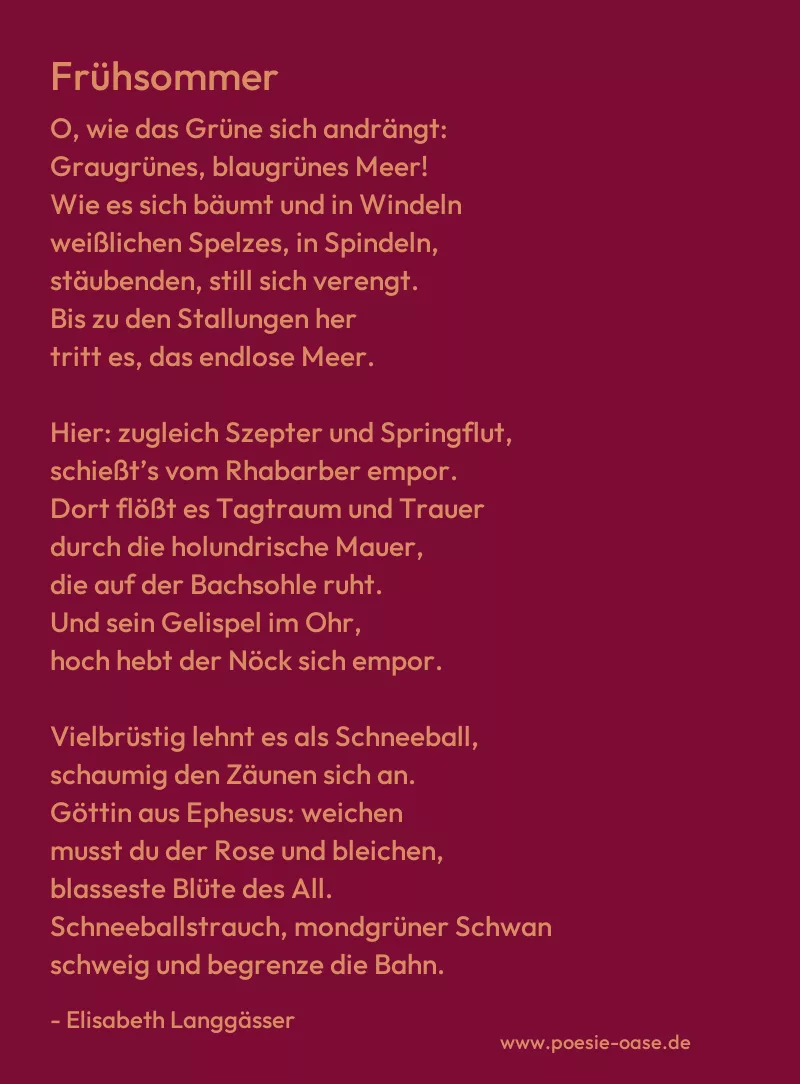
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Frühsommer“ von Elisabeth Langgässer entfaltet eine dichte und lebendige Naturbeschreibung, die mit mythologischen und poetischen Bildern spielt, um die Sinnlichkeit und die Unbeständigkeit des Sommers zu erfassen. In der ersten Strophe wird das „Grüne“ als ein drängendes, fast überwältigendes Meer dargestellt, das „graugrün“ und „blaugrün“ ist und sich in unendlichen Wellen „bäumt“ und „verengt“. Die Farben und Bewegungen des Grüns lassen es lebendig und fast körperhaft erscheinen, als ob die Natur in einem stetigen Prozess des Werdens und Vergehens begriffen ist. Das Bild des „Endlosen Meeres“ symbolisiert die Unermesslichkeit und die Zyklen der Natur, die die menschliche Existenz übersteigen. Der Übergang des Grüns bis zu den „Stallungen“ stellt die Nähe der Natur zu den menschlichen Lebensräumen dar, wobei das „Endlose Meer“ sowohl die natürliche als auch die von Menschen geprägte Welt durchzieht.
Die zweite Strophe beschreibt das Grün als eine kraftvolle, duale Präsenz, die zugleich wie „Szepter und Springflut“ wirkt. Die Begriffe „Szepter“ und „Springflut“ kontrastieren die Macht und die Unberechenbarkeit der Natur: Einerseits wird sie als beherrschend und majestätisch wahrgenommen (Szepter), andererseits wird ihre zerstörerische Kraft (Springflut) hervorgehoben. Das Bild des Rhabarbers, der empor schießt, sowie die „holundrische Mauer“ und die „Bachsohle“ verstärken die Sinnlichkeit und Lebendigkeit der Natur, die sowohl in ihrer Schönheit als auch in ihrer geheimnisvollen, unkontrollierbaren Seite dargestellt wird. Das „Gelispel im Ohr“ und der „hoch hebende Nöck“ (eine mythische Figur des Wassers) deuten auf die magische und fast surrealistische Atmosphäre des Gedichts hin, in der die Natur und die mythologische Welt miteinander verschmelzen.
In der dritten Strophe wird das Bild des „Schneeballs“ als Symbol für den Sommer verwendet, der sich „vielbrüstig“ und „schaumig“ an den Zäunen lehnt. Der Schneeballstrauch, der hier als „mondgrüner Schwan“ beschrieben wird, ist ein weiteres Bild für die zarte, aber kraftvolle Präsenz der Natur. Die Erwähnung der „Göttin aus Ephesus“ und der Aufforderung, dass sie „weichen muss der Rose“ und der „blassesten Blüte des Alls“, bringt eine mythologische Dimension ins Spiel. Die Göttin aus Ephesus, ein Symbol der Fruchtbarkeit und der weiblichen Kraft, wird durch das Bild der Rose ersetzt, das die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur symbolisiert. Die Rose, als „blasseste Blüte des Alls“, steht für die Vergänglichkeit und den Übergang des Lebens, während der Schneeballstrauch als „Mondgrüner Schwan“ eine ruhige und majestätische Präsenz inmitten der Veränderungen darstellt.
Am Ende des Gedichts wird der Schneeballstrauch zum Symbol für die Ruhe und das Maßhalten inmitten der Überschwänglichkeit des Sommers. Die Aufforderung, dass er „schweige“ und die „Bahn begrenze“, ruft zu einer Balance auf, die das Übermaß der Natur zügelt und die Schönheit der Vergänglichkeit bewahrt. Das Gedicht spricht von der Dynamik und den ständigen Veränderungen der Natur, aber auch von der Weisheit, die darin liegt, das Leben in seiner vollen Intensität zu erleben, ohne sich von seiner Unruhe und Vergänglichkeit überwältigen zu lassen. Langgässer gelingt es, mit ihren Bildern eine sinnliche und zugleich philosophische Auseinandersetzung mit dem Sommer und der Natur zu schaffen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.